(Materialien zu DTmF, als Ergänzung zu diesem Thema)
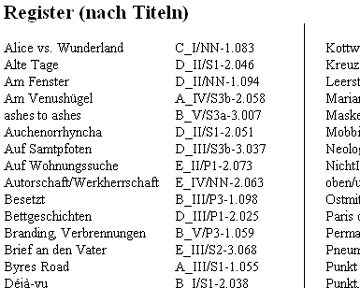
—
p.s.: vier der stoffe (nr. 001, 003, 006, 010, aus der anfangsphase der serienentwicklung) sind gerade erschienen in: außer.dem 13 (1/06)
(Materialien zu DTmF, als Ergänzung zu diesem Thema)
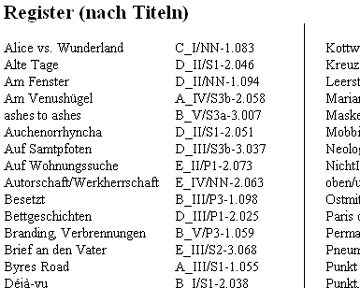
—
p.s.: vier der stoffe (nr. 001, 003, 006, 010, aus der anfangsphase der serienentwicklung) sind gerade erschienen in: außer.dem 13 (1/06)
(Materialien zu DTmF, Signaturelement: descriptor)
der, wie behauptet, auch title sei, um für weitere nötige Verwirrung zu sorgen. Über einen Artikel über Gregory Crewdson (Der Bund, 8.6.06. zu seiner Werkschau in Winterthur) werde ich angestossen. Über verstörende Bilder, die eben nicht einzeln von ihm getitelt, sondern einer Reihe ein mehr oder weniger kryptischer Reihentitel verpasst wird, heisst es. Und: er legt keine Fährten mit Bildunterschriften, sondern will, dass die Betrachter, die Betrachterinnen auflaufen in ihren ganz eigenen Phantasien, die seine Bilder auslösen.
Als ursprünglich die Idee aufkam, die Materialien zu signieren und auch zu erschliessen, gab es noch die Vorstellung, ein kontrolliertes Vokabular zu entwickeln und anzuwenden, sodass innerhalb des Materials auch natürlichsprachliche Beziehungen und Hierarchien sichtbar würden (Fährten). Nun, es hat sich etwas anders entwickelt. Vergeben wurde eine Art descriptor oder auch Phrase, die etwas über den Inhalt der jew. kleinen Form erzählen sollte. Viel mehr Spass machte es mir aber, mir jeweils einen Titel auszudenken, der vielleicht gerade noch zum jew. “Stoff” passte. Der also sehr wohl dazu assoziierbar war, und als solcher auch Assoziationen auslösen sollte, der die kleine Form aber nicht als Ganzes einfing, sondern sogar auf den Holzweg schicken konnte. Der descriptor fungiert also mittlerweile auch als Titel-Element. Und damit konnte auch ein alphabetisches Register angelegt werden, das in seiner Seltsamkeit schon wieder wie ich denke Auskunft gibt, über die Stossrichtung des Projekts. Das Register wurde somit auch wenn man so will – zu einem “handlungstragenden” Element der Stoffserie.
(Materialien zu DTmF, Signaturelement: Schlafphase)
Die Halbschlafbilder als Literatur das ist das Thema dieses Buches. Die Verheissung, durch sie das Unerhörte sagen zu können, das sich sonst der Sprache entzieht, das Einleuchtende, weil rein bildlich vor dem inneren Auge stehend, ohne Bedeutungskonvention, unmittelbar, ohne Vermittlung. Von einem inneren Sehen ist da die Rede, das weder wacher Gedanke ist, noch Symbolsprache des Traumes. Ein Sehen, das in paradoxer Weise das Unfassliche Gestalt werden lässt. Ein Sehen des Nicht-Identischen, des sich Wandelnden, des Vielen auf einmal. Man hat das auch als die Wahrnehmung des Klaren im Verworrenen bezeichnet. (…) Im Zentrum steht dabei immer wieder die Desorientierung insbesondere beim Erwachen: Der Schlaf hat den Plan des Ortes, an dem man sich befindet, verwischt. Der halb noch Schlafende ist ohne Orientierung; um sein Leben einzuordnen, kommt es nun zu unwillkürlichen imaginativen Versuchen, dem Unbekannten, Unbestimmten, Verwirrenden Form zu geben.
In der Einleitung zu: Pfotenhauer, Helmut. – Nicht völlig Wachen und nicht ganz ein Traum. Die Halbschlafbilder in der Literatur. S.2f.. Würzburg, 2006
Darin v.a.: Gesichte an den Rändern des Traumes: E.T.A. Hoffmanns Poetik der Halbschlafbilder. S.70ff.:
Nicht sowohl im Traume als im Zustande des Delirierens, der dem Einschlafen vorhergeht, vorzüglich wenn ich viel Musik gehört habe, finde ich eine Übereinkunft der Farben, Töne und Düfte. Es kömmt mir vor, als wenn alle auf die gleiche geheimnisvolle Weise durch den Lichtstrahl erzeugt würden und dann sich zu einem wundervollen Konzerte vereinigen müssten.(In: E. T. A. Hoffmann, Kreisleriana I, 5. Höchst zerstreute Gedanken)
(
) Hoffmann (…) stellt diese in jener Zeit viel diskutierten Halbschlafbilder ins Zentrum seiner Poetik einer Poetik des Visionären, des Schauens, das aber nicht bloss eingebildet, sondern auf eine eigentümliche Weise wirklich sein soll. Das wirklich Schauen des späteren serapionischen Prinzips hat hier, was bisher nicht gesehen wurde, seinen Ursprung. (…)
Es handelt sich hier, in dem früheren Text, um ein Schauen, das das Zerfliessen und Zusammenfliessen, also das Entgegenständlichen (h.h., verlinkung: hab), mit höchster Evidenz paart. Es ereignet sich sozusagen im Vorhof des Traums, einem Zustand des Delirierens, in welchem das Bewusstsein noch nicht ganz ausgeschaltet ist, der also verspricht, gut durchdacht und beobachtet werden zu können. Ein Zustand aber, der im Gegensatz zum Traum wenig zu besagen scheint, der nichts repräsentiert, kein Vorgängiges, Äusseres, kein Künftiges, kein Übersinnliches, das insgeheim die Welt zusammenhält. (…)
(Materialien zu DTmF, reines Erzählen)
Während es der tiefenpsychologisch orientierten Literatur um Sinn und lebensgeschichtliche Bedeutung, der naturwissenschaftlich orientierten Literatur um Entstehung und physiologische Lokalisierung von Träumen zu tun ist, geht es Dichterinnen und Schriftstellern ausdrücklich um anderes: Sie machen sich den Traum praktisch zu Nutze in Gestalt fiktiver Traumtexte. Die ihnen aus eigener Erfahrung und dem Wissen ihrer Zeit bekannten Traumverfahren inspirieren sie zu Entdeckung und Entwicklung bisher unerprobter Erzählmöglichkeiten. Franz Fühmann, einer der schreibenden Traumexperten, bekennt, dass er in seinen Traumerzählungen nicht etwa ein flüchtiges, unlogisches Irrlicht der Phantasie suche, sondern vielmehr “eine Möglichkeit reinen Erzählens, Fabulierens, weg vom Beschreiben und Essayisieren”. (…) Autorin und Autor geben mit der Bestimmung eines Textes als Traumtext in der Regel gleichsam eine Leseanweisung: Es gelte die Freiheit von Erzählkonventionen zu genießen, das ungegängelte Wirken der Imagination, das auch Gattungs- und Tabu-Grenzen zu überschreiten vermag.
in: Gidion, Heidi: Phantastische Nächte. Traumerfahrungen in Poesie und Prosa. S.8f. Göttingen, 2006
Wir hoffen auf Ihre Diskretion und ihr Verständnis. Wir machen Sie zu Mitwissern, Betroffenen und Teilen des Dramas. Wir öffnen unsere Archive und Sie finden Konvolute vergilbter Zettel und Registerkarten, verzeichnete, signierte, wir können nur vermuten, von wem. Wir sind Schiffbrüchige, die sich an nächstbeste Planken krallen, solange, bis uns die Kräfte verlassen und wir versinken. Wir ergänzen, wo wir können oder müssen, ordnen, deuten, lesen, was sich vor unsere Feder bewegt.
Wir fühlen uns sicher, wo eins und eins zwei sind, und wo nicht, behaupten wir, dort sei ein Traum. Wir behaupten ernsthaft, es sei der Traum eines anderen.
zu den kommentaren hierauf und mit herzlichem dank fürs geduldige lesen an markus hediger und meine frau.