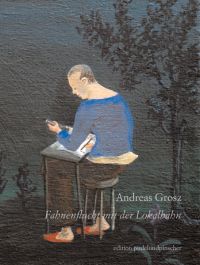Oben ohne
Seit den 60er-Jahren war ich zügellos.
Ich wollte offen über alles reden und nahm kein Blatt vor den Mund, vor allem in Gesprächen mit meinen Eltern nicht, in M., einer Kleinstadt in der Provinz.
In M. trugen die Leute Hüte, die ihnen wegen ihres immensen Gewichts zwar jeden klaren Gedanken unmöglich machten, deren Spitzen aber bis in den Himmel reichten, weswegen man sie salopp Wolkenkratzer nannte.
Ich selbst lehnte es vehement ab, einen Wolkenkratzer zu tragen. Lieber ging ich oben ohne und nannte es freie Körperkultur.
Die freie Körperkultur ermöglichte es mir, meinen Großonkel Georg derart in moralische Entrüstung zu versetzen, dass er, nachdem er wiederholt der Nacktheit meines Kopfes ansichtig geworden war, einen Herzinfarkt erlitt.
Noch auf der Intensivstation brachte er meinen Vater in Gewissensnot. Der Wolkenkratzer sei obligatorisch, gerade für die jüngere Generation, wo komme man denn sonst hin? Er werde unserer Familie keine Besuche mehr abstatten, wenn ich, der Sprössling, nicht wie alle anderen, und zwar auf der Stelle, einen aufgesetzt bekäme.
Großonkel Georg machte seine Drohung wahr und besuchte uns dann nicht mehr.
Auch mein Besuch an seinem Grab steht noch aus.
(c) / aus: Wilfried Happel, Abstecher ins bürgerliche Jenseits, edition pudelundpinscher 2009.
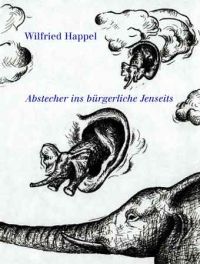
Wilfried Happel, 1965 in Nürnberg geboren, lebt als Autor und Theaterregisseur in Berlin. Theaterstücke im Verlag der Autoren: Das Schamhaar (1994); Mordslust (1995); Kleiner Zwischenfall in den französischen Alpen, Hörspiel (1996); Fressorgie oder der Gott als Suppenfleisch (1997); Der Nudelfresser (2000); Die Wortlose (2001); Mein Onkel Bob (2003); Fischfutter (2004); Stück mit zehn Titeln (2006). Prosa in der edition pudelundpinscher: Abstecher ins bürgerliche Jenseits (2009). Gedichte in Anthologien und Literaturzeitschriften
DOI: 10.17436/etk.c.009