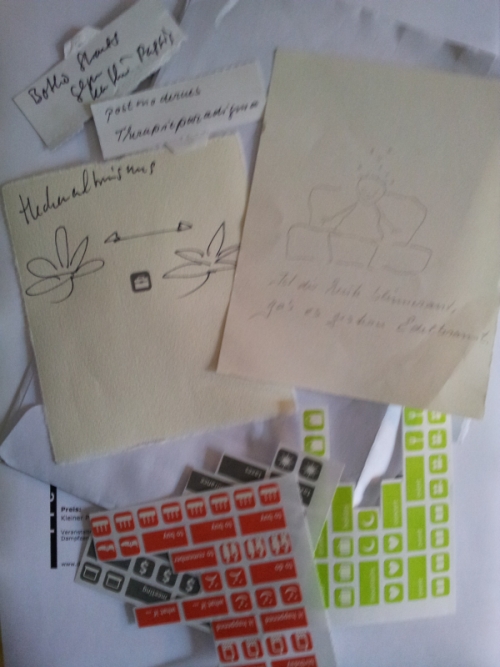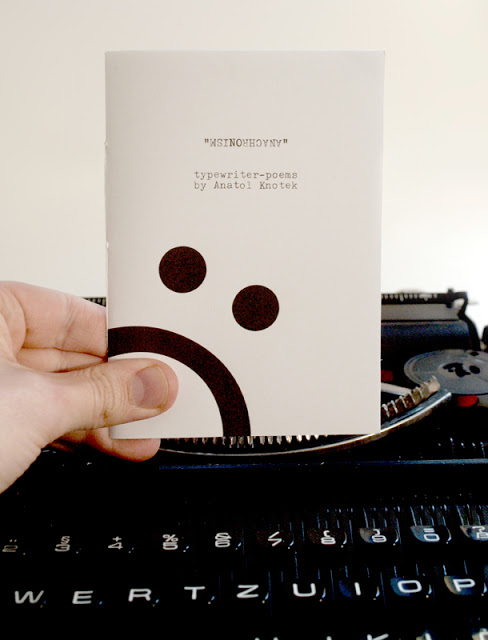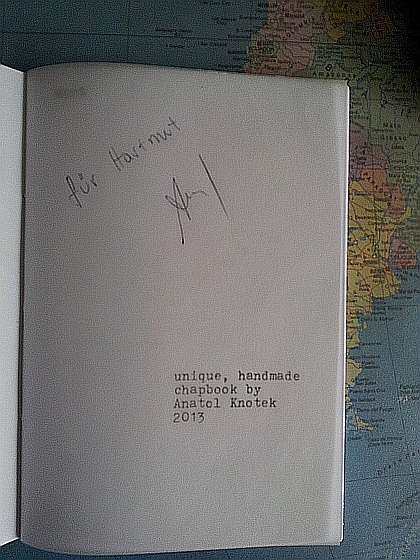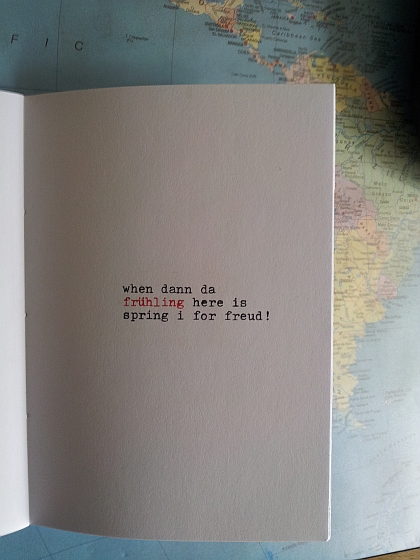Statistische Texte mache ich nur noch selten. Ich bin, weil mich auch die Frage nach dem Eigentum am Text bewegt, das ich nicht will, weitergegangen zu Wörterlisten. Ich wurde aber nach einer kurzen Erklärung gefragt, was es denn damit auf sich habe. Hier kommt sie. Die lange hat in den letzten Jahrzehnten genau vier Leute interessiert, darunter kein Deutscher. Das Wort machen ist dabei übrigens mehr als angebracht, wie man gleich sehen kann. Vorab noch ein Satz zur Zukunftsfähigkeit des statistischen Gedichts, einer weiteren Frage. (Für echte Gedichte wäre sie eine Beleidigung.) Ich sehe sie nicht. Man kann sie nur genießen, solange die Sprache, aus der sie entstanden sind, sich nicht verändert. Sprache verändert sich aber ständig. Mit den Sprach- und Hörgewohnheiten von heute zu spielen heißt, morgen nicht mehr verstanden zu werden, zumindest nicht mehr genossen. Nun gut.
Auf ein Wort folgt ein anderes. Welches? Irgendeins – doch oft ein bestimmtes, sein häufiger Nachfolger. Das lässt sich auszählen aus Zeitungsartikeln, aufgezeichneter Rede oder aus Gedichten. Auf dieses zweite Wort folgt wieder eins. Dafür gilt das Gleiche. Und was für Wörter gilt, gilt auch für Redensarten, sie bevorzugen bestimmte Umgebungen. Löst man sich vom konkreten Ausdruck, kann man Metaphern, Bilder untersuchen. Zwar steht der Fels in der Brandung, aber wo brandet die an? So viele Küsten sind es nicht. Auch der Rhythmus eines Gedichts wird in Wörtern ausgeführt, haben wir ein Tamtam herausgehört, ahnen wir oft, wie es weitergeht. Was es mit häufigen Reimwörtern auf sich hat, zumindest im Kitsch, dürfte geläufig sein. Es hat die Mutter ein Herz wie … Na? Und wie im Großen, so im Kleinen. Silben, Morpheme, Vokale und Konsonanten und ihre Nachbarschaften lassen sich listen und klassifizieren. Hübsche Bilder kann man malen nach der Vokalverteilung in einer Ballade – aber auch Hunderte auswerten und nach Gemeinsamkeiten suchen. Aus solchem Wissen lernen wir etwas über Erwartungen, was wir hören, legt nahe, was häufig tatsächlich nah ist. Diese Erwartungen binden die gedichtige Rede über Reim, Rhythmus und Wortwahl hinaus, z.B. durch Assoziationen, ablesbar an den Häufigkeitsgruppen. Das alles treibt jeder, auch unbewusst, aus dem Bauch heraus. Kommt Absicht dazu, wird es schwieriger. Schwitters z.B. hat seiner Anna Blume alles mitgegeben, was er über das Liebesgedicht an sich wusste. Eine großartige Leistung, heute aber leichter zu erreichen, nämlich durch Sieben und Berechnung. In diesem Sinne funktioniert das statistische Gedicht. Man kann es mit der Collage vergleichen, wenn dem Ausschneiden, was Schwitters empfahl, mehr Aufmerksamkeit gewidmet wird, also gerade kein Zufall waltet. Je gründlicher man arbeitet, desto kitschiger wird das Resultat. Am Beispiel des Liebesgedichts heißt das: der typische Inhalt mit den typischen Mitteln in der typischen Form (- nicht gerade einfach übrigens, ein Programm zu schreiben, das Sonette schreibt; Sonette sind dagegen ein Kinderspiel). Zum Glück gibt es viele Arten von Liebesgedichten, man kann eine Menge Statistiken erstellen. Zu einem Ergebnis kommt man bei der Collage, indem man das Ausgeschnittene wieder zusammenklebt. Das kann eine Software übernehmen, ein Generator, der wesentlich durch den Input, das in Tabellen sortierte Schnittgut, gesteuert wird. Ein solcher Generator soll nicht unendlich viele Gedichte erzeugen, sondern genau eins. Summarizer, Analyse, Listen und Generator zusammen schaffen das statistische Gedicht. Wie man wohl gleich vermutet, ist es nun sehr langweilig. (Hier ein primitives [1] und hier ein langes, langweiliges Beispiel, hier seine Dekonstruktion.) Aber es ist schon verfallen. So, wie wir mit dem Klang der Wörter spielen, können wir es mit den Erwartungen halten. Allzu glatt taugt nicht.
Ein paar Jahre auf sich warten / dazu noch sich sehen lassen ist ein so erzeugter Satz, den kann man ändern, ‘brechen’ nenne ich das. In diesem Beispiel eignet sich dafür das Wort sehen, weil es mit lassen (nur textstatistisch) ziemlich fest verbunden scheint. Wachsen wäre eine Alternative. Ein paar Jahre auf sich warten / dazu noch sich wachsen lassen – wohin? In den Himmel (sehr häufig), über den Kopf (auch nicht selten) oder, nächster Bruch, über den Himmel? Oder beides? Oder mit in, dann aber nicht den, sondern das häufige dich, weil es mit sich zusammenklingt. In dich und(!) in sich frisst man statistisch hinein. Das käme dann so: Ein paar Jahre auf sich warten / dazu noch sich wachsen lassen / über den Himmel, in dich hinein. Das hat doch schon was und ist kein Kitsch, kein reines Destillat mehr. Alles klar? Wahrscheinlich nicht. Ich habe, nachdem mich vor bald dreißig Jahren Jule Schneider darauf gebracht hat, sehr lange gebraucht, mich hineinzufinden. Sie fragte mich damals, warum ich den Computer nur zur Texterzeugung, nicht zur Textanalyse verwende und fügte an: Warum nicht beides verbinden? So fing es an. Als wenig hilfreich erwiesen sich Benses Vorschläge zur Textstatistik, die mich allerdings in anderer Hinsicht bereichert haben. Mehr gab es nicht. Wenn auch die Verse trivial erscheinen, das Verfahren ist es nicht. Was man sonst über Gedichte weiß und dazu braucht, das bleibt alles erhalten, die Textstatistik tritt nur hinzu.
Wenn aber das Gedicht nicht nur der Maschine entstammt, nicht vom Zufall, sondern von Absicht geprägt ist, kann es auch wieder Kunst sein und gehören. Und was gehört, das ist tot. Drum gleich weiter zu den Wörterlisten, für die ich neben der bloßen Auszählung oft ähnliche Methoden nutze, nur auf die hübschen Förmchen für die Ausgabe verzichte.
Quelle 1 (2006)
[1]
Märchen kaputt
“Adieu, Herr Hans,
was soll ich tun,
ich armer Mann?”
“Guten Tag, Gretel!”
Hans kommt zur Gretel.
“Wo bist du gewesen?”
“Guten Abend, Mutter.”
“Was bringst du Gutes?”
“Guten Abend, Hans,
guten Tag, Hans.”
Warum auch nicht,
ich bin schon da.
“Adieu, Frau Gretel!”
Drum ist sie mein –
nun nimmermehr.
Das wär des Kuckucks.
Und das war Recht.
“Was du verlangst,
und wo bist du,
was sprichst du da?”
“Was macht mein Kind,
was macht mein Reh?”
Was will sie denn?
Schon gut gemacht.
Und Treppe hoch:
“Mutter, Adieu.”
“Wohin, mein Hans?
Hans, mach es gut.”
Einmal war Gretel.
Hans wenn sie nicht …
Ich hab’s heraus.
Na, was willst du?
Quelle 2 (2006)
DOI: 10.17436/etk.c.032
Dirk Schröder lebte in Berlin. Seit 2016 lebt er in Metzingen. Mehr / Website Autor