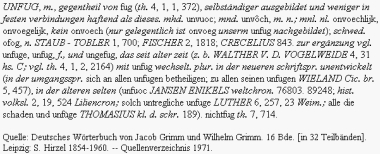1 möchten wir ergänzen: bevorzugen wir copypaste dem copyandpaste, weil uns das paste schon im moment des copy erfolgt. schon vor dem ansatz (vor seinem gedanken, vorgedanklich) ist sein bizarrer schnitt ein uns gewählter. und gleichzeitig: seine fügung. machen wir schroffe schnitte. harte cluster, die dann von uns bewegt, bald versetzt werden. auch darum entstehen uns texte mit ecken und kanten. (auf die man naserümpfend zeigen könnte). allerdings hat das vorteile. (wie wir belegen). zusätzliche and-stationen, nämlich; zwischenspeicherungen, reflexionen also (die doppelten, nämlich), die ihre gegenstände mit gefühlen malträtieren, werden von uns so bewusst übergangen. wozu auch soll dieser fort=schritt notwendig sein? eben dieser soll, nein, muss ja vom leser geleistet werden. (wir schuften hier doch nicht alleine). und: eben dieser schritt (zuviel) rückt uns den text ins warenhafte. ins ornamentale. in eine ökonomische form des zweckhaften. beziehungsweise: geschieht exakt in diesem moment ein betrug an der sache. der sache seiner eigenen ursprünglichkeit. (wäre man freudvoller, spräche man vielleicht verschämt von einem es des textes. des text=es: des rabiaten, widerständigen, renitenten, das zwar von seiner nächsten instanz zurechtgemacht werden soll, aber um seiner wurzel willen, nicht in ein allzu allgemeines aufgelöst werden muss, um es verhandelbar zu machen). wir zerschneiden die dinge also auch um ihrer form willen. wir veräussern diese aber nur bis zu einem gewissen grad. wir selbst ziehen die grenze.
1 wenn uns ein schriftsteller erklärt: der Autor macht Copy-and-paste mit den Gefühls- und Wissensbestandteilen, die überall verfügbar sind. (vt2/08,8)