Über das Deckeln der Schachteln wurde schon an verschiedenen Stellen kommentiert und gesprochen. Nachdem sich die Reihe langsam dem Ende zuneigt, konkretisieren sich einige Vorhaben. Der jeweilige Kommentarstrang, der einerseits meist für die Titelung zuständig war, wurde immer auch schon, zumindest materialmässig als dritter Teil einer jeweiligen Einheit betrachtet (s.u. #4). Allein mit der Form war ich nie so ganz zufrieden, und der gesamten Einheit täte es optisch denn auch gut, wenn die einzelnen Kommentartexte bearbeitet und in irgendeiner Form zusammengeschrieben stünden. Aus einem Strang der 25. Schachtel:
#4
es ist ungefähr und von der struktur her meistens so:
da ist an erster stelle ein ich, das eine assoziation zu einer groben form setzt. an zweiter stelle (das ist der kleinschrieb) findet meist ein abgleich (oder eine konkretion, wenn man auch will eine verinnerlichung) statt, der den ersten ansatz wieder aufnimmt. an dritter stelle stünde der kommentar(strang), der (die beiden ersten formen in synopse) wieder öffnet, vielleicht: auspackt. es wird so eine art sprachumzug simuliert. aufstellen – einpacken – auspacken. all die gesetzten kommentare oder dialoge zu 1 und 2 sind als material da sehr wertvoll, sollten aber noch eine bestimmte form erreichen, die sich über ein kollektives ich vielleicht bündeln liesse. (…)#7
dann würde ich dir folgendes vorschlagen (um den kern solide zu machen, wie du sagst): verstehst du die kommentare als auspacken, dann würde ich eine verarbeitungsform für die kommentare wählen, die einem in die welt bzw. in den raum zurückstellen entspräche. das eingepackte also in einen breiteren kontext setzen und die (leere) schachtel zusammenfalten. wie könnte das formal aussehen / welche form wäre dafür zu wählen?: an erster stelle hast du die, wie du sagst, grobe form. an zweiter das dicht zusammengepackte. an dritter, müsste da konsequenterweise nicht das etwas weniger dichte, vielleicht sogar ein bisschen ungeordnete folgen? in form einer shortest story etwa? (darin hast du ja übung, wenn ich etwa an die träume meiner frau denke.)
mah am 16.05.07#8
schöne idee. weiss allerdings noch nicht ob da stories rausspringen. dachte da eher auch an noch kürzere texte. auch: an eine art lyrischen schlagwortkatalog mit syntax. müsste man mal ausprobieren. ich werde da mal mit experimenten anfangen, wenn das ganze material (30+x) zusammen ist. die einzelnen texte, auch die kommentare sind da ja auch sehr unterschiedlich … (die form der dtmf ist bei mir zwar gut in übung, aber im moment auch ein bisschen ausgereizt …)
hab am 16.05.07
Zur Arbeit am Prototypen: Ob sich nun das dritte Ich als Ich oder man (s. o. #4) besser macht, kann ich jetzt noch nicht beurteilen. Und ob denn tatsächlich ein lyrischer Schlagwortkatalog oder eine Art lyrisches Indexat Sinn ergibt ich bin noch am experimentieren. Zu vielfältig sind da die Möglichkeiten, um nur ein einfaches Beispiel zu zeigen:
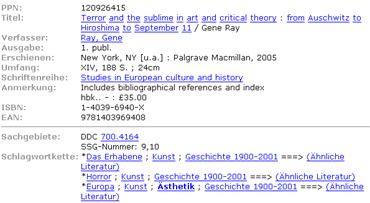
Fest steht allerdings, dass ich die Kommentare zu einer Einheit bündeln und dem Flottierenden eine einfache Form geben möchte. Ich übe hier noch an relativ einfachen Beispielen, z.B. dem kurzen K.-Strang der 1. bzw. 2. Schachtel. Dort heisst es bei 1.:
#1
du füllst, so scheints, die büchse der pandora.
mah am 18.09.06#2
verflixt – verschachtelt
mar am 19.09.06#3
ad mah // so schlimm wird es wohl nicht werden und eher über verpackungen gesprochen. ich glaube auch, das erschreckendste an der pandorabüchse war, dass man (neben der hoffnung) darin eine weitere büchse fand. ein detail, das beharrlich verschwiegen wird.
bei dieser gelegenheit melde ich titelschutz an für die büchse in der büchse der pandora.
hab am 19.09.06
und daraus wurde in einem ersten Wurf gemacht:
Ich fülle, scheints, die Büchse der Pandora; verflixe, verschachtele; weniger schlimm; die Verpackungssprachen; glaube den Pandorabüchsenschrecken; darin neben Hoffnung, weitere Details; beharrlich schweigend, beschweigend; zu schützen die Büchse in der Büchse der Pandora.
Oder als eine Variante nach den Kommentaren bei 2.:
#1
ich musste – bei deiner kleinschriftigen beschreibung des kartons – an ikea denken. da ist ja alles so verpackt, dass es sich wunderbar stapeln lässt, sehr praktisch. zuhause aber, wenn ausgepackt und zusammengebaut ist, steht man vor dem problem, unmengen an karton in abfallgerechte grössen zu reissen und zu schnüren, dann abfallmarken drauf (wie viele genau bleibt immer etwas unklar – man hofft) und vollbepackt damit hinunter zum anderen müll. ein krampf.
mah am 20.09.06#2
ein typisches schweizer problem. als ich noch in köln gelebt habe, habe ich die schachteln nachts immer heimlich in einer unbeleuchteten ecke auf der neusser strasse abgestellt. am anderen morgen waren sie weg oder zerfetzt.
hab am 20.09.06#3
unsere tochter verarbeitet diese dinger immer zu irgendwelchen objekten, oder sie wohnt in diesen kartons über längere zeit. durch die verarbeitung lösen die sich im laufe der zeit auf und entsorgen sich selbst.
mar am 20.09.06#4
sie wohnt in diesen kartons über längere zeit. … sei greifen mir aus einer schachtel im zwanzigerbereich vor. auch irgendwie ein teil meiner kindheitserinnerung.
hab am 20.09.06#5
das war nicht meine absicht und ich will hier auch keine details verraten
mar am 20.09.06#6
bitte auch nichts über meine jahre als tiger.
käme bei einer Bearbeitung vielleicht dieses heraus:
Bei Kleinschreibung an Ikea denken / Idealstapelpacken / wundern, praktisch aber / zuhause Entpackung zerbauen / usw.
Es wurden hier also Indexat-Anleihen eingebaut und der Text etwas rhythmisiert. Natürlich liesse es sich über die Zeichensetzung (Semikolon oder Schräg-, Binde- oder Gedankenstrich o.ä.), Grosskleinschreibung uvm. diskutieren. Natürlich auch, wie und wie stark der Ursprungstext verschnitten wird, welche Referenzen beibehalten werden, ob noch eine weitere Verknappung stattfinden muss. Das alles ist noch nicht ganz klar …