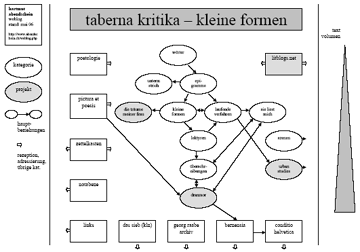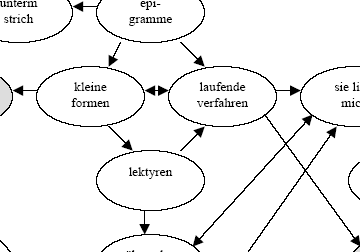Man sitzt wieder darüber. Und das betrifft immer auch die tatsächlichen (auch: konstruierten) Referenzen innerhalb der drei (s.o.) Textblöcke des Dranmor-Projektes. Man muss vielleicht von einem dreischichtigen Modell der Selbstrezeption und zitierung sprechen, oder von einem Schreiben*-und-Lesen Dritter Ordnung (im Falle slm). Hat sich der überschreibungen-Part noch ausgiebig an der Dranmor-Haupttextvorlage bedient, nimmt sich der slm-Text (in Ausschnitten) von den überschreibungen. Gemeint sind die klein dargestellten reflexiven Einlassungen des Ichs, was die Auseinandersetzung mit seiner imaginären Leserin/Lektorin angeht. Slm ist also, was das ganze parasitäre Textgefüge angeht, sicher einerseits derjenige Text, bei dem am meisten Unterbau vorhanden ist. Andererseits soll er ein Fliesstext werden, der noch am ehesten für sich selbst stehen kann …
*einem scheiternden schreiben und lesen. und ja, liebe h., vielleicht sage ich es nicht zum ersten mal, vielleicht aber jetzt zumindest am explizitesten: dranmor ist eine bartlebyade.