Ich war zunächst perplex, als ich den von Alban Nikolai Herbst heute zugänglich gemachten Text (herzlichen Dank!), das Vorspiel aus seinem Roman “Thetis” gelesen hatte. Tatsächlich sehe ich einige Parallelen. Beim ersten Eindruck die Frage: hatte ich unwissentlich plagiert (geht das?), liest sich doch ”die stadt kein zyklus” (dskz), zumindest die Thesen oder “bemerkungen”, wie ich sie nannte, wie ein Substrat des dort Vorgestellten. Ich aber will, daß Raum fürs Ungeheure bleibe, sagt eine Stimme dieses Textes. Und das hätte ich eigentlich für dskz auch gerne akklamiert.
Gemeinsamkeiten finden sich in der Tat sehr schnell. Naturgemäss auf dem Feld der mit einer Stadt assoziierten Begriffe und Wörter. Auf nächster Ebene mit ihrer grossflächigen Raumteilung (oben/unten, den Rändern, dem Zentrum etc.), ihrer Infrastruktur oder auch dem dort Hör- und Schmeckbaren, den Geräuschen und Gerüchen einer Stadt.
ANH entwirft in seinem Prolog ein vielstimmiges Bild. Es gibt ein Ich. Es gibt diverse Figuren (wie es anfangs scheint) und verschiedene Namen für die Stadt und ihre Stadtteile. Doch die Stadt erhält eine Vorzugsbenennung: Buenos Aires. Aber sie ist auch Berlin oder liegt in Afrika …
Sie ist wenigstens drei verschiedene Städte.
Und die Verdichtung dieser zu DER Stadt dieses Romans wird breit und sinnlich aus verschiedenen Perspektiven beschrieben bzw. wahrgenommen.
Eine Stadt muß Zeitsprünge machen. Zeit wie ein Ding, das sich durch die Prozesse hindurch bewahrt und doch nicht unverändert bleibt. Ganz so, wie ich täglich meine Haarfarbe wechsle: Wer in die Anderswelt tritt, verliert die Stetigkeit der Zeit.
Auffallend ist die Nicht-Linearität der Zeit in und der synästhetische Zugang zu jener Modellstadt. Überall flirrt es, überall könnte eine Parallelwelt (mindestens) sein. Das Gefühl eines Dufts knapp vor Rom.
Die Stadt in Thetis ist auch eine Allegorie und präsentiert sich beispielsweise als Frau. Die U-Bahn ist ihr Unterleib, an einer Stelle. An einer anderen reibt sie sich das Bindegewebe aus den Augen. Eine beeindruckende Exposition, die natürlich auf den ganzen Roman, die Trilogie, neugierig macht.
Es war natürlich nicht meine Absicht in dskz dieses Verfahren zu kopieren. Auch wenn hier vielleicht ebenfalls eine Verdichtung, hier in der Form einer Substratbildung, einer Summierung formelhafter Aussagen über eine, über DIE Stadt, stattfindet.
Aber: Man sucht vergeblich nach einem Erzähler. Die Aussagen über die Stadt sind teilweise paradox und hängen plakativ wie Schilder über dem Stadttor.
Es ist ein behauptetes Regelwerk von jemandem, der so selbstbewusst auftritt, als hätte er die Mechanismen der Stadt durchschaut. Es ist ein so paragraphenhafter Beschrieb eines Gebildes, als sollten die aufgestellten Behauptungen für immer gelten, als seien sie schon immer gültig gewesen.
dabei sind die gestalten die stadtteile der stadt. also bewegt sich die geographie um sie, und jene verlassen nicht ihren ort. also bewegt sich der raum und nicht seine körper.
(…)
die ordnung der stadt ist nicht diejenige der nichtstadt, auch land genannt. dort lagern die unverbrauchten zeiten und ungesprochenen sprachen der stadt.
Die Summierung scheint auf den ersten Blick beliebig. Tatsächlich ergibt sich aus dem Kontext der Serie (gemeint sind die seltsamen gestalten der Stadt) eine gewisse Symmetrie oder ein strukturierteres Bild. Natürlich treten die gestalten aber nur neben der so vorgegebenen Verfassung auf. Schaut man genau hin, könnten diese fünf (geistesgeschichtlichen) Epochen oder Phasen zugeordnet werden (ein bisschen muss daran noch gearbeitet werden …), und: ihr Auftreten, die Vorangegangene mit der Folgenden und vice versa, ist in jeweils bestimmter Weise verknüpft.
Was bei ANH auf die Frage Wer spricht? vielleicht geantwortet werden könnte: viele, alle beantwortetet sich bei dskz etwas anders. Ist im Thetis-Prolog der Ort des Sprechens oder Wahrnehmens (noch viel radikaler ist es im 2. Band der Trilogie) kaum zu greifen aufgrund der vielen Möglichkeiten, ist bei dskz kein Ort auszumachen, woher dieses Echo der Aussagen über die Stadt kommen könnte. Vielleicht kann man aber in beiden Fällen doch von einem ortlosen Ort und einem ortlosen Rauschen sprechen.
Im einen Fall sind es die Dinge und Personen der Stadt, deren Äusserungen und Wahrnehmungen sich zu einem mächtigen Rauschen überlappen. Im anderen sind es die Aussagen über die Stadt selbst, die das Stadtgeräusch bilden. Einem Rauschen von im Hintergrund vorgeblich wirkenden Gesetzlichkeiten, die allein die Stadt als Ort ausmachen sollen.
Das reizt mich auf, dich neu zu erfinden, heisst es an einer Stelle im Thetis-Prolog. Vielleicht könnte man im Falle von dskz von einem Zurückerfinden, einem Zurückfinden, von einem aufs knappste Zurückstutzen sprechen, oder, um die beiden Verfahren zu vergleichen: steht auf der einen Seite eine poetische und narrative Auffächerung DER Stadt, einer bis zur Unkenntlichkeit aufgeladenen Verzerrung (natürlich kann man VIELE Städte darin erkennen, aber mit der Preisgabe der Individualität, wie es bei Allegorien der Fall ist), muss vielleicht auf der anderen Seite von einer Eindampfung bis aufs Skelett gesprochen werden.
Soweit eine erste Annäherung. Ich freue mich auf weitere Hinweise …
Markus A. Hediger nahm und nimmt sich dskz vor und schreibt sich, wie er sagt, in dieses Aussagensystem hinein. Die Stadtstreicher, eine Leibes- und Liebesgeschichte um Mr. Woo und Kattarina, nimmt sich besagtes Skelett oder Regelwerk vor und bemalt die vakanten Räume der Stadt. dskz bekommt darin die Rolle eines strukturellen Rauschens, einer Rauschkulisse oder Leinwand zweier weiterer Akteure.
Ich bin gespannt, was Hediger daraus macht …
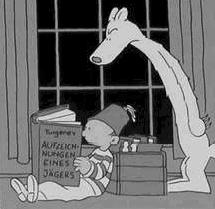 In einem Kinderbuch*, das ich genauso gut jedem Erwachsenen empfehlen möchte, findet sich eine Bildergeschichte mit durchaus literatur- theoretischem Anspruch.
In einem Kinderbuch*, das ich genauso gut jedem Erwachsenen empfehlen möchte, findet sich eine Bildergeschichte mit durchaus literatur- theoretischem Anspruch.