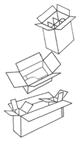 Oder das Magazin: eine grosse, idealtypische Truhe mit feinzeiligem Innenleben. Im Innenleben: Der Magaziner als Truhenverwalter. Verweser. Verrücker und Schliesser. Ein Wünschelrutengänger im Aderwerk aus Papier und Metall. Ein Schlüsselfaktor. Ein Ordner der Ordner. Logistiker schlechthin, wenn er ein konventioneller ist.
Oder das Magazin: eine grosse, idealtypische Truhe mit feinzeiligem Innenleben. Im Innenleben: Der Magaziner als Truhenverwalter. Verweser. Verrücker und Schliesser. Ein Wünschelrutengänger im Aderwerk aus Papier und Metall. Ein Schlüsselfaktor. Ein Ordner der Ordner. Logistiker schlechthin, wenn er ein konventioneller ist.
oder sein gegenspieler? einen unkonventionellen habe ich einmal phantasiert, auch wenn er nicht so getitelt wurde. einen wahren archivpoeten. umschreiber. hineinschreiber ins fleisch der geschichte. hat er etwas falsch gemacht? nicht viel mehr, als diejenigen, die den dingen einen ort, die dem dokument eine signatur verpassten. freispruch für ihn, in meinen augen.