(kursive briefe)
vielleicht muss man diesen ersten versuch einer bearbeitung auch nur ganz einfach “lektüre” nennen. (ich muss etwas luft heraus lassen. ein zu grosser druck ist da wohl kontraproduktiv). die lektüre, die ja den begriff der bearbeitung ohnehin trägt. veränderung findet statt, mit dem text, in dem text, ohne, dass dieser auf materialebene (zeichenebene) nur etwas oder überhaupt verändert wird, wie ich jetzt ganz deutlich feststelle: die zeit (der abstand) ist hier der ganz entscheidende faktor. (kleine einlassung die frage auf jenem kleinen zettel // weil es hier gerade passt: wie weit kann man sich von etwas (einem gegenstand) entfernen, um etwas gerade noch als gegenstand bezeichnen zu können? ich spüre, das wird hier noch eine grundsatzfrage, auch, was den titel angeht). dennoch ein paar eingriffe. ().
ein anderer faktor, ein planungsfaktor ist die zeit (die ja keine rolle spielen sollte, bei diesem produktionsprozess, es wohl doch aber tut: sie fällt zumindest auf und ein). also, festhalten: für die erste lektüre werden wohl pro kapitel in etwa drei wochen veranschlagt, gemessen am derzeitigen fortschreiten
an der stelle die verwegene idee, vielleicht später die kapitel nichtchronologisch anzuordnen. rückblenden, einschübe etc. (vielleicht aber doch lieber auf dem boden bleiben) … besondere vorkommnisse im berichtsraum?: titeländerungen („Bilder“>“Bilder, Berge”; “Ironie“>“Ironie als Frage der Perspektive”; “Diskurse“>“Kurse, kursive”; “Selbst ein Vielgereister“>“Ein Vielgereister”) … das gibt schon das gefühl, man habe etwas getan, auch wenn es ein eher zaghaftes feilen war, und die hoffnung, bald laufe es besser.
typischerweise (wie sieht so etwas aus? hediger wollte ein beispiel) ein umarbeiten einer sehr kurzen passage I,3 (Brief) …
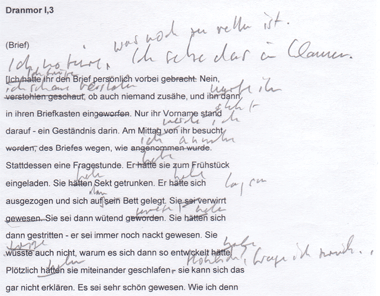
daraus wurde dann:
>>
(Brief)
Ich notiere, was noch zu retten ist. Klammere das. [Ich bringe ihr den Brief persönlich vorbei. Nein, ich schaue verstohlen, ob auch niemand zusähe, und werfe ihn dann in ihren Briefkasten ein. Nur ihr Vorname steht darauf darin: ein Geständnis. Am späten Mittag werde ich von ihr besucht, des Briefes wegen, wie ich annehme. Stattdessen eine Offenbarungsstunde. Er habe sie zum Frühstück eingeladen. Sie haben Sekt getrunken. Er habe sich ausgezogen und sich dann auf sein Bett gelegt. Sie, sehr verwirrt, dann aber wütend geworden. Sie haben sich dann gestritten er, immer noch nackt. Sie wisse auch nicht, warum es sich dann so entwickelt habe. Plötzlich haben sie miteinander geschlafen. Plötzlich, frage ich? Sie kann sich das gar nicht erklären. Es sei aber sehr schön gewesen. Wie ich denn darüber denke. Wie ich denke, wie sie sich denn verhalten solle. Dann: sie müsse damit ins klare kommen, sodass es besser wäre, wenn wir uns eine Weile nicht sähen.
Nein, sie habe noch nicht in ihren Briefkasten geschaut – sie müsse jetzt gehen. Die Eile. Die Fahrt mit dem Fahrrad zu ihrer Wohnung, um dort vor ihr anzukommen. Um den Brief wieder herauszufingern – aus dem engen Briefkastenschlitz. Das Sichdavonstehlen, mit hochrotem Kopf und zerkratzten Händen.“>
Mehr ist da nicht. Es ist albern und nicht von Bedeutung. Ich streiche es durch.
<<
hier fällt auf, dass schreibpraktiken der überschreibungentexte immer öfter in den haupttext drängen (i.d.f. die streichung). ich kann noch nicht beurteilen, wie gesund das ist …
CONTAINER: Die Kursivsetzung (nur bei Dm-Zitaten?, oder auch bei Erzählerreflexionen?, nicht aber bei späteren Wahrnehmungsströmen! bspw: I,2a). Keine zu berücksichtigenden Kommentare für diesen Abschnitt. Plötzliche Sätze von ihr: “Etwas sehr kommissarisch, alles”. “Hast du auch einen Schneckentext geschrieben?” – nein, aber: Gute Idee!. “Eine überraschende OK-Passage. Überraschend, weil einigermassen OK”. Ein Gesetz lautete, und: ein Gesetz läutete. Läuternde Gesetze. Laute Gesetze.. Dann, zu überlegen: “ICH ist nur die Blackbox alter Zeichen”. Weiter: “Den Erzähler streichen lassen. Den gestrichenen Text stehen lassen. Den Erzähler (so) streichen”.
(zu dranmor I,1c-I,3a; übersicht überschreibungen)