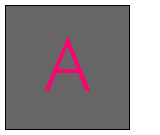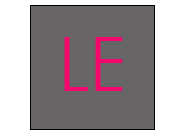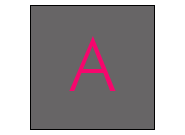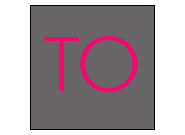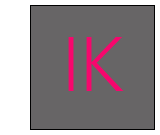Aléas Ich
Zur Leseprobe.
“Dabei ist es vielleicht gerade das Wissen darum, „was eine Niederlage ist“, das seinen Romanen diesen wunderbar melancholischen Einschlag gibt—für den Aléa Torik jetzt gefeiert wird”
Britta Heidemann in der WAZ.
——–
“Es ist ein richtiges Buch, man kann es in der Hand halten, umblättern. Und doch wohnt man, während man es liest, seiner Entstehung bei – die Autorin ist Protagonistin, das Erfinden ist Plot. „Aléas Ich“ ist eine spielerische und zugleich tiefernste Auseinandersetzung mit Identität und Wahrnehmung. Torik verwendet Sprache mit nahezu juristischer Genauigkeit.”
Elisabeth Dietz im Büchermagazin.
———
“Der Autor verfügt über Fantasie und einen Respekt einflößenden Intellekt. Die Lektüre auch des neuen Romans ist ein Genuss. [ ... ] Mit der Anonymität im Netz scheint Aléa Torik nicht nur gute Erfahrungen gemacht zu haben; sie spricht von virtueller Hatz, von Menschen, „die erniedrigen und zerstören wollen“, von einem „Ort der totalen Asozialität“, gar vom „totalen Grauen“. Daneben denkt das Autoren- Ich ebenso melancholisch wie scharfsinnig über Einsamkeit nach, über den Begriff Heimat und das Leben in einer deutschen Großstadt”
Bettina Ruczynski inder Sächsischen Zeitung, hier.
———
„Ja, “Das Geräusch des Werdens” ist ein ganz besonders Buch: sinnlich, viral, vital, melancholisch. Aber insbesondere aus Gründen der Brüchigkeit und der Differenzerzeugung halte ich den zweiten Roman für ebenso gut. Auch deshalb, weil er die harmonischen Tendenzen und das doch eher Freundliche des ersten Werkes durchkreuzt. “Aléas Ich” ist sehr viel unheimlicher und spielt mit dem Düsteren, insbesondere in der Figur der Olga und ihrer Wandlung tritt das zutage. Da wo Olga fast bösartige Züge annimmt.“
Bersarin auf Aisthesis, hier.
——-
Ein Film bei Katrin Bauerfeind, hier.
——-
“Was diesen Roman auszeichnet: er sucht jenen Ort, den es nicht gibt, der sich in der Literatur und zugleich im Akt des Lesens selbst konstituiert. Dies macht andere Literatur ebenso, denn Literatur bedeutet die Welt zu poetisieren (auf welche Weise auch immer.) Hier aber gerät das Ich selbst in den Fokus der Poetik. Es ist „Aléas Ich“ ein Roman der Phantasien, er spielt, spiegelt und inszeniert den Möglichkeitssinn. Denn es könnte alles ja auch ganz anders sein: jener „außerordentlich wichtige Moment“, der zu dieser einen und nur zu der einen Situation oder Szene führt: sei das ein Abend auf einer Party im September in einer schwülwarmen Spätsommernacht, wo zwei Menschen in einer Unterhaltung beieinander stehen, sich für eine Spanne von Zeit, die sich nicht messen läßt, zwei Blicke treffen, sei es der Moment, als sich Aléas Eltern Matthias und Magdalena in Constanza kennenlernten. Wir stellen uns diesen einzigen, einzigartigen Moment, diesen Augenblick als Kairos in unserer Phantasie vor, passen ihn in unsere Imaginationsmöglichkeiten ein, und so schreibt Aléa Torik, „als läge er nicht vollkommen in der Vergangenheit, sondern müsse immer wieder aufs Neue sein Wirklichkeit und Gegenwärtigkeit beweisen …“ So steht es im Roman auf einer Seite, die als Eintrag aus dem Blog „Aleatorik“ konzipiert ist. Im Messianischen Licht sind alle Dinge an ihrem Platz und doch ganz anders.”
Bersarin auf Aisthesis, hier.
——–
“Aléa stammt aus dem rumänischen Dorf Marginime, an dessen Geschichten – vor allem den nur halb erzählten – sich ihre kindliche Fantasie entzündete. Damals erfasste sie eine Sprachleidenschaft, die sich auf verhängnisvolle Weise mit Angst und Ungewissheit verknüpfte.Im schönsten der vielen eingestreuten Blog-Einträge verbindet sich die Stimme des Vaters, der ihr im Garten Tolstoi vorliest, mit dem Bild eines durch den Zaun linsenden Nachbarn, der sich später als Spitzel mit Decknamen Tolstoi erweist. Marginime ist im Roman ein (Alb-)Traum-Ort, an dem jener Sehnsuchtsfluss entspringt, der Aléa zuerst nach Bukarest, dann nach Berlin spülte – verfolgt von Doppelgängern und Beobachtern, die halb Spitzel, halb Dämonen ihres Unbewussten sind. Sie treiben sie von Seite zu Seite schneller auf jenen magischen Punkt zu, „wo die Welt sich verknotet, verdichtet und vielleicht verliert“. Immer öfter reißt in der zweiten, Romanhälfte die Erzähloberfläche auf, unter der sich aber nichts als Chaos und Verzweiflung zeigen: Die Figuren beklagen sich über Ungereimtheiten der Geschichte und überzogene Motive. Aber vielleicht bewegen wir uns ja durch einen Fiebertraum von Aléa, in dem sich die Erzählfäden und ihr eigenes Ich aufzulösen beginnen, während ihre Mutter vergeblich versucht, sie zu wecken. Claus Heck verwickelt den Leser in ein glühendes Spiel mit Zeitebenen. Er lässt ihn an der Entstehung des Romans teilhaben, den er gerade liest, führt ihm den Eigensinn der Figuren anhand der Verbformen des Futur II vor und erzählt doch eine überzeugende Geschichte. Sie öffnet uns die Augen für die tiefgründige Schönheit der Zufälle.”
Nicole Henneberg im Tagesspiegel, hier.
——–
“Der zweite Roman von Aléa Torik besticht durch seine Vielfältigkeit. Es ist ein außerordentliches Buch, voller spannender Gegensätze auf der Höhe der Zeit, und doch fest verwurzelt in der Vergangenheit. … Eine nähere Bestimmung des Romans fällt schwer, denn er ist mal filigrane Liebesgeschichte, mal eloquente Gegenwartsanalyse, mal zärtliche Erinnerung und mal theoretische Abhandlung. … Die präzise Erzählweise wird mit einer merkwürdigen Spannung schattiert, die in mehreren leicht nebulösen Plots dennoch gekonnt vorangetrieben wird, und einige überraschende Wendungen bereithält. Wer die eine oder andere langatmige Episode übersteht, wird reich belohnt, denn Torik hat originelle Ideen und Vorstellungen en masse. … Manches ist gar schlichtweg falsch, doch gesagt mit einer solchen Bestimmtheit, dass es der Leser nach kurzer Empörung glaubt. Und das ist wiederum ein untrügliches Zeichen für eine gute Feder! Aléa Torik hat die Beobachtungsgabe einer Dichterin und die Beschreibungsfähigkeit einer Wissenschaftlerin. Das muss ja bei derartiger Brillanz schon mal ans Neunmalkluge grenzen”
Moritz Holler im WDR 3, hier.
———-
„Die Autorin versteht es meisterlich mit der Glaubwürdigkeit ihres Werkes zu spielen, den Leser immer wieder an die Grenzen des Nachvollziehbaren zu ziehen, um dann die Künstlichkeit des Romans zu enthüllen, nur um später erneut Zweifel aufkommen zu lassen, ob dieses Buch, welches man in Händen hält, wirklich reines Produkt der Fantasie sein kann. Genres werden bei dieser Arbeit respektlos über den Haufen geschossen, nicht lange können Autobiografie, Fiktion, literaturtheoretischer Beitrag, Geschichte und dergleichen als Kategorien existieren, schnell finden sie ihr Ende und die gegenseitige Durchdringung in der wortgewandten Konstruktion Toriks.“
Sebastian Riemann auf der Belletristik-Coach, hier.
——–
“Die erfundenen Biografien, wenn man das mal so kalt durchleuchten mag, sind unspektakulär, aber warm erzählt: Man kommt den scheinbaren Figuren sehr nahe. Die Enttäuschung, die hier spoilerhaft vorweggenommen sei, dass Aléa Torik nur eine Erfindung ist, kann schon groß sein. Andererseits spricht gerade auch das für das Buch: Torik gelingt es, eine weibliche Perspektive durchzuerzählen. Späterhin wird sie natürlich aufgelöst, oder zumindest konterkariert.”
René Hamann in der Taz, hier.
———–
“Wie viel muss man über eine Autorin wissen, bevor man ihr Werk in den Himmel lobt? Muss man beispielsweise, um Aléas Ich, den zweiten Roman von Aléa Torik, für absolut großartig zu halten, wissen, dass es sich bei der Autorin nicht um eine 30-jährige Rumänin handelt …?”
Sarah Schaschek in DIE ZEIT, hier.
——–
“Toriks Bücher sind – bis man ihr das Gegenteil beweist – weiblich; genau das scheint mir ihre Größe zu sein.”
Alban -Nikolai Herbst, hier
——–
“Vor allem aber schildert der Roman sein eigenes Entstehen: Im Gegensatz zu den großen schriftstellerischen Initiationsgeschichten der Weltliteratur, in denen der Erzähler am Ende des Textes in der Lage ist, diesen niederzuschreiben – man denke etwa an Marcel Proust – ist in „Aléas Ich“ Erleben und Erzählen jedoch als eine Bewegung konzipiert. So führt der Text immer wieder auf die Universitätsbibliothek als zentraler Handlungsort zurück, an dem Aléa Torik nicht nur ihren Roman verfasst und somit Schreiben und Leben realiter zusammenfallen, sondern der als Gebäude für Texte auch auf einen der poetologischen Bildvergleiche des Romans verweist: Aufgrund ihrer Leerstellen werden literarische Texte als Architektur imaginiert, die gleichfalls Hohlräume entwirft. Aléa schreibt mit „Aléas Ich“ an dem Gebäude, in dem sie schreibt. Wenn Aléa also von sich behauptet, „nach literarischen Gesichtspunkten“ zu leben, so ist das ganz wörtlich zu verstehen: Imagination und Realität sind eins, sie erschafft sich selbst im Erzählen. [...] Trotz aller Selbstreflexivität handelt es sich bei diesem Roman jedoch keinesfalls um eine blutleere Konstruktion. Aléa Torik konzentriert sich auf das Wesentliche: Ohne ihre oder die Zeit des Lesers an detailrealistische Beschreibungen zu verschwenden, evoziert sie dennoch Bilder, die alles auf den Punkt bringen: Die Klarheit, die nur die Liebe auf den ersten Blick bringt, die Zärtlichkeit für die Großeltern, trotz und weil man in verschiedenen Welten lebt, das Glück und die Millisekunden, die ihm vorausgehen und die ihm folgen. Das könnte schnell in Kitsch kippen, tut es aber nicht. Dafür sorgen neben der permanenten Selbstironisierung als Fiktion und der schlichten Sprache vor allem das Umschlagen in absurd-komische Gedankenschrauben. [...] Die fiktive Autoridentität ist zentral, denn sie vollendet die Idee der Identitätskonstruktion durch Fiktion; der reale Roman wird zur deutlichsten Manifestation seiner selbst, indem Textwelt und Romantext ineinander greifen. Ob die Literatur Metapher für das Leben oder das Leben Metapher für die Literatur ist, bleibt in der Schwebe und darin liegt der Zauber des Romans. “
Svenja Frank, bei Literaturkritik.de, hier.
——–
„Es ist eine berechtigte Kritik an metafiktionalen Texten mit allerlei Querverweisen und Selbstbezüglichkeiten, dass sie zwar ein großer Spaß für LiteraturwissenschaftlerInnen mit einer Neigung zur Postmoderne sind, für die meisten anderen LeserInnen aber oft schlichtweg eine nervenzehrende Lektüre mit einem Lesevergnügen, das gegen Null tendiert. Nicht so aber Aléas Ich – jenseits aller Metaebenen ist dieses Buch ein zugänglicher, rührender, aber vor allem urkomischer Text über eine Kindheit in Rumänien, das Leben in Berlin, das Erwachsenwerden, die Liebe und das Internet. … Wer also enttäuscht ist von der Tatsache, dass Aléas Ich in »Wirklichkeit« nicht von einer jungen Frau Ende zwanzig geschrieben wurde, sondern von einem männlichen Mittvierziger, muss nicht beunruhigt sein. Er durchläuft nur einen ganz natürlichen Reifeprozess-“
Christian Dinger, bei LitLog, hier.
——–
Nicht über den Roman, sondern über die Sache selbt: “Ein Autor erschafft Fiktionen. Dass er die Realität dabei in größerem oder kleineren Maße einfließen lässt, ist klar.Was für ihn aber »Authentizität« ausmacht, so meine These, ist weniger der Anteil an Realität im Erzählten, als vielmehr der Anteil des Autors in seinem Text in Form seiner Ideologie, seiner Weltanschauung oder wie auch immer man den Impetus nennen will, der ihn zum Schreiben antreibt.”
Flo, hier.
——–
“Romanul a fost bine primit de critica germana, acestia asteptand sa vada renascand o noua Herta Mueller.”
Ciprian Păun in Clujul Liber, hier.
——–
„Ich deutete es ja schon an; es war ein wiedererkennen im Text. Ein Spiegeln, ein Zurückwerfen auf Erlebtes, Erdachtes, auf eigene Befindlichkeiten. Ihr Text las sich, wie die Zusammenfassung und Verdichtung eigener gesammelter, krauser verwirrender Erfahrungen der letzten Jahre, der letzten Zeit. Lese- und Denkerfahrungen, Leserichtungen und Kommunikationshaltungen. Die Leseerfahrung ihres zweiten Buches war für mich sehr erschreckend, weil sie so genau und nah dran war an der Selbsterfahrung. … Mir scheint, als hat Ihr Buch eine Strömung im Zeitgeist getroffen und somit auch mich. Und wie das so ist, mit den unliebsamen “Wahrheiten” oder den unbewussten Strömungen, sie regen auf, sie regen an, sie erregen die Gemüter. So wie das eben immer ist, wenn es ans Eingemachte geht … Achtung das Lesen dieses Buches kann bei sensiblen Menschen zu Realitätsverlust, Wahnvorstellungen bis hin zur Digitalparanoia führen!”
Frau Wunder, hier.
——–
Aléa Torik im Gespräch mit Katharina Bendixen von der Literaturzeitschrift poet, hier.
——–
„Wow. Vom erzählerischen Konzept, der Idee, der Sprache und dem Aufbau das interessanteste Buch des Jahres und überhaupt der letzten Zeit.“
Katja bei aboutsomething, hier.
——–
„Dieser Roman zog mich magisch in seinen Bann. Ich bemerkte wie sehr Blog und Roman zusammengehören und verlor mich in der Sprache, der Konstruktion, den Figuren, Aléas Gedanken und Erleben, ihren Reflektionen über ihr Leben, das Schreiben ihrer Doktorarbeit d.h. ihres Romans und verlor mich und verlor mich und verlor mich … Ich bin sehr beeindruckt von der literarischen Qualität dieses Textes, der nicht einfach nur eine Geschichte erzählt, sondern kritische und wichtige Fragen an die Gesellschaft stellt und den Leser radikal mit der Fiktionalität und Konstruktion konfrontiert, ja ihn fordert. Es bleibt das Gefühl hier etwas ganz Großartiges gelesen zu haben“. Und die Co-Autorin dieses Blogs, die den Roman ebenfalls gelesen hat, ergänzt diese Einschätzung um folgende Worte: „eine ganz bemerkenswerte und herausragende Lektüre. … Aléas Ich ist ein Buch, das sich in mir festgehakt hat und nun ständig in meinen Gedanken kreist, um mich irgendwie zu beeinflussen. Gruselig – und ein ganz einmaliges Erlebnis. … Ganz ganz großartig. Das ist ein Roman, von dem ich wirklich behaupten kann, er habe mich verändert, weil er auf die Grundfrage abzielt: Wer bin ich?“ hier.
——–
„Diese Aspekte sind für manche/n, die auf eine konventionelle bzw. konservative Weise mit Literatur sich befassen, nur schwer vermittelbar: Daß nämlich empirisches Ich, erzählendes Ich, Autor, erzähltes Ich, Textfiguren nicht verschiedenerlei sein müssen und durch soziale Konvention getrennt, sondern einem bedingenden Diskurs unterliegen, der ein literarisches Feld erst anordnet und so etwas wie den Begriff des bürgerlichen Romans samt seinen Hierarchien und Figurenanordnungen, seinen Perspektiven und Wirklichkeitsweisen erst möglich macht; daß dieses Spiel der Identitäten, Personen, Figuren zuweilen die Grenze zur Realität überschreitet“
Bersarin zu dem obigen Interview, hier.
——-
“Bei Aléa Torik paart sich hohe schriftstellerische Intelligenz mit einer lebenshungrigen und trotzdem ganz zarten Poesie zu faszinierender Sprache, die mich immer wieder auf ihren Blog zieht, wo ich seit Jahren herumstromere und begierig ihre Geschichten einsauge. Vielleicht nennt man so etwas ‘Fan sein’“.
Diana Dressler, in den unendlichen Weiten von Facebook.
————–
“One of the strangest novels of 2013 was Aléas Ich …”
Stephen M. Brockmann in der Encyclopädia Britannica, hier.
————–
„Als Gegenwartsanalyse mit besonderem Fokus auf das Internet verweisen die ineinander verschachtelten Wirklichkeitsebenen somit auch auf eine radikal konstruktivistische Weltsicht, die keine Unterscheidung zwischen Realität und Repräsentation mehr zulässt. So scheint es nur schlüssig, dass der zeitliche Rahmen für das Romangeschehens durch den 11. September markiert wird, als Metapher der Virtualisierung von Wirklichkeit im 21. Jahrhundert.“
Svenja Frank, im Kritischen Lexikon der deutschen Gegenwartsliteratur, hier.
————–
“Aber warum ärgerte ich mich überhaupt? Das Buch ist verteufelt klug, es ist kühl erzählt, hat eine klare Prosa. Einen Teil des Ärgers konnte ich leicht verstehen, er handelte eher von mir, denn, verdammt nochmal, ein paar von den Ideen da drin, die hätte ich morgen oder übermorgen auch gehabt. Und dann hätt ich das geschrieben.”
Jim Knopf, auf Bausparbuddajägerzaun, hier.
————–