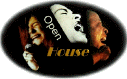 ______________________
______________________
Für immer hier
und da
...
Bob Dylan will nicht an vergangene Zeiten erinnern. Sein enormes Repertoire ist ihm
vielmehr das Material, das er so lange bearbeitet, verändert und uminterpretiert,
bis es wieder das ausdrückt, was er hier und heute fühlt.
_______________________________________
Also dieses Mal Bad Reichenhall. Und dann, später, hat er bereits Udine hinter sich gelassen und zieht nach La Spezia, dann nach Pescara, Anzio... Bob Dylan reist, macht alle paar Tage Halt. In Orten, die nichts bedeuten, packt er seine Gitarre aus, geht auf die Bühne, reist durch seine Lieder, geht weiter. Keine Anstrengungen macht der 60-Jährige dabei, um schön zu klingen, gar tiefsinnig. Er erzählt und wir hören zu. Und es hat den Anschein, als wäre ihm beides gleichgültig. Dabei gibt es keinen triftigen Anlass für ihn, sich auf den Weg zu machen. Er ist reich. Er ist berühmt. Er wird - in Jahren gemessen - alt. Genug Gründe, an Ort und Stelle zu bleiben. Doch diese Gründe haben keine Bedeutung, auch wenn die Motive der Fahrt irrational sind.
Dylan singt ununterbrochen, weil er so einem übermächtigen Erbe, einer zu Orden und Auszeichnungen gewordenen Verehrung, entfliehen kann. Nichts ist, wie es ist, ließ er schon bei den zahlreichen Wandlungen im Lauf seiner 40-jährigen Karriere erahnen. Nun schenkt er Gewissheit. Er taucht da und dort auf wie die mythologische Gestalt des Great American Whale. Er bläst. Und alle Blicke richten sich auf ihn. Hinfahren. Wieder eine Chance, ihm nahe zu kommen, mit ihm vielleicht endlich fertig zu werden. Doch zu fassen kriegt ihn niemand.
Dylan unterwirft sich nicht den Reglementierungen und dem rationalen Verhalten der Pop-Zivilisation. Für ihn existieren keine festgelegten Ablaufpläne. Er folgt einem verwirrenden, bestenfalls geographisch nachvollziehbaren (Tour-) Plan, der ihn kreuz und quer durch das Land führt. Wie ein Landstreicher mit Gitarre, ein Vagabund voller Melodien streift er herum. Ortlos lebt er. Heimat ist ihm sein Werk, das er wild durcheinander wirbelt, neu definiert, umkrempelt, unterläuft. Er sägt an Hymnen, Liebesliedern, poetischen Glanzstücken, die ihm längst entrissen sind, die aufgenommen wurden in das große Liederbuch der Welt. Und er sägt und nörgelt, dreht und verfremdet sie so lange, bis sie wieder ihm allein gehören. Nomadentum in seiner Ausprägung als zerstörende Macht, die zivilisatorische Normen, zum allgemeinen Konsens gewordene Gesetzmäßigkeiten, aus Klischees geborene Erwartungshaltungen zertrümmert, demonstriert Dylan. Freilich mögen auch Streunen und Herumziehen Alltag werden. Sie bergen allerdings Abenteuer und Neugier, halten die Augen offen für einen befreienden Blick vor allem auf das eigene Tun.
Wer Dylan auf seiner seit Ende der 80er Jahre laufenden Never Ending Tour sieht, wird Kiebitz einer öffentlichen Verhandlung des eigenen Werks. Als Hinrichtung und Freispruch kann sie enden. Hier liefert sich einer der Gunst oder der Verdammnis des Augenblicks aus – und zwar einer, dem schon vor 40 Jahren die Ewigkeit gehörte. Die Schonungslosigkeit, mit der Dylan die rastlose Fortschreibung eines ewigen Materials betreibt, raubt den Atem. Ausgewählt - so macht es den Anschein - wird nach Lust und Laune, nach dem Wohlbefinden beim Aufstehen, nach dem ersten Blick aus irgendeinem fremden Hotelzimmer. Wohin wir heute Abend aufbrechen, entscheiden die Eindrücke des Tages.
Er schöpft dabei aus dem vielfältigsten und einflussreichsten Werk eines einzelnen Künstlers in der Rockgeschichte. Aus rund 600 Songs, die nie in langer Studioarbeit eingespielt, sondern meist hingeworfen, als Vorläufigkeit aufgenommen wurden, kann er sich bedienen. Es erübrigt sich die Frage nach einer aufschlüsselbaren Struktur des Programms für einen einzigen Abend. Wer beispielsweise im Sommer 2001 im Hof der Alten Saline Reichenhall dem nasskalten Wetter trotze, erlebte einen solchen Entwurf live.
. . . also dieses Mal Bad Reichenhall. Die Songs selbst halten dann ebenso wenig still, wie es Dylan tut. Ruhelose Neuinterpretierungen raunzt er hin. Dylanologen spornt das zu interpretatorischen und vor allem statistischen Hochleistungen an. Alles vergeblich. Vielleicht noch tabellarisch aufzuzeichnen, sonst aber jeder Deutung entzogen, spielt Dylan einfach drauf los. Mit drei Ausnahmen entstanden die Songs dieses Abends vor 1973 und sind doch nicht alt, nicht einmal tausendfach gehörte Zugaben wie Like A Rolling Stone, Knockin' On Heavens Door oder die Mutter aller Dylan-Songs Blowin' In The Wind haben Patina angelegt.
Klassisch programmatisch eröffnet er mit einem Traditional: Hallelujah,
I'm Ready To Go, in dem es heißt: "On a highway heading down below/I let my savior in and he saved my soul from sin". Hier fomuliert er - mit einem Griff in die Schatztruhe musikalischer Tradition Nordamerikas - die Befreiung nicht nur von allzu menschlicher Last, sondern von der Vereinnahmung als Pop-Gottheit, als einflussreich(st)er (Pop-)Künstler. Seinen Weg lässt er seit langem von diesen Kategorien wegführen. Er verweigert sich jeder Erwartungshaltung. Irgendwann
an ein paar freien Tagen entstand das Album "Love an Theft" (erschienen im September 2001). Von irgendwann und irgendwo scheinen auch die Songs zu kommen. Lakonisch, unsentimental, geradezu mit gespenstischer Ortlosigkeit erzählt die Stimme. Einem fahrenden Sänger gehöre ich, sagt sie. Einem, der wie ein Straßenmusiker im Anzug eines Südstaatenpredigers daherkommt. Nach To Ramona eine atemberaubend nebensächlich hingeworfene Version von Desolation Row. Dann ein zähes Maggie's Farm, ein uferloses Million Miles . . . Most Likley You Go Your Way (And I'll Go Mine); It's All Over Now, Baby Blue; A Hard Rain's A-Gonna Fall; Don't Think Twice, It's All Right; Tombstone Blues;
das seltene You're A Big Girl; Drifter's Escape; Rainy Day Woman #12 & #35. In jede Nummer wird von Dylan und seinen vier Begleitern nach ein paar Stimm-Zupfern an der Gitarre hineingerumpelt.Daraus wachsen zur scharfen, nasalen Stimme in weiter Ferne klingende, krächzende Blues-Variationen oder polternde Country-Rocker oder zu breiten Flüssen verschleppte einstmalige Stampfer. Das Erkennen wird schwer gemacht. Die Neuformung dient eben auch der Verschleierung, dem Verstecken. Hier bekommt niemand einen Hit, wie er ihn seit ungefähr tausend Jahren kennt, auch wenn zumindest zwei Drittel der Songs des Abends zum pophistorischen Allgemeingut zu zählen sind. Hier bekommt jeder raue, authentische Jetzt-und-nur-jetzt-Versionen von Liedern, für die Dylan entschieden hat, dass sie sich ständig bewegen müssen, um am Leben zu bleiben, eben weil sie -wie der Schöpfer selbst - zum pophistorisch verallgemeinerten Gut zu zählen sind.
Dylan agiert bei seiner Reise ohne Netz. Dieses Risiko birgt die Gefahr von Fehlern, von Längen, von Nachlässigkeiten. Und es birgt die Verstörung jener, die der Verwandlung seines Werkes nicht folgen (wollen). Weil er sich der Gefahr der täglichen Erneuerung, der ständigen Verfremdung aussetzt, lässt er aber Sternstunden passieren. Wie etwa die Reichenhaller Versionen von Desolation Row und ein knallhartes All Along The Watchtower, ein in die Nacht fliegendes Don't Think Twice, It's All Right und eine dreckig verschlafenes Drifter's Escape. In diesen Momenten, wenn er sich gehen lässt, wenn er wirkt wie ein Reisender, für den Start und Ziel ihre Bedeutung verloren haben, der stattdessen die Bewegung als eigentlichen Ankunftsort verstanden hat, dann, wenn Dylan ganz bei sich ist, ist er auch bei uns. Bei jedem Einzelnen, für jeden Einzelnen singt er - wo auch immer und wie groß auch immer die Menge sein mag, der er entgegenblickt. Dann spricht er nur zu mir. Dann formuliert er Sätze nur für mich. Ohne dass sich eine übermächtige Erinnerung an legendäre Alben, an weltbewegende Wichtigkeit, an hundertausend biografische Details bemerkbar macht, dringt er dann unvergesslich tief ein. Und in diesen Augenblicken steht fest: Er wird uns nie verlassen.
Bernhard Flieher
(Bernhard Flieher ist Redakteur
bei den Salzburger Nachrichten)
=== Zurück zur Übersicht ===