_____________________
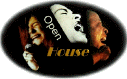 _______________________
_______________________
_____________________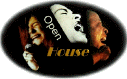 _______________________
_______________________
Letzte Nacht im Rockgarten
Erinnerungen an Soundgarden - eine der
letzten "echten" Rock ‘n’ Roller
____________________________________
...
Der Verkäufer im "Sub-Pop"-Shop versprach "einen Abend, der sich lohnt". Das kleine gelbschwarze Plakat an der Tür des "Crocodile Cafe" kündigte zwei längst dem Gedächtnis entschwundene Bands und Hater an. Im "Moe" - nicht weniger legendär als das "Crocodile" - würden sie spielen.
Es ist Ende Februar 1994. Die Tage sind zu dieser Jahreszeit in Seattle sehr kurz. An der größten Stadt Washingtons sind die kurz zuvor verliehenen Grammys für Soundgarden, "Seattles own", wie ein Provinzblatt schreibt, recht spurlos vorbeigegangen. Hier wird um lokale Helden wenig Aufsehen gemacht. Zuviele sind es geworden. Nirvana, Pearl Jam oder Alice in Chains. Im Rampenlicht einer Bühne voller blasierter Stars wollen die Seattler "ihre" Bands nicht sehen. Die gehören auf die Bühne des "Rockcandy"oder eben des "Moe". Dort ist die Bühne mittelmäßig beleuchtet. 200 Besucher warten. Hater sind zur Hälfte Soundgarden. Wenige Tage nach der Verleihung des weltweit wichtigsten Musikpreises begleiten Bassist Ben Shepard und Schlagzeuger Matt Cameron eine Handvoll unbekannter Freunde durch eine Nacht voll hartem Rock. "Wir tun das immer wieder. Es macht Spaß, drauflos zu spielen", erklären sie nach dem Konzert an der Bar.Wie fast alle Bands im Nordwesten der USA wurden Soundgarden über das mittlerweile zur Legende gewordene, unabhängige Plattenlabel "Sub Pop" groß. Als kaum jemand ahnte, dass im von Michael Jackson und Whitney Housten verpopten Post-Reagan-Amerika doch noch musikalische Rebellion geübt werden könnte, schrieben sie für einen Sampler 1988 ihrem Label und ihrer Heimatstadt die Hymne "Sub Pop Rock City". Zwei Jahre später war Seattle für kurze Zeit "World Rock City" und Soundgarden waren weltberühmt.
Die Nacht ist die beste Zeit, um in den 1984 gegründeten Soundgarden zu verschwinden. Mächtig wie die Dunkelheit fallen die Songs über den Zuhörer her. Undurchdringlich wie schwer dahinziehende Wolken den Mond verhüllen, breiten sich die Gitarren über den Raum, der im treibenden Rhythmus bebt. Die Stimme von Chris Cornell zerreißt das Dunkel und öffnet die Ohren für ein Kraftwerk voller Rock, von dem man sich wünscht, es möge ewig Musik machen.
Damit ist es vorbei. Über detaillierte Gründe für die Trennung schweigt man sich aus. "Wir machten einfach weiter und weiter und sahen zu, wie die Dinge wuchsen. Und hatten immer unseren Spaß an der Sache", sagt Gitarrist Kim Thayil. Jetzt machen sie "eben woanders weiter".
Im Gegensatz zu Nirvana, mit denen sie so gern in einem Atemzug genannt werden (einziger Grund kann sein, dass beide Bands aus Seattle stammen), wurden Soundgarden nicht zu Opfern einer Jugendzimmer-Kultur, die sie bedingungslos auffraß und in eine letale Katastrophe schickte. Soundgarden wählten den Abschiedstermin selbst.
Mit dem vierten Album "Badmotorfinger" (1991) waren sie zur Stadion-Band geworden, spielten große Festivals mit Guns'n'Roses oder Metallica. Für die Medienmaschinerie blieben sie zu ihrem kreativen Glück sperrig. Bevor auch nur ein Song MTV-Dauerairplay bekommen konnte (das balladenhafte "Black Hole Sun" war aufgrund seiner MTV-kompatiblen Video-Bildsprache die Ausnahme), krachte ein heftiges Schlagzeug in die schöne Melodie oder zerfetzte ein aufwiegelnder Refrain-Sturm die trügerische Ruhe des vermeintlichen Mainstreams.
Die Poster der Weggefährten fielen immer größer aus als die von Soundgarden. Sie blieben stets schwierig, schafften es trotz Einbindung ins große Business - schon 1988 unterschrieben sie als erste Seattle-Band einen Vertrag bei einem Major-Label (bei A&M) - einen eigenen Weg beizubehalten. "Wir wollten immer so unkalkuliert wie möglich klingen", sagt Cornell. Vergleichbar am besten mit Led Zeppelin, die sich ebenfalls jede Richtung offen hielten und deshalb immer beim Rock 'n' Roll gelandet sind. Tief drinnen blieben Cornell und Co. immer "independent".Hinterbliebene im "Sub-Pop"-Lager meinten, dass "die immer schon berühmt werden wollten". Sie haben wahrscheinlich recht. "Wir haben damals mit vollem Bewußtsein unterschrieben", bereut Cornell den Schritt zu einer großen Firma nicht. Er wollte "nie Märtyrer einer Generation" werden, sondern seine Musik unter die Leute bringen. "Als Band änderst du höchstens, dass die Leute etwas anderes anziehen. Es sind doch nur die alten Lieder von Angst, Liebe und Depression, die wir singen." Dass der Weg aus dem unabhängigen Plattenstudio direkt auf riesige Bühnen, in riesigen Stadien vor einer ebenso riesigen Menschenmenge führen würde, träumte er bestenfalls.
Der Sprung zu A&M kam für eine Band, die in einer Szene voll stolzem, lokalem Selbstverständnis irgendwo am Ende der Vereinigten Staaten begann, nur auf den ersten Blick früh. Die ungebrochene, dauernd neugeborene Kreativität ihrer Alben zeigt, dass das Wahrwerden des Rock-Mythos vom steilen Aufstieg auf keinen Fall gleichbedeutend mit Anpassung sein muss.
Selbst nach dem Megaseller "Superunknown" (1994), mit dem sie Nummer eins in den US-Charts geworden waren, ruhten sie sich nicht auf erfolgversprechenden Gitarren-Riffs aus. Mit "Down On The Upside" (1996), ihrem sechsten Album, ließen sie keinen Zweifel daran, dass sie auch nach mehr als 20 Mill. verkauften Platten alles andere als angepasst sind. Deshalb waren Soundgarden richtige Rock 'n' Roller.
"Ihr neues Werk setzt eine Energie frei, mit der man eine mittlere Großstadt ein Jahr lang versorgen könnte", ließ der "Musikexpress" im Juni 1996 seine Leser wissen. Ein knappes Jahr später drehten sie den Strom ab. Mit "Pretty Noise" ist es vorbei. Der Spaß ist weg. Soundgarden gibt es nicht mehr. Der Rock 'n' Roll hat seit ihrem Ende eine Speerspitze voller Seele verloren, aber einen Mythos gewonnen.
Bernhard Flieher
(Bernhard Flieher ist Redakteur
bei den Salzburger Nachrichten)
=== Zurück zur Übersicht ===