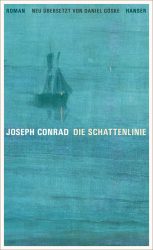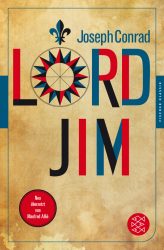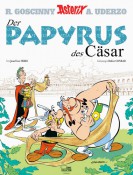Es war eine merkwürdige, melancholische Vorstellung, aus dem Halbbewussten hervorgekommen wie alle unsere Illusionen – die, vermute ich, einfach nur Bilder einer fernen, unerreichbaren Wahrheit sind, die wir nur undeutlich erkennen.
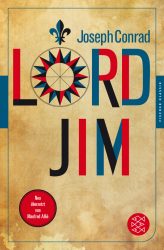 Joseph Conrad gehört zu meinen eher frühen Lektüren, als ich in Schriftstellern noch Denker vermutete und in ihren Büchern einen tieferen Sinn. Gerade hierfür ist Joseph Conrad ein nahezu idealer Kandidat, da er wohl selbst glaubte, dass allem ein geheimer Sinn innewohnt, den er nur nicht recht in Worte zu fassen, den er aber durch eigenes und nacherzähltes Raunen dem Leser anzudeuten vermochte. Insbesondere die unmittelbare Begegnung des Menschen mit den Naturgewalten, vorzüglich dem Meer in seiner Schönheit und Gefährlichkeit führen ihn zu den existentiellen Einsichten, die die Bücher durchraunen. Dabei sind attraktive, zum Teil spannende, immer gut lesbare Texte entstanden.
Joseph Conrad gehört zu meinen eher frühen Lektüren, als ich in Schriftstellern noch Denker vermutete und in ihren Büchern einen tieferen Sinn. Gerade hierfür ist Joseph Conrad ein nahezu idealer Kandidat, da er wohl selbst glaubte, dass allem ein geheimer Sinn innewohnt, den er nur nicht recht in Worte zu fassen, den er aber durch eigenes und nacherzähltes Raunen dem Leser anzudeuten vermochte. Insbesondere die unmittelbare Begegnung des Menschen mit den Naturgewalten, vorzüglich dem Meer in seiner Schönheit und Gefährlichkeit führen ihn zu den existentiellen Einsichten, die die Bücher durchraunen. Dabei sind attraktive, zum Teil spannende, immer gut lesbare Texte entstanden.
Lord Jim, das durch sein Erscheinungsdatum die Jahrhundertgrenze markiert, ist einer der langen Romane Joseph Conrads. Man merkt ihm seine Entwicklung aus einem wesentlich kürzeren Entwurf an, da die erzählerische Konstruktion, dass es sich bei mindestens 70 % des Romans um die Erzählung Charles Marlows an einem einzigen Abend handelt, doch sehr strapaziert wirkt. Überhaupt leidet auch dieses Buch unter der Pest des 19. Jahrhunderts, dass alles zu Ende erzählt werden muss und es deswegen mindestens 100 Seiten mehr hat, als ihm gut tut. Es ist wohl nicht falsch, das Buch in zwei Hauptteile einzuteilen, die durch Einleitung, Überleitung und Ende gerahmt sind: Der erste Teil beschäftigt sich mit der Reise des Pilgerschiffs Patna, der zweite Teil mit der Karriere des Titelhelden als Eingeborenenkönig irgendwo in Südostasien. Nach einer auktorialen Einführung der Figur Jims nutzt Conrad den Wechsel zum Erzähler Marlow – den er später unter anderem auch für sein berühmtes Herz der Finsternis gebrauchen sollte – um den Leser für weitere 50 Seiten über den Ausgang der ersten Krise in Jims jungem Leben im Unklaren zu lassen.
Jim jedenfalls versagt für einen Augenblick in einer Krisensituation und wird von der Ironie des Schicksals sofort für dieses Versagen heftig niedergeschlagen: Er verliert sein gerade erst erworbenes Offizierspatent und ist in ein Leben entlang der Küste gezwungen, wo er sich für verschiedene Schiffsausstatter als Hafenagent verdingt. Immer, wenn ihn die Geschichte seiner Schande einholt, zieht er weiter nach Osten. Schließlich trifft er in Mr. Stein einen ihm geneigten Menschen, der ihm einen entlegenen Handelsposten im fiktiven Patusan anbietet, wo Jim als einer von nur zwei Weißen Karriere als eigentliche Macht vor Ort macht, sich in ein Mädchen verliebt und endlich einen kleinen Platz auf der Welt gefunden zu haben scheint, wo er seine Jugendträume von Bedeutung, Einfluss und Verantwortung ausleben kann. Natürlich muss auch hier ein Ende gefunden werden, weshalb das Buch leider in einer Art von Piratengeschichte endet, die nur als angeklebt bezeichnet werden kann.
Abstrakt betrachtet handelt es sich bei Lord Jim um eine Variation auf den im 19. Jahrhundert beliebten Entwicklungsroman mit der besonderen Pointe, dass die Gesellschaft, in der Jim nach seinem Fall seinen Ort und seine Bestimmung findet, am gegenüberliegenden Längengrad der Welt liegt. Man kann dies sowohl als Kritik an der westlichen Welt und ihrer unmoralischen Moral verstehen wollen oder auch als Missbilligung der merkwürdig hochgespannten Persönlichkeit Jims, der erst sehr spät und sehr endgültig zu einer Einsicht in die tatsächliche Verfasstheit der Welt gelangt. Gerade die letzte Lesart sollte in der Wahrnehmung des Lesers gekontert werden durch die Sympathie, die beide Erzählerfiguren Jim entgegenbringen, indem sie immer und immer wieder betonen, Jim sei „einer von uns“ (diese Formel wird mindestens acht Mal auf den knapp 500 Seiten des Romans benutzt).
Dass ich Lord Jim gerade jetzt wieder gelesen habe, verdankt sich eher einem Zufall: Im letzten Jahr wurde Conrads Die Schattenlinie neu übersetzt – ebenfalls in nächster Zeit hier zu besprechen – und in diesem Zusammenhang habe ich meinem Buchhändler gegenüber einmal mehr die Übersetzung von Herz der Finsternis durch Manfred Allié gelobt; mein Buchhändler fand rasch heraus, dass Allié inzwischen auch den Lord Jim ins Deutsche übertragen hatte. Und auch diesmal hat sich der Übersetzer am Text bewährt. Es ist nicht einfach, das Raunende und Indirekte Conrads zu übersetzen: Es gerät leicht ins mystische Schwafeln oder in die blanke Undeutlichkeit, aber Allié ist es auch hier gelungen, den Grundton Conrads und seine Indirektheit sehr angemessen ins Deutsche zu übertragen.
Das Buch als Buch allerdings ist leider eines der Ärgernisse, wie sie sich immer öfter im Buchhandel finden: Für das sogenannte Hardcover (was einen festen statt eines flexiblen Pappkarton als Umschlag bedeutet, nicht mehr) wurde der Satzspiegel des Taschenbuchs schlicht optisch aufgeblasen (dieses Verfahren hat eine ganze Reihe von Großdruck-Büchern erzeugt), und man hat sich bei Fischer nicht einmal die Mühe gemacht, eine eigenes Cover-Bild für den Schutzumschlag zu entwerfen, sondern einfach den Umschlag des Taschenbuchs benutzt. Daher ziert dieses Hardcover das Logo der Fischer Taschenbuchreihe. Was der Käufer also für die 8,– €, die das Hardcover mehr kostet als das Taschenbuch, bekommt, ist ein optisch hässlicher Buchsatz und einen festen Pappendeckel um das Buch geklebt; auch ein angeklebtes Stofflesezeichen findet sich. Zum Ausgleich kostet wenigstens das E-Book, zu dem ich angesichts der Qualität der gedruckten Ware raten würde, nur 3,99 €.
Joseph Conrad: Lord Jim. Eine Erzählung. Aus dem Englischen von Manfred Allié. Frankfurt: S. Fischer, 2014. Pappband, Lesebändchen, 493 Seiten. 22,99 €.
 Asterix lebt! Mit diesem Band beweist das neue Autorenteam und auch der deutsche Übersetzer Klaus Jöken, dass sie durchaus in der Lage sind, an alte Höhen anzuknüpfen. Der Band hat nicht nur eine akzeptable Geschichte zu erzählen, sondern auch die Wortspiele und Anspielungen funktionieren diesmal und das übergeordnete Thema der Jugendkultur ist einigermaßen überzeugend durchgehalten, wenn auch hier sicherlich die Einschränkung zu machen ist, dass es sich einmal mehr um eine Jugendkultur handelt, wie sie sich jene vorstellen, die an ihr nicht teilhaben.
Asterix lebt! Mit diesem Band beweist das neue Autorenteam und auch der deutsche Übersetzer Klaus Jöken, dass sie durchaus in der Lage sind, an alte Höhen anzuknüpfen. Der Band hat nicht nur eine akzeptable Geschichte zu erzählen, sondern auch die Wortspiele und Anspielungen funktionieren diesmal und das übergeordnete Thema der Jugendkultur ist einigermaßen überzeugend durchgehalten, wenn auch hier sicherlich die Einschränkung zu machen ist, dass es sich einmal mehr um eine Jugendkultur handelt, wie sie sich jene vorstellen, die an ihr nicht teilhaben.