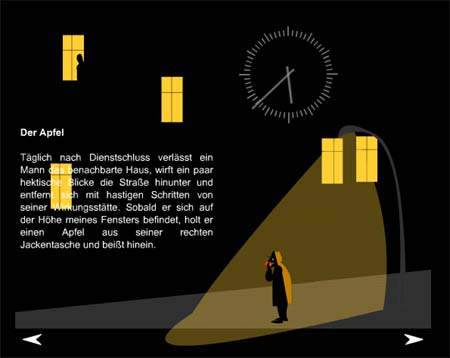 Dies ist zunächst
einmal eine gut erzählte Geschichte, die nach dem
Einstieg bald ihren kafkaesken Verlauf nimmt, als die
Erzählerin einsieht, dass sie der Routine des
unbekannten Mannes nicht entkommt, sondern sich in einen
Rhythmus gezwungen fühlt, "dem ich nicht gewachsen bin,
dem ich aber nachgeben muss, weil es keinen Ausweg, kein
Ziel gibt." Da hilft auch der Diebstahl und die
Zertrümmerung des Apfels nicht. Das kehrt nur die
Bewegung um: "Täglich nach Dienstschluss steht ein Mann
vor meinem Fenster und führt einen Apfel weg von seinem
Mund. Er befördert ihn in seine rechte Jackentasche und
bewegt sich rückwärts in Richtung des benachbarten
Hauses, geht die Treppe herauf und betritt
rückwärts seine Wirkungsstätte. Mit einem
Lächeln auf den Lippen schließt er die Tür.
Grundsätzlich zur gleichen Uhrzeit und ohne jede
Abwandlung wiederholt sich das Ritual." Es ist die Routine, die
schmerzt und die 30jährige Erzählerin
schließlich im Spiegel wie eine alte Frau aussehen
lässt: "Ich möchte erleben, dass der Kreislauf
durchbrochen wird, einmal nur will ich mich nicht auf diesen
Bahnen bewegen, einmal nur soll der Weg in eine andere
Richtung führen. Wenn der Mann ein einziges Mal nicht
mit dem Zug nach Hause fahren würde, sondern den Bus
nehmen müsste, um noch an einem Obstladen
vorbeizukommen, wäre ich erlöst." Der Entschluss
braucht eine andere Richtung. Die Erlösung kann nur von
der Ich-Figur selbst kommen. Sie muss die Beobachterposition
verlassen, das eigene Leben ändern statt die Routine
des Apfelessers. Aber das passiert nicht; die Geschichte
geht kafkaesk aus, und zwar gleich in drei Varianten.
Die Alternativität am
Ende dieser ansonsten linearen Geschichte ist nicht das
einzige medienspezifische Merkmal und wäre als solches
gewiß auch etwas dünn. Die Geschichte - die
zunächst auf Papier vorlag und auch im Wettbewerb
alternativ als reiner Text zu haben ist - wird hier in
Flash-Design visualisiert, mit einer von der Flash-Technik
diktierten Sparsamkeit, was zu Minimalismus-Kulissen und
interessanten Schnitten führt. So sieht man gleich
anfangs die Silhouhette der Stadt, die sich zur Straße
formt, aus der wiederum die Laterne entsteht - unter der der
Mann den Apfel essen wird - und das Fenster - hinter dem die
Beobachterin warten wird. Oder die Büro-Kulisse: Die
Entfaltung der Gegenstände aus Häufchen an Daten
im Raum, bis ein Arbeitszimmer mit Schreibtisch, Schrank,
Tür und Lampe (die ihren Lichtkegel hin und her wirft)
Gestalt angenommen hat. Dass dies gelungen ist, wissen auch
die AutorInnen. Denn in dem Zimmer passiert gar nichts; es
wird gleich wieder abgebaut, Stück für Stück:
Es ist Kulisse nur für sich selbst. In den besten Fällen
ergibt die Visualisierung eine zusätzliche Aussage:
wenn die unausweichliche Situation der Beobachterin sich in
mehreren Fenstern mit mehreren Schatten darstellt oder wenn
die Axt immer wieder in den Schädel des Apfelessers
fährt, als solle er für jeden einzelnen
büßen. In anderen Fällen dient sie der
bloßen Illustration des Gesagten: wenn vom Tanz des
Apfels vor den Augen der Beobachterin die Rede ist und
Äpfel im Reigen sich auf dem Bildschirm bewegen. In
manchen wird sie problematisch: wenn die Äpfel
schließlich in Tränen übergehen. "Uns war die Ästhetik
des Beitrag besonders wichtig, die erzählte Geschichte
sollte durch die Animationen visuell erfahrbar sein und
außerdem eine den User beeindruckende Atmosphäre
aufbauen, die ihn gespannt sein lässt auf den
nächsten Klick", so Dorit Linkes Selbsterklärung.
Dass sie Erfolg hatte, bezeugt der zweite Platz in der Gunst
des Publikums. |