|
Wettbewerb Literatur.digital 2001 Knittelverse Julius
Raabe |
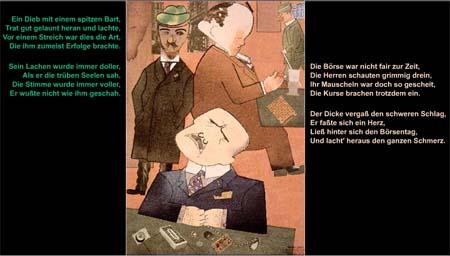 Eine Ebene ist der
Befehlstext, der zum Beispiel dafür sorgt, dass bei
Mausklick die Köpfe der Personen auf dem Bild sich
bewegen und gar ihre Zugehörigkeit ändern oder
eine Person eine Havanna raucht, wobei sich dann
tatsächlich auch Qualm über die Szenerie legt.
Zugleich erscheinen - dies ist die andere Ebene versteckten
Textes - rechts und links vom Bild kreuzreimige Vierzeiler -
Raabes sogenannte Knittelverse -, die den vier dargestellten
Personen Klick für Klick eine Geschichte
anhängen. Schon diese Idee hat es in
sich. Sie macht deutlich, dass ein digitales Bild mehr ist
als die Digitalisierung eines Bildes. Im Reich des Digitalen
gibt es keine Linie mehr, nur eine entsprechende Verdichtung
von Pixeln; jedes dieser Pixel kann separat angesprochen und
zum Verlassen seines Platzes programmiert werden. Das
digitale Bild ist kein festgehaltener Moment mehr, es hat
selbst seine eingeschriebenen Momente. Der Slogan lautet
nicht allein: Dies ist keine Zigarre, sondern auch: Dies ist
keine Abbildung einer Zigarre. Denn was wir sehen ist immer
bloß die temporäre Visualisierung eines
alphanumerischen Codes. Aber Raabes Werk
buchstabiert nicht nur das Wesen eines Bildes um, es stellt
auch eine originelle Form des Hypertexts dar, denn je nach
Ordnung des Klickens erzählt dieses Bild verschiedene
Geschichten. Da stiehlt der hagere Mann in der Mitte einmal
dem Glatzköpfigen im Vordergrund das Geld, ein andermal
tritt er als Komissar auf, dann als Hasardeur, dann wieder -
nun als Anarchist - zündet er eine Bombe, die den
Bildschirm schwarz werden lässt. Die Entdeckung der
ganz im Grosz-Stil nicht gerade feingeschnitzten, und sicher
auch nicht zu ernst gemeinten Texte führt zu einem
Klickspaß, der immer wieder neue Lesarten des Bildes
hervorbringt: Rund 1 800 Wörter bzw. 2,5
engbeschriebene Seiten Text verbergen sich unter der
Oberfläche dieses Flash-Werkes. Aus dem dd: Wie
kamst du zum Schreiben digitaler Literatur? JR: Auschlaggebend
für die Beschäftigung mit der digtalen Literatur
war der ausgeschriebene Wettbewerb. Ein Wettbewerb bietet
ein Forum, liefert Kritik und setzt ein zeitliches Limit
für eine Arbeit. Dieser Rahmen war sicher nicht nur mir
sehr wichtig. Das technische Handwerk wurde durch den
täglichen beruflichen Umgang als Architekt mit dem
Computer geschult (auch wenn ich mich, soweit es die
Programmierung betrifft, schwer überschätzt habe)
und so fiel mir zumindest der Anfang sehr leicht.
dd: Welche
Erfahrungen hast du bei der Produktion digitaler Literatur
gemacht? JR: Der Autor
muß etwas mehr als nur eine Schreibmaschine bedienen
können, er muß sich Fähigkeiten aneignen,
die sich sehr von jenen unterscheiden, die er gemeinhin
pflegt und entwickelt. Beim Programmieren wird er in jedem
Computerprogramm einen gnadenlosen Lektor finden. Wie ein
Musiker muß der Autor sein Instument blind
beherrschen, es sei denn er findet jemanden, der nach seinen
Anweisungen spielt. Ich versuche mich gerade an den ersten
Tonleitern. Die Herausforderung besteht darin, beide
Bereiche zu verbinden. Die zweite Eigenart der
digitalen Literatur zeigt sich, wenn der Autor sein
Instrument virtuos beherrscht und dann richtig aufspielen
möchte. Hier lauert die Gefahr, daß eine visuelle
Dominante die Arbeit bestimmt. Diese Problematik führt
zu der Frage nach der Form, nach der Tarierung aller
eingesetzten Mittel, die sich gemeinsam dem Konzept
unterordnen müssen. dd: Wie
kamst du auf die Idee der Knittelverse? JR: Für
mich war die Frage nach den Besonderheiten der digitalen
Literatur wichtig. Ein Unterschied zu anderen Medien liegt
in der Möglichkeit, Varianten einer Geschichte
anzubieten, die vom Betrachter entdeckt werden müssen.
Diese Varianz wollte ich zum Thema machen. Eine wie auch
immer geartete visuelle Gestaltung musste also zwei Aufgaben
übernehmen: Sie sollte einerseits den vielen
Geschichtchen einen gemeinsamen Rahmen, einen gemeinsamen
Ausgangspunkt bieten und andererseits als Navigator
fungieren. Ein Bild als Ausgangspunkt
einzusetzten lag nahe, eines von Grosz zu wählen nicht.
Die Brillantenschieber erwiesen sich jedoch als dankbares
Objekt. Die Art der Darstellung und die Bildaufteilung
unterstützten die Möglichkeit kleiner Animationen,
die dominanten Köpfe förderten das intuitive
Auffindung der Verlinkung und die im Bild ungenannte
Beziehung der Schieber zueinander ließen Raum für
verschiedene vorstellbare Geschichten. dd: Knittelverse
wurden von den akademischern Wächtern der Poesie lange
Zeit als volkstümlich abgelehnt und stehen auch heute
als Beispiel für leichte? JR: Die leichte
Kost war mir durchaus recht. Ich bin bald von dem
Variantenreichtum überrollt worden, weshalb mir auch
einige der schlichten Verse nur sehr holperig gelungen sind.
Es stimmt aber, daß diese etwas stoppeligen Verse mit
der karikaturartigen Darstellung von Grosz einhergehen. Das
Schriftbild unterstützt zusätzlich das Gemenge der
leichten Kost. Es ging mir um die Unterbringung vieler
verschiedener Geschichten in einem übersichtlichen Bild
und dem Betrachter sollte sich diese Arbeit ohne Umwege
selbst erklären. Die einfachen Texte gehören zu
diesem Konzept. |