Waldeinsamkeit,
Die mich erfreut,
So morgen wie heut
In ewger Zeit!
O wie mich freut
Waldeinsamkeit!
LUDWIG TIECK
In den Tagen und Wochen nach der Publikation von Ohne Punkt & Komma,
in dessen zweitem Teil ich zahlreiche neue Gedichtbände aus den 1990er
Jahren zumindest kurz vorstelle, fiel es mir schwer, mich von dieser
liebgewonnenen Art zu trennen, im Anschluß an die Lektüre das Gelesene
am Computer schriftlich Revue passieren zu lassen. So dachte ich
beispielsweise bei Hans-Ulrich Treichels Lyrikbänden Seit Tagen kein Wunder (Suhrkamp, Frankfurt am Main 1990) und Der einzige Gast (Suhrkamp,
Frankfurt am Main 1994), wie gut Zitate von Gedichten aus diesen
Büchern dem meinen noch getan hätten. Um wieviel mehr jedoch bedauerte
ich, daß die überraschende Büchersendung vom Rimbacher Verlag im Wald mit Lucien Wasselins zweisprachigem Gedichtbuch Voix Obscure
(1999) mich nicht ein paar Monate früher erreicht hatte, lernte ich
hier doch einen Verlag kennen, dessen mehrsprachige Art mich sogleich
ganz besonders ansprach. Mit der Bitte um Besprechung und der Klage, wie
schwierig es sei, in Deutschland als kleiner Verlag rezensiert zu
werden, [Rüdiger Fischer vergleicht die Situation mit der in Frankreich,
wo die Bücher seines Verlags zehnmal so oft besprochen werden wie
hierzulande! Im Kapitel „Kritiker in der Kritik“ äußere ich mich
ausführlich zu dem schwerwiegenden Problem zahlreicher Kritiker, weite
Landstriche deutscher Literatur, in deren unwegsamen Falten und Höhlen
Hunderte von kleinen Verlagen mit ihren unzähligen Büchern
verschiedenster Autoren nisten und hausen, schlicht zu ignorieren. Im
Zusammenhang mit dem Verhalten dieser parasitären Spezies gegenüber
Günter Grass (vor und nach dem Nobelpreis) bezeichnete ein Lyriker (der
auch Kritiken schreibt) die negativen Beispiele dieser Zunft als
„Geschmeiß“.] wandte sich Verleger und Übersetzer Rüdiger Fischer an
mich. Axel Kutsch hatte ihm meine Adresse gegeben. Die Tonart seines
Briefes gefiel mir. Ich las das Buch, war begeistert und schrieb Fischer
umgehend als Antwort, daß mich Voix Obscure so gefesselt habe,
daß ich durchaus Lust hätte, ein Porträt seines Verlags, der mir bislang
gänzlich unbekannt gewesen sei, zu schreiben. Leider sei mein Buch Ohne Punkt & Komma soeben erschienen, in dem ich den Verlag im Wald / Éditions en Forêt gern
vorgestellt hätte, aber ich würde nun einen selbständigen Aufsatz über
seine verlegerischen Aktionen schreiben, der unter günstigen Umständen
auch ein Kapitel eines möglichen neuen Buches werden könnte. [Ich hatte
mich in letzter Zeit wieder einmal mit Problemen beim Übersetzen von
Lyrik beschäftigt, und so kam Fischers Sendung gerade zum rechten
Zeitpunkt. Ich glaube nicht an Zufall oder doch: „Zufall ist, was mir
zufällt“, betont Max Frisch, der es von den alten Griechen hat.] Am 7.
August 1999, knapp drei Wochen nach meinem Brief, hält Postbote Guido
mir ein schweres Paket entgegen. Sie können sich, liebe Leser, meine
Euphorie vorstellen, Buch um Buch aus dem Karton des Verlags im Wald
auszupacken. Erst nach dem 35. Exemplar ist dieser leer. So glaubte ich
nicht nur, ich sei im Walde, sondern war es ja – und das in doppelter
Hinsicht: Schließlich lebe ich hier im Nationalpark Eifel, ringsum von
Bäumen umgeben.
Bereits die allererste Begegnung mit einem
Gedichtbuch versetzt mich in meine liebste Stimmung: die lyrische. Das
neugierige Blättern vorne, in der Mitte und hinten im Buch, das
Betrachten des Umschlags, die Freude über einen originalen Holzschnitt
von Heinz Stein, den ich in dem besonders gelungenen blauen Buch Le Grillon Bleu / Die blaue Grille von Jacques Canut entdecke, in dem ich mich sogleich festlese, das Gedicht
Mit dem Ideal auf der Schulter,
stolpere ich über die Wirklichkeit,
halte mich fest am Geländer
der Dichtung.
Mit kleinen Flügeln an den Achsen der Wörter
gelangt man in ungeahnte Länder
sehr
ansprechend finde und mich frage, ob Canut wohl damit einverstanden
ist, wenn der Übersetzer Rüdiger Fischer „personnalités“ mit „hohe
Tiere“ übersetzt, die Überraschung, auf dreisprachige Titel zu stoßen
und vieles andere mehr. Ich sortiere die Bände nach den drei Reihen
„Wege und Stimmen“, „Pfade“ sowie „Quellen“ und stelle am Ende fest, für
mehr als einen Monat Lesestoff vor mir liegen zu haben – und zwar
lauter Bücher, deren Autoren mir bislang wenig bis nichts sagen (mit der
Ausnahme des hochgeschätzten Pierre Garnier, von dem ich bereits eine
Reihe von Titeln besitze). In seinem Begleitschreiben bedankt sich
Rüdiger Fischer im voraus für die Mühe, die ich mir mit seinem Verlag
machen würde, und ich denke kopfschüttelnd: Mühe, Mühe, wenn der Mensch
wüßte, wieviel Freude er mir bereitet hat mit dieser Sendung. Und so
packe ich ebenfalls eine Büchersendung zusammen: Ja, er soll eins der 27
Exemplare des Künstlerbuchs Momentmale (edition bauwagen, Itzehoe 1999) erhalten, dazu noch Der blaue Schmetterling (Corvinus Presse, Berlin 1994) und natürlich Ohne Punkt & Komma (Wolkenstein,
Köln 1999). Leserinnen und Leser, die mich schon etwas länger kennen,
wissen, wie gern ich Kunst und Literatur auf dem Postweg tausche, um auf
diese Art kommunikative Begegnungen in Gang zu setzen, von denen wir im
Prinzip gar nicht genug haben können. Der kreative Austausch von in
verschiedenster Hinsicht gut gestalteten (Künstler-)Büchern aller Art
gehört für mich dabei zum Schönsten, was ich in der kontaktfreudigen
Welt der Mail Art kennengelernt habe.
Das Buch, das vom Format her komplett aus dem Rahmen fällt – es mißt 8 x 11 cm – ist Daniel Leducs Le Livre des Nomades / Das Buch der Nomaden, und so entscheidet sich von selbst, welches der Bücher ich als erstes lese:
Wir säen
manchmal
Lächeln aus
und gemurmelte
Worte
Ohne
zu wissen
ob es je
eine Ernte
geben wird
Sämtliche der ca. einhundert (acht- oder neunzeiligen) Gedichte sind in dieser archaischen Tonart geschrieben. Auffallend: Alle Gedichte beginnen mit dem Pronomen „wir“. Le Livre des Nomades ist ein Buch von 200 Seiten, das ich zunächst wie ein Daumenkino „durchrast“ habe – erst beim zweiten und bedächtigen Lesen habe ich mehr als einen Blick auf die französischen Originale geworfen. Davon abgesehen, daß mich die wie deutsche Gedichte anmutenden Übertragungen stark ansprechen, liegen Probleme des Übersetzens gleich bei oben zitiertem Gedicht auf der Hand. Bitte vergleichen Sie:
Nous semons
parfois
des sourires et des
murmures
ignorant
si la récolte
ne se fera
jamais
Vor allen Dingen der letzte Vers eines Gedichts ist ja stets von größter Bedeutung. Leduc hat hierhin – für sich allein – das ausdrucksstarke Wort jamais gesetzt: niemals! Und was ist daraus in Rüdiger Fischers Version geworden? Hat er etwa zu sorglos übersetzt? [Die Frage hat rein rhetorischen Charakter und gibt die negative Antwort selbst. Auch bei der Lektüre des nunmehr 20. Buches – Pierre-Bérenger Biscaye, Näher am Herzen von Esprels (1991) – aus der erwähnten Sendung verstärkt sich weiter der Eindruck, daß hier ein Übersetzer und Verleger am Werk ist, der die Literatur liebt. Der bukolische (und wunderbar sinnliche!) Charakter dieser Gedichte, in denen allerdings auch die Schatten nicht verschwiegen werden, wird kongenial nachempfunden, und das ist das Entscheidende. Die nicht immer gelösten Probleme bei der Erhaltung des ursprünglichen Zeilensprungs – einem der wesentlichen Faktoren des freirhythmischen Verses −, die bei den syntaktischen Unterschieden der Sprachen nicht so leicht in den Griff zu kriegen sind, oder die für mich nicht nachvollziehbare Entscheidung, zwei aneinandergereihte Adjektive in der Übersetzung mit „und“ zu verbinden, wiegen dagegen gering. Dennoch dürfen wir, gerade beim Gedicht, nicht vergessen: Auf jedes Wort kommt es dem Dichter an! So auch in dem schönen Gedicht, das ich auf Seite 19 des Buches lese:
Der Landmann hofft auf die Ernte
und der Dichter auf die Sammlung…
Man findet sie manchmal an einem Tisch
im Gasthaus des Dorfes,
sie reden ein wenig, zwischen zwei
sonnenbeschienenen Gläsern erwähnen sie
die Furchen der Worte, die die Dinge durchziehen.
Was der Übersetzer auch für seine Übertragung benötigt, ist Glück. So gibt es nun einmal für die französischen (alliterativ, klanglich, wortspielerisch eingesetzten) Wörter „récolte“ (Ernte) und „recueil“ (innere Sammlung), die die Eingangsverse im Original (zusammen mit dem Binnenreim terre/espère) „Líhomme de la terre espère / la récolte et le poète le recueil“ sowohl inhaltlich als auch formal außerordentlich dicht machen, meines Wissens keine direkten Entsprechungen: Oder haben Sie einen Vorschlag? (Eva Hesse hätte bestimmt einen: Ihr 2003 bei Rimbaud in Aachen erschienenes Büchlein Vom Zungenreden in der Lyrik vermittelt eine Reihe feiner Einblicke in die Werkstatt der professionellen Übersetzerin.) Jedenfalls erkennen wir bei dieser etwas genaueren Betrachtung, wie vorteilhaft die mehrsprachige Edition ist, in der sich der Verleger Rüdiger Fischer über den Übersetzer stellt und diesen outet: Das nenne ich ein Kommunikationsangebot an den Leser!] Hören wir in diesem Zusammenhang, was Heinz Piontek, der sich ja ebenfalls intensiv mit Gedichtübertragungen befaßt hat, zu den Problemen beim Übersetzen zu sagen hat:
Vor gut zehn Jahren habe ich selbst versucht, eine größere Auswahl von Keats-Gedichten zu übersetzen, vor allem seine Sonette und seine sämtlichen Oden. Da ich von meiner eigenen Arbeit gewöhnt war, Gedichte als etwas anzusehen, das sich zu einem Ende bringen läßt, brachte mich die prinzipielle Nichtabschließbarkeit von Gedichtübertragungen an den Rand der Schlaflosigkeit. Tag und Nacht prüfte ich Worte, Reime, die meinen Übersetzungen mehr und mehr Richtigkeit, Genauigkeit, Schönheit verleihen sollten. Hätte ich nicht eines Abends die Mappe zugeklappt und sie anderntags einem Verlag geschickt, ich weiß nicht, wohin ich gekommen wäre.
Ich selbst habe 1986 mit der Übertragung von Richard Burnsë Gedichtzyklus „Black Light“ begonnen. 1996 ist Schwarzes Licht im Bunte Raben Verlag
(Lintig-Meckelstedt) erschienen. Dabei formulierte Burns in einem
seiner zahlreichen Briefe (darüber hinaus besprach er noch über fünf
Stunden lang Kassetten mit Hinweisen auf Feinheiten, Strukturmerkmale,
Allusionen, Zitate usw., ganz zu schweigen von den beiden einwöchigen
Arbeitsbesuchen, die wir einander in Sistig bzw. Cambridge abstatteten)
das Phänomen Gedichtübertragung sehr griffig und bildhaft als „fuck
between two languages“. [Wobei ich betonen möchte, daß dieser „fuck“ ein
wahrhaftiger „Liebesakt“ sein muß, ein Akt zwischen (auch zur Demut
bereiten) Partnern, die sich vollständig darüber im klaren sein müssen,
daß es nicht um sie, sondern ausschließlich um das Medium geht, das sie
verbindet (und das keinem von beiden wirklich gehört): das Gedicht!
„Dafür gibt es andere [Anweisungen], die unter den Tisch gefallen sind,
meine Arbeit hat Stück für Stück ihre Identität verloren, ich wurde
besser oder schlechter gemacht, je nach Pokornys Empfinden und
Vermögen“, sinniert in Jurek Beckers Roman Irreführung der Behörden (Hinstorff,
Rostock 1973) der Held (ein Drehbuchschreiber) während seiner
Diskussionen mit dem Regisseur. Ähnliches empfinde ich häufig beim Lesen
von zweisprachigen Gedichtbänden – so beispielsweise bei der Lektüre
von Seamus Heaneys Die Hagebuttenlaterne / The Haw Lantern (Hanser, München 1987) oder Pier Paolo Pasolinis Gramscis Asche (Piper, München 1980), in dem beispielsweise der Reim unterschlagen wird: „Traduttoretraditore“ – „der Übersetzer verrät den Übersetzten“, sagt der Italiener, and more oftenthan not hat er wohl recht.Schließlich:
der Übersetzer muß – bei aller Demut – auch skrupellos sein und seine
Aufgabe mit einer gewissen kühlen Distanz tun. Es ist nicht in Ordnung,
die derbe Sprache William Shakespeares in seinen Dramen oder Jerome D.
Salingers in seinem Roman The Catcher in the Rye (Der Fänger im Roggen)
(um ein älteres und ein neueres Beispiel aus den Bereichen Drama und
Prosa zu benennen) zu schönen, wie es Schlegel und Böll getan haben, so
dem deutschen Leser einen ziemlich verfälschten Eindruck dessen
vermittelnd, wie diese Autoren „wirklich“ geschrieben haben. Ganz anders
darf eine Form der „Übersetzung“ mit Original und Intention des Autors
umgehen, die wir Parodie nennen. Hier wird der Autor grundsätzlich Opfer
von Ironie, Sarkasmus und Zynismus; oft bleibt vom Original nichts
übrig als das Äußere. Wo der Übersetzer Demut benötigt, um seiner Sache
gerecht zu werden, ist es beim Parodisten (u.a.) der schnöde Hochmut,
der ihn bisweilen Versionen schreiben läßt, die über das parodierte
Original hinauswachsen.] Der „Fehler“, den ich beim Übertragen der
Gedichte ein ums andere Mal beging, war, (vermeintliche) „Schwächen“ im
Original zu verbessern. „You should translate what is there and not what
ought to be there“, schrieb Burns mir zurecht, [„Der Versuch, Dichtung
aus einer Sprache in eine andere zu übersetzen, ist ein unschätzbares
Training für einen Dichter, und man kann nur hoffen, daß in jeder
Generation immer wieder neue Übersetzungen von Homer, Aischylos,
Aristophanes, Sappho und anderen gemacht werden.“ (Wyston Hugh Auden,
Die Griechen und wir, in: Das Bewußtsein der Wirklichkeit, Piper,
München 1989). Thomas Kling und Raoul Schrott gehören zu den Dichtern
der Gegenwart, die höchst eigenwillige Neuübersetzungen alter Dichter
versuchen. Allein die heftigen Streitgespräche zeigen, wie wichtig
solche Arbeiten für das Fortkommen der Literatur ist: Wir brauchen diese
literarischen Partisanen, die Öl in lyrische Feuer gießen, damit
lichterloh flackert, was vielerorts nur vor sich hinschwelt. Der
vielleicht originellste unter diesen ist der 1997 verstorbene Fritz
Graßhoff (Muschelhaufen 37/1998 ist die letzte Zeitschrift gewesen, für die er Verse noch selbst zur Veröffentlichung bestimmte), der bereits in Die klassische Halunkenpostille
(1964) gezeigt hatte, wo es mit den Römern und Griechen heutzutage lang
zu gehen hat, und der in dem posthum erschienenen in jeder Beziehung
exzellenten Buch Martial für Zeitgenossen (Eremiten-Presse,
Düsseldorf 1998) noch einmal zeigt, wie man die Klassiker derart ins
Bild rücken kann, daß selbst Lateinlehrer (im Nachwort) ins Schwärmen
geraten: Es sind echte Martials, eben weil Graßhoff die lateinischen
Epigramme martialisch behandelt.] und Ludwig Laistner, der kongeniale
Übersetzer der Carmina Burana (Lambert Schneider,
Gerlingen, 6. Auflage 1994) meint: „Es ist im Grunde die Aufgabe einer
sorgfältigen Nachbildung, auch Unvollkommenheiten der Vorlage wenigstens
in Form eines Äquivalents wiederzugeben.“
Bei allem Willen zur
Perfektion: Mehr noch als der Dichter muß sein Übersetzer mit den
Unzulänglichkeiten und Unvollkommenheiten leben – und der Leser auch.
Ich jedenfalls bin dankbar für die Übersetzungen [Glücklicher Salvador
Espriu, großer katalanischer Dichter, der griechische, lateinische,
hebräische, englische, französische, deutsche, italienische,
portugiesische, galizische, baskische, okzitanische, holländische,
rätoromanische, schwedische und serbokroatische Gedichte im Original
lesen konnte, in dessen Gedichtband Der Wanderer und die Mauer (Piper,
München 1990) ich ein „in Gedanken an Goethe“ geschriebenes Gedicht
finde, das wir ja auch als eine Art der Übersetzung ansehen müssen –
ironischerweise kenne ich nur die deutsche Übertragung von Fritz
Vogelgsang:
MORGENLIED
Wach auf, schon tagt es neu,
schon leuchtet
Frühlicht, das altgetreu
dir stille Wege weist, von Dunst umfeuchtet.
Nichts sollst du missen,
wandernd und schauend bis zum letzten Strahl.
Denn alles wird dir mal
im Nu entrissen.
Auch
wenn ich kein katalanisch spreche: Bei diesem Gedicht, das von den
Versen eines unserer größten Dichter inspiriert zu sein scheint, hätte
ich gern das Original gelesen – ebenso bei dem extravaganten Wort
„Blickbahnpein“, das ich an anderer Stelle vorfinde.] – hier Rüdiger
Fischers −, die es mir ermöglichen, zumindest ein wenig Einblick in eine
lyrische Welt zu bekommen, die mir ja ansonsten mehr oder weniger
verschlossen bliebe. [Wobei der wesentliche Aspekt den Lesern, die das
Original nicht lesen können, vorenthalten bleibt. Wenn wir sagen, wir
„kennen“ einen Dichter, kennen wir ihn und sein Werk so lange nicht
wirklich, bis wir die Gedichte im Original lesen: „Der ästhetische
Verlust bei der Übersetzung von einer Sprache in eine andere ist immer
ungeheuer groß.“ (W.H. Auden, „Die Griechen und wir“). Auf durchaus
amüsante Art und Weise wird mir das in Anna Achmatowas Im Spiegelland (Piper,
München, 1994) vor Augen geführt: Das Gedicht „Lied von der letzten
Begegnung“ wird in vier verschiedenen Übertragungen angeboten: Zwei
sprechen in einem Vers von „vier Stufen“, zwei von „drei Stufen“.]
Nun gewährt mir der Verlag im Wald
einen weiten Blick über die Fluren der zeitgenössischen französischen
Poesie, von der ich bislang wenig kannte und die mir ans Herz wächst:
Francois de Cornière beispielsweise hat mir gestern mit seinen lyrischen
Alltagsnotaten, die ich in seinem Band Longtemps après le soif / Lange nach dem Durst (1995) fand, den Abend verschönert:
KARUSSELL
es braucht gar nicht viel
ein Photo zwischen den Seiten
den Terminkalender
der in einer Schublade wieder auftaucht
ein Taschenmesser den Fetzen eines Briefes
den Namen auf einer Plattenhülle
das Licht auf einem Teppich
ein altes Karussell
das sich auf dem Deich im Oktober noch dreht
während die Muttis darauf warten
daß die Flut zurückkehrt
daß ihr Strickzeug fertig wird
und daß der Schatten sie aufstehn läßt
zu früh es war so angenehm
vor der letzten Fahrt
Und heute morgen beginnt die lange Bahnfahrt von der Eifel nach Köln gleich mit einem Paukenschlag, als ich den Gedichtband Mémoire du Mal / Erinnerung an das Böse (1998) von Yves Heurté aufschlage: „Die Dichtung ist stärker als die drei stärksten Dinge: das Böse, das Feuer und der Sturm (…). Aber was ist Dichtung? Darüber sagt das Sprichwort nichts.“ Diesen Aphorismus von Georges Perros hat der 1926 geborene Heurté Gedichten vorangestellt, die vor nichts haltmachen. Und statt mich durch den gelungenen Aphorismus verleiten zu lassen, mich wieder einmal mit der Frage zu befassen, was denn überhaupt ein Gedicht sei, [Je länger Gedichte geschrieben werden, um so vorsichtiger werden die poetologischen Definitionen des Begriffs „Gedicht“, dessen Facettenreichtum mit einer Begriffsbestimmung schon längst nicht mehr transparent gemacht werden kann.] vertiefe ich mich lieber in diese Verse, die bei aller Schonungslosigkeit auch (ein bißchen) optimistisch sind:
Auch wenn uns Dichtern
kaum Flügel noch Worte bleiben
am Ende des Jahrtausends,
bleibt uns, eine Welt zu entziffern,
der das alles egal ist!
Es
ist eine ungewöhnliche Leseeinstellung für mich, daß ich en bloc
Lyrikbücher von Menschen lese, deren Namen auf den Umschlägen mir so
wenig sagen (und die in Frankreich sicherlich sehr bekannt sind). [Die
Mehrzahl der Publikationen ist französischen Ursprungs, daneben gibt es
Autorinnen und Autoren aus Belgien, Griechenland, Italien sowie den
USA.] Wie anders ist das, wenn ich das Buch eines mir bekannten Dichters
oder gar eines international berühmten „Klassikers“ lese: weißes Feld
statt labelling effect (von Pierre Garnier, den ich im Kapitel „Sistiger
Favoriten“ vorstelle, und Stéphane Mallarmé abgesehen).
Wie stets
bei schön empfundenen, über einen längeren Zeitraum andauernden
Tätigkeiten spüre ich ein paar Tage vorher die Wehmut bei dem Gedanken,
daß ich die Büchersendung aus dem Verlag im Wald bald bewältigt
haben werde; gleichzeitig sprechen die Wörter eine andere Sprache:
„bewältigen“ vermittelt Konnotationen wie: „Endlich!“ oder: „Geschafft!“
Elles habitent le soir / Sie bewohnen den Abend
ist der 1999 von Casimir Prat erschienene Lyrikband tituliert, der u.a.
auch die bibliophile Note, die zum editorischen Programm des Verlags
gehört, auf betont schlichte Weise hervorhebt. Wie in allen vorherigen
Bänden fällt mir wieder der (unnachahmliche?) sinnliche Ton der
französischen Lyrik auf, ein Ton, der in vielen zeitgenössischen
deutschen Gedichten entweder fehlt oder künstlich wirkt. Und bis auf die
seltenen Abweichungen vom Original, die ich für hinterfragenswert
halte, [So entscheidet sich Fischer immer einmal für das Hyperbaton, wo
der Dichter eine ganz natürliche Syntax pflegt: „La lumière est-elle
sainte?“ wird zu „Ist heilig das Licht“? Warum nicht einfach und analog:
„Das Licht – ist es heilig?“] gelingt es dem Übersetzer wieder, diesen
Ton einzufangen und herüberzubringen, ganz so wie die Sängerin den
Operngraben überwinden muß, um die Arie an den Mann zu bringen.
[Übrigens befindet sich nur eine Übersetzung unter den 35 vorgefundenen,
die einen zwiespältigen Eindruck hinterläßt: In Pith Water / Wasserkraft
vom amerikanischen (kosmopolitischen!) Urgestein Cid Corman gibt es
eine Reihe von Gedichten (deren Binnenstruktur allerdings auch
hochkomplex ist mit ihren Mehrdeutigkeiten und Wortspielereien) die ich
anders übersetzen würde. Das Gedicht „RED CHAIR / CANDLE LIGHT // The
near nude seated / Woman cracking a flea for / That moment pregnant /
Realizes lifeís only / A moment in a Godís hands“ übersetzt Rüdiger
Fischer so: „Nahe sitzend, nackt / einen Floh fangende Frau / für einen
Augenblick, bedeutungsschwer / die klar erkennt, das Leben ist nur / ein
Augenblick in eines Gottes Hand.“ Ich möchte die folgende Version – um der Kontroverse willen
– anbieten, verzichte auf jeden weiteren Kommentar (außer vielleicht,
daß „prächtig“ ein mehrdeutiges Wortspiel ist, das u.a. „pregnant“ und
„trächtig“ kombiniert) und schlage vor, daß Sie, liebe Leser, wiederum
Ihre Version finden: „Die vertraut nackt dasitzende / Frau knackt einen
Floh, er- / kennt in diesem prächtigen Moment: / das Leben ist bloß /
ein Moment in der Hand eines Gottes.“]
Schlichten Gedichten voller
Anmut, Liebreiz und Melancholie, voller Sehnen, Hoffen und Suchen
begegne ich in den Versen von Jean Rivet in dessen Gedichtband Da nahm mich Charlotte bei der Hand. Dem Dichter fliegt die Enkelin als Muse zu:
Vorsichtig hast du den Vogel
Einen Star, am Flügel hochgehoben
Und mich gefragt: Gell, Großvater
Er ist nicht immer tot?
Gell, Großvater, er fliegt wieder fort?
Und hast mir die Hand gegeben.
Diese
45 Gedichte [die ich wiederum von rechts nach links und von links nach
rechts lese, Original und Übertragung vergleichend – und wiederum
feststellend, wie schwierig Entscheidungen an vielen Stellen immer
wieder sind: „Pour dix lignes puériles“: Meint der Dichter hier das eher
positive „kindlich“ oder das pejorative „kindisch“? Oder: „Jíaime la
solitude“ – ist hier eher das emphatische „Ich liebe“ oder das besonnene
„Ich mag“ gemeint? Und wiederum wird der Vorzug der Bilingualität
deutlich: Der Leser wird zum Mitübersetzer, und solange ich mich darauf
verlassen kann, daß hier ein leidenschaftlicher Übersetzer am Werk ist –
das allerdings ist eine absolute Voraussetzung – spielen diese
Kleinigkeiten nicht nur keine Rolle, sondern verhelfen dem gleichsam
kommunikativen Prozeß innerhalb der Lektüre zusätzlich auf die Sprünge –
denn auch vom Leser ist Wachsamkeit gefordert.
Eine ganz eigentümliche Lesesituation tritt ein, wenn ich beispielsweise Giuseppe Ungaretti in englischen Versionen (Selected Poems, Penguin Books,
Harmondsworth 1969) lese, wie ich es an einem regnerischen Sonntag im
Februar 2000 getan habe: Zum einen denke ich (grundsätzlich), daß der
schlechteste Übersetzer einen so großartigen Dichter wie Giuseppe
Ungaretti nicht kaputt kriegen kann, zum anderen denke ich (konkret),
daß gerade die Musikalität der englischen Sprache bestens geeignet ist,
Gedichte aus dem Italienischen zu: (über-)tragen.
So frage ich mich, nachdem ich die Bücher aus dem Verlag im Wald nun schon einige Zeit hinter mir gelassen habe, bei der Lektüre von Octavio Paz’ fernöstlichem Gedichtband Vrindavan (Suhrkamp,
Frankfurt am Main, 1994), ob man, wie im Gedicht „Intermezzo aus dem
Westen (3)“, „en espagnol“ mit „auf deutsch gesagt“ übersetzen darf,
wenn die Redewendung eine typisch spanische ist. Eine solche Übertragung
wirkt schnell unfreiwillig komisch.] in dem mit einem farbenprächtigen
Kinderbild verzierten Umschlag versehenen Buch morgens zwischen sieben
und acht Uhr während der Fahrt mit dem Zug nach Köln zu lesen versetzt
mir einen sinnlich-geistigen Vitaminstoß in den Tag hinein, der am Abend
noch vorhält und mir noch Frische verleiht, wenn der Tag gegangen und
Johnny Walker längst gekommen ist und ich das tue, was nicht nur Thomas
Mann für das Schönste am Tage hielt: abends lesend im Sessel zu sitzen.
„Doch das kein Ende findende Suchen nach noch genaueren, noch
überzeugenderen deutschen Reimen von immer noch schönerer
Selbstverständlichkeit zermürbte ihn dermaßen, daß seine
Geistesgegenwärtigkeit mitunter aussetzte und er wieder unter
Schlaflosigkeit litt“, lese ich in Heinz Pionteks Roman Dichterleben (Schneekluth,
München 1976), der die Geschichte des Dichters und Übersetzers Achim
Reichfelder erzählt, und diese Zeilengehen mir bei der Lektüre zweier
von Werner Wanitschek ins Deutsche übertragenen Bücher immer wieder
durch den Kopf, auch wenn es hier weniger um das Auffinden von Reimen
geht. Im Verlag im Wald erschien 1997 das Gedichtbuch Poëmes en prose / Gedichte in Prosa von Stéphane Mallarmé und als Premierenband beim 1999 von Wanitschek gegründeten Amsel Verlag Kleine Gedichte in Prosa oder Der Spleen von Paris von Charles Baudelaire. Vor allem Spleen
ist als Buch ein Kleinod – in dunkelrotes Leinen gehüllt, 17 x 11 cm
klein, 215 Seiten dick, mit einem langen Nachwort und zahlreichen
Anmerkungen versehen, allerdings ohne die französischen Originale. Schon
der erste Text – „Der Fremde“ – nimmt mich gefangen mit seinen
Schlußzeilen „Ich liebe die Wolken… die Wolken, die ziehen… da oben… da
oben… die wunderbaren Wolken“. [Weitere Aussagen zum Werk von Baudelaire
bzw. Mallarmé bitte ich in den buchstäblich Hunderten von Texten zu
diesen Klassikern der Moderne nachzulesen, an denen kein Dichter und
Leser, der es ernst mit sich und der Poesie meint, vorbeikommt – auch
heute nicht – oder besser: gerade heute nicht?]
Interessant ist noch der Vergleich von Werner Wanitscheks Versionen der Prosagedichte Mallarmés mit denen von Carl Fischer (Verlag Lambert Schneider,
Heidelberg 1957). Hier schneidet Wanitschek eindeutig besser ab. Er
hält sich eng an die Syntax und Wortwahl der Originaltexte, deren
aufgrund der abstrakten Nomen betont kühl wirkende poetische Magie auf
diese Weise direkter ins Deutsche übertragen wird.
Schließlich zeigt
auch das sich über viele Seiten hinziehende Nachwort (einschließlich
zahlreicher Anmerkungen) zum Buch von Baudelaire, wie sehr sich Werner
Wanitschek in die selbstgestellte Aufgabe hineinkniet. Im vollen
Bewußtsein, längst nicht der erste, sondern eher einer der letzten
Übersetzer Baudelaires und Mallarmés zu sein, bietet er dem Leser eine
Fülle von Informationen und Kommentaren, die mich zusätzlich motivieren,
immer tiefer in dieses große poetische Werk einzusteigen, das Fernando
Pessoa (dessen Zitat dem Nachwort vorangestellt ist) so kommentiert:
„Wer keine Verse machen kann wie Baudelaire, kann sich, indessen, die
Haare grün färben.“ [Und Stefan George jubelt: „Deshalb o dichter nennen
dich genossen und jünger so gerne meister weil du am wenigsten
nachgeahmt werden kannst und doch so großes über sie vermochtest · Weil
alle in sinn und wolklang nach der höchsten vollendung streben damit sie
vor deinem auge bestehen: weil du für sie immer noch ein geheimnis
bewahrst und uns den glauben lässest an jenes schöne eden das allein
ewig ist.“] Hier schlagen wir ein weiteres Kapitel des Übersetzens auf –
das des berühmten Dichters (und Erneueres der Lyrik) und seines kaum
bekannten Übersetzers. Weshalb begibt sich da noch einmal jemand an
offenbar unsterbliche Texte, die schon längst (und mehrfach) übersetzt
worden sind? Auch Achim Reichfelder fragt sich: „Mußte es übersetzt
werden? Alles müssen wir übersetzen, alles, was wir sehen, schmecken,
fühlen, hören, alles kann uns nur über das eigene Bewußtsein erreichen,
das in keiner anderen Sprache aufgeht als der eigenen.“ Und wer es so
genau wissen will wie Werner Wanitschek und Rüdiger Fischer, wer von der
Literatur besessen ist, wer ohne diese Leidenschaft (vielleicht) nicht
leben könnte, der übersetzt es, gründet sogar einen Verlag und hofft auf
Leser, die sich der mitunter zwar „schwierigen“, jedoch stets
atemberaubenden Dichtung stellen, deren Übertragung von einem schier
wahnhaften Enthusiasmus zeugt, dem wahrscheinlich das ganze Leben
(beinahe) unterworfen ist. Wer wüßte dies besser als Heinrich Faust:
Aber ach! schon fühl ich, bei dem besten Willen,
Befriedigung nicht mehr aus dem Busen quillen.
Aber warum muß der Strom so bald versiegen
Und wir wieder im Durste liegen?
Davon hab ich so viel Erfahrung.
Doch dieser Mangel läßt sich ersetzen,
Wir lernen das Überirdische schätzen,
Wir sehnen uns nach Offenbarung,
Die nirgends würdíger und schöner brennt
Als in dem Neuen Testament.
Mich drängtís, den Grundtext aufzuschlagen,
Mit redlichem Gefühl einmal
Das heilige Original
In mein geliebtes Deutsch zu übertragen.
Geschrieben steht: „Im Anfang war das W o r t!“
Hier stock ich schon! Wer hilft mir weiter fort?
Ich kann das W o r t so hoch unmöglich schätzen,
Ich muß es anders übersetzen,
Wenn ich vom Geiste recht erleuchtet bin.
Geschrieben steht: Im Anfang war der S i n n.
Bedenke wohl die erste Zeile,
Daß deine Feder sich nicht übereile!
Ist es der S i n n, der alles wirkt und schafft?
Es sollte stehn: Im Anfang war die K r a f t!
Doch, auch indem ich dieses niederschreibe,
Schon warnt mich was, daß ich dabei nicht bleibe.
Mir hilft der Geist! Auf einmal sehí ich Rat
Und schreibe getrost: Im Anfang war die T a t!
***
Erschienen in: Theo Breuer – Aus dem Hinterland, Edition YE, 2005
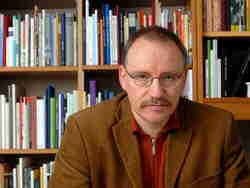
Weiterführend →
Einen Essay über das Tun von Theo Breuer als Herausgeber, Essayist und nicht zuletzt als Lyriker lesen Sie hier.