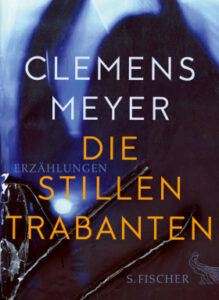Ein bisschen blümerant war einem schon nach der Lektüre von Im Stein: Nicht nur, dass es eine Fülle von Ausschweifungen zu betrachten gab, von denen man nicht immer wusste, ob man über sie unterrichtet sein möchte. Vielmehr zeigte sich Clemens Meyer, der wilde und zugleich gestreichelte Männerobelisk des Literaturbetriebs – mit kühlem Blick und buntem Arm sein Outstanding noch unterstreichend – in diesem Ziegel aus Sprache von einer dann doch ungewohnten Seite: Steinbruchhaft türmte sich ein nahezu handlungsbefreites Wort- und Blickungetüm vor einem auf und raunte von dräuenden Dingen.
Und auch die Frankfurter Poetikvorlesungen, die unter dem kuriosen Titel „Der Untergang der Äkschn GmbH“ eine Art Jean-Paul’sche Coda zum Romantrumm sein könnten, überzeugten ob ihrer beredten Füllsel-Seligkeit nicht ganz. Es ergab sich die zögerliche Frage, ob hier nicht das Exemplum eines verlorenen Fadens zum Besten gegeben würde. Dass dem mitnichten so ist, zeigt zum Glück der Band mit zwölf neuen Texten des Autors.
Es ist eine schöne Erleichterung, dass Clemens Meyer mit „Die stillen Trabanten“ zu seiner offenbaren Meisterform zurückkehrt, der Erzählung. In gewisser Hinsicht sind diese neuen Narrationen des Leipzigers eine Fortsetzung dessen, was er mit der grandiosen Sammlung „Die Nacht, die Lichter“ und dem Erzähl-Tagebuch „Gewalten“ an- und aufgerissen hat. Gegen das Licht gehalten nehmen sich die Romane vielleicht schwächer aus, aber das kann auch eine Frage des Geschmacks sein. Gerade das Debüt „Als wir träumten“, letztlich eine Collage aus zwanzig aufeinander bezogenen Storys, vermöchte da vermittelnd wirken. Für die nicht selten untergebutterte Gattung der Erzählung mit ihren Spielarten und Finessen, aus der der Roman als Monstrosum letztlich nur ausapert, sollte es genugtuend sein.
Dabei steckt Meyer in seinen neuen Claims durchaus wieder stilistische Grenzgänge ab. Drei prononciert auf eine zuweilen erschröckliche Pointe gebaute Miniaturen flankieren drei mal drei längere Stücke, die den Storys des „Nacht“-Bandes gegenüber durch einen tieferen Atem auffallen. Auch wechselt Meyer mit einer der Stimmen seiner Protagonisten das Geschlecht: in „Späte Ankunft“ wird mit den Blicken einer Frau erzählt.
Überhaupt verwundert und freut einen der Ort- und Stimmenreichtum dieser aufgeladenen Sprachstücke – nicht zuletzt im Angesicht dessen, was heute zuweilen als richtungweisende Prosa gesehen und gelehrt wird. Es sind Geschichten von den Rändern, aus den alten vergessenen Vierteln, aus den Bäuchen vergessener Schicksalsknäuel, die Meyer in die Jetztzeit türmt wie Artefakte aus einer Ära, an denen die funkende Jetztzeit sich reibt. In die Gegenwart platzt die Erinnerung, platziert sich in ihr wie die Gipsabgüsse pompejianischer Leichen. Gedanken, Blicke, Vorstellungen flocken wie Asche.
Es ist natürlich etwas Exotisches um diesen Schreiber, der einer angesehenen Künstler-Familie entstammt und der doch die sprichwörtlichen Mühen der Ebene auf sich nahm, besser: auf sich nehmen musste. Vielleicht, dass die wüsten Leipziger Nächte und die vielen Jobs Meyers die besseren Universitäten als das schliffgebende Literaturinstitut waren, aber das mag im Reich der Spekulation verbleiben. Nichtsdestotrotz, und das ist das Auffallende, liest man in „Die stillen Trabanten“ wieder Unerhörtes, es stellt sich dieser für Clemens Meyer stehende Hautgout aus Melancholie, Trotz und Surrealismus ein. Seien es die vergessenen Viertel von Halle, Leipzig oder Atlantis – in ihnen rumort und rummelt es, und man mag nicht bedenken, wohin man gelangt, wenn man um die Ecke geht, in der nächsten Spelunke, die die letzte sein mag, oder beim staubigen Gebrösel manch ruinösen Stadtteils einkehrt. Es ist auch Erinnern an Verflogenes darin, der Widerstreit mit den koprolithischen Ritualen der Jetztzeit: er ist seit dem Tod von Hilbig wieder auf Dokumentaristen angewiesen.
Ein berührender, dennoch weit gespannter Doppelpunkt sind die Pole, zwischen denen Meyer seine Stories und Novelletten ausbreitet – sie berühren und verbinden zwei solch elementare Einflüsse wie den großen Erzähler Hemingway und eben den gewaltigen Albtraumwandler W. H. auf eine Weise, die regelrecht irre und herzschlagbeeinflussend aufregend sein kann. Ein wenig reibt sich manche Wiederholungsschleife an den dann doch drängenden Saiten des präparierten Handlungs-Klaviers, aber was in der Tiefe dieser Texte geboten wird, es ist wieder mit dem Ruch des Gewieften und Großartigen zu umschreiben.
Gut, dass es, auch wenn die Einschläge geringfügiger werden, solche Bücher noch gibt. Und es wird ein weiterer Aspekt nicht von der Hand zu weisen sein: indem Clemens Meyer seinem äußeren Umkreis Raum und Plissé gibt, schafft er ihm zugleich eine Art Würde. Das Verlorene, es ist womöglich nicht verloren, es wartet vielleicht nur an den letzten Theken im summenden Licht der Kneipenbeleuchtung auf seine Wiederkehr. Möge es sein, daß diese Art schummrige Einkehr der anstehenden Konflikte dereinst vorgezogen wurde.
Jede Asche kennt ihren Phönix. Im Angesicht des Gegenwärtigen sind es bereits die Stimmen, die sich finden, deren Möglichkeit zum Finden zumindest noch besteht. Dass es noch Stimmen sind, mag über die erste Entzauberung helfen. Und ein zerreißender Spagat, wie ihn die Hotel-Lux-Insassen in der letzten, die „große Säuberung“ in der Stalin-Ära, die Verbiegung durch Angst einerseits, den stillstmöglichen Widerstand andererseits, anreißenden Erzählung am Beispiel Becher und Bredel anklingt, er möchte uns erspart sein.
***