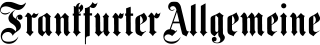Wer sich auf ihn einläßt, muß wissen, was er tut: "Die Erfahrung mit einem Menschen genügt für hundert Jahre. Man wird auch dann nicht mit ihr fertig." Das schrieb Canetti gegen die biographische Methode im allgemeinen, dürfte aber vor allem auf ihn selbst gemünzt sein. Als einen "Titan fürwahr, wenn auch einer in der Gestalt eines Kobolds", beschrieb ihn Urs Widmer, und tatsächlich ist seine Biographie ein titanisches Unterfangen. Denn kein Autor des vergangenen Jahrhunderts hat so bewußt Vorsorge für sein Nachleben getroffen, kaum einer hat so genau vorausberechnet, wie er in die Literaturgeschichte einzugehen habe.
Wenn der Überlebende nach Canettis Anthropologie der Machthaber ist, so hat er selbst versucht, dieser Macht im Angesicht des Todes Grenzen zu setzen: Zu dieser Politik gehört die Nachlaßregelung, die Tagebücher und Briefe noch bis 2024 sperrt. Aber auch die dreibändige Autobiographie und die sehr streng ausgewählten Aufzeichnungen kann man als zukunftspolitische Interventionen zu Lebzeiten lesen: Jede Erzählung dieses Lebens muß mit der Suggestionskraft und Sprachgewalt seiner Selbstdarstellung konkurrieren. "Eine Lebensgeschichte ist geheim, wie das Leben, von dem es (sic!) spricht. Erklärte Leben sind keine gewesen", schrieb Canetti ein Jahr vor seinem Tod und hat doch selbst versucht, sich selbst und die nahen und fernen Menschen seiner Umgebung immer wieder im apodiktischen Gestus des unfehlbaren Menschenkenners zu definieren.
Wenn heute also, gut zehn Jahre nach seinem Tod, eine erste umfangreiche Biographie erscheint, kann sie auf allergrößtes Interessse stoßen - zumal "Party im Blitz" (2003), der unvollendete vierte Band der Autobiographie über die englischen Jahre, noch mehr Rätsel aufgab als löste. Sven Hanuschek ist sich der Schwierigkeiten durchaus bewußt; in den ersten Kapiteln schildert er Canettis "antibiographischen Affekt". Hanuschek hat erstmals den (größeren) zugänglichen Teil des in Zürich aufbewahrten Nachlasses auswerten können - Entwürfe, Manuskripte und Varianten, Aufzeichnungen aus sechzig Jahren, Materialien, vor allem zu "Masse und Macht". Dieses - teilweise auch noch in einer schwer lesbaren "Geheimschrift", einer Steno-Variante, verfaßte - Material überstiege die Kapazitäten jedes Biographen. Aber schon die verarbeiteten Quellen machen dieses Buch unverzichtbar.
Canetti wird am 25. Juli 1905 als Kind sephardischer Juden im bulgarischen Rustschuk/Ruse geboren, das damals noch zum Osmanischen Reich gehört. Für die Kindheit und Jugend - das spaniolische Milieu in Rustschuk, die Zeit in Manchester, den überraschenden Tod des Vaters, die Schulzeit in Wien, Zürich und Frankfurt - ist der Biograph freilich auf die bekannten Schilderungen der "Geretteten Zunge" und der "Fackel im Ohr" angewiesen; regelmäßige Aufzeichnungen setzen erst Mitte der Zwanziger ein. Immerhin kann er anhand der Zeugnisse feststellen, daß Canetti trotz der Schul- und Sprachwechsel stets nur Bestnoten bekam; schon mit vierzehn, in Zürich, ging er zu Vorträgen der geographisch-ethnologischen Gesellschaft. Aus derselben Zeit stammt sein erstes erhaltenes Werk "Junius Brutus", ein Trauerspiel in fünf Akten, über das er selbst später vernichtend geurteilt hat; Hanuschek zollt der Talentprobe Respekt. Für Leser der Autobiographie gibt es nur wenig Überraschendes: Canetti ist der hochbegabter Musterschüler, der grotesk kopflastige Büchermensch, zu dem er sich selbst auch stilisiert, so daß man die Sorge der Mutter, er entwickele sich zu einem weltfremden Sonderling, durchaus nachvollziehen kann.