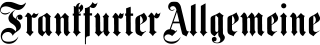Wildwest-Roman : In den Augen verrät sich die Leidenschaft des Tötens
- -Aktualisiert am
Der Rest von Wildwest: Cowboys und Huftiere in South Dakota Bild: Reuters
John Williams subtiler Campus-Roman „Stoner“ wurde zum Sensationserfolg. In „Butcher’s Crossing“, erstmals 1960 erschienen, schickt er seinen jungen Helden unter die Bisonjäger in den Wilden Westen.
Mit dem Schriftsteller John Williams (1922 bis 1994) verbindet sich die spektakulärste postume Wiederentdeckung in der nordamerikanischen Literatur seit Richard Yates. Sein subtiler Campus-Roman „Stoner“ wurde zum internationalen Sensationserfolg. Nun folgt, lang erwartet, ein zweiter Roman in deutscher Übersetzung, der allerdings kühn das Genre wechselt. Nicht um die Versteher feiner Verse geht es hier, sondern um ungewaschene Westmänner. Aber Jagd und Rivalität findet der Mensch schließlich überall.
In „Stoner“ verlässt ein Farmersohn seine bedrückende Herkunftswelt, studiert Literaturwissenschaft und wird Professor an einem kleinen College. Will Andrews, der Held von „Butcher’s Crossing“, macht genau das Umgekehrte. Einer angesehenen Bostoner Familie entstammend, hat er sein Studium in Harvard abgebrochen, weil er das wahre, wilde, würdige Leben kennenlernen will, draußen in der freien Natur, mit den Ideen von Ralph Waldo Emerson im Kopf.
In der ersten Szene - man schreibt das Jahr 1873 - erreicht Andrews nach holpernder Kutschenfahrt das Präriekaff Butcher’s Crossing, bestehend aus „wenigen Zelten und schlichten Bretterbuden“. Der Barbier des Örtchens schert sich nicht um Rechtschreibung: „Joe Long, Barbar“ liest sich sein Schild - wenn das keine Verheißung des Wilden Westens ist!
Vier Männer und tausend Büffel
Will Andrews wird bei einem Bekannten seines Vaters vorstellig, einem alten Händler von Büffelfellen, der ihn wiederum an ein prächtiges Exemplar von Frontier Man vermittelt: den Bisonjäger Miller. Viel zu tun hat der gerade nicht, denn die rücksichtslose Jagd hat die einst riesigen Bestände der Tiere zum Verschwinden gebracht. Irgendwo da draußen in den Bergen von Colorado soll es aber noch eine gewaltige Herde geben, weiß Miller. Damit noch einmal die romantische große Jagd auf den Weg kommt, geht Andrews in Vorleistung, finanziert die gesamte Ausrüstung mit seinem Vermögen. Und los geht die Reise. Vier Männer suchen tausend Büffel.
So genau John Williams in „Stoner“ die Machtspielchen und Fachbereichs-Harkereien an einem Provinz-College schildert, so eindringlich werden in „Butcher’s Crossing“ die Weiten von Kansas und Colorado beschrieben. Oder dehydrierte, geschwollene Ochsenzungen. Denn schon auf dem Hinweg droht Millers Unternehmen zu scheitern: Seit Tagen kein Wasser, die Männer halten sich beim Ritt durch die Einöde an Whiskey; für die Zugochsen opfert Miller das letzte Trinkwasser, tränkt damit Tücher und reibt den Tieren die Zungen ab, an denen sie sonst ersticken würden: „Behutsam badete Miller das rauhe, gequollene Fleisch; Hand und Handgelenk steckten tief im Hals des Ochsen.“
Er ist eine eigenartige, faszinierend ambivalente Gestalt, dieser Miller, die eigentliche Hauptfigur des erstmals 1960 erschienenen Romans. Mit der gleichen, zarten Behutsamkeit kümmert er sich um seinen Begleiter, den zu martialischer Frömmelei neigenden, halb verrückten Charley Hoge, den er einst vor dem Kältetod rettete, wobei er ihm allerdings die frostfaule Hand amputieren musste. Miller hat es mit der Überlegtheit, Sachkenntnis und Präzision getan, mit der er alles in Angriff nimmt - etwa auch die eigenhändige Herstellung der Patronen, die zwei Seiten lang in allen erstaunlichen Details beschrieben wird, wie in „Stoner“ die Fügung eines wohlgelungenen Renaissancegedichts. Millers Instinkt hat nicht getrogen. In einem fernen, versteckten Bergtal stoßen die Männer auf die große Büffelherde - endlich jubelt auch der ewig nörgelnde Häuter Fred Schneider. Miller weiß, dass man zuerst die Leittiere töten muss; wenn die nicht fliehen, bleibt die Herde ruhig. Und er tötet mit solcher Souveränität und Treffsicherheit, dass es den Anschein hat, auch die Tiere gewönnen Zutrauen zu der Prozedur, bei der ein Fleischberg nach dem anderen zusammenbricht, während die anderen weitergrasen.
Miller schießt Stunde um Stunde, Tag um Tag; der behutsame Ochsenzungentröster wird zur gnadenlosen Tötungsmaschine, der Naturkenner zum Naturzerstörer, und Fred Schneider meckert schon wieder, weil er angesichts der kaum noch zählbaren Kadaver nicht schnell genug mit dem Häuten nachkommt, bevor bei den Tieren die Leichenstarre eintritt. Mit blutigem Realismus wird beschrieben, wie die Tiere ausgeweidet werden, wie ihre komplizierten Innereien über den ungeschickten Andrews quellen, wie man es überhaupt schafft, so einem gewaltigen Büffel ohne größere Hilfsmittel das Fell abzuziehen, so dass bald nur noch die verwesenden Muskelberge stinkend im Tal liegen und Milliardenheere von Fliegen anziehen.
Alle Felle schwimmen davon
Und Miller schießt immer weiter - in seinen schwarz umrandeten Augen der leere Blick der Leidenschaft des Tötens, die Kontrolle über den kontrollierten Mann gewonnen hat. Weil er kein Ende kennt, wird die Gruppe vom Winter kalt erwischt. Grandios ist die Beschreibung des ganz sanft einsetzenden Schneefalles, der zum weißen Inferno wird, das es mit den legendären Schneestürmen bei Stifter oder Thomas Mann aufnehmen kann. Nun wird Miller wieder zum Überlebenskünstler, dank seiner Gewitztheit schaffen es die Männer, sieben harte, frostklamme Wintermonate im vier Meter hohen Schnee durchzustehen.
Bis sie sich endlich, den Wagen hoch beladen mit Büffelfellen, auf den Rückweg machen können. Fred Schneider, der seine Potenz mit frischem Büffelhoden gestärkt hat, faselt bereits von lange entbehrten Ausschweifungen - da trifft sie in einem atemberaubenden Kapitel der Pfeil des Schicksals. Beim Durchqueren eines Flusses, der nach der Schneeschmelze zum reißenden Wildwasser geworden ist, werden sie von einem Baumstamm gerammt; mit seiner gesplitterten Spitze zerfetzt er einem Pferd den Bauch. Der Wagen kippt, und in kaum einer Minute sind alle Felle davongeschwommen. Miller aber bewahrt die Ruhe. Zwei Drittel der Felle bleiben ihnen ja noch; sie liegen abholfertig in den Depots in den Bergen.
Buffalo Bill war flexibler
„Meine Güte, ihr Männer verbreitet einen mächtigen Gestank“, rümpft der alte Diener von „Butcher’s Hotel“ die Nase über die Rückkehrer, die acht Monate nicht die Wäsche gewechselt haben. Ein warmes Wannenbad gehört ins Finale eines ehrlichen Neo-Westerns; man liest es amüsiert. Miller aber vergeht nun das Lachen. Auf den letzten fünfzig Seiten bringt der Roman Mächte ins Spiel, gegen die sein Wildweststoizismus keine Chance mehr hat: die Gesetze des Kapitalismus. Das Finale wird zu Millers Albtraum. Nichts ist mehr, wie es war in Butcher’s Crossing; der Markt für Felle ist komplett zusammengebrochen. Niemand wolle das müffelnde Zeug mehr. „Erledigt“, krächzt der alte Händler. „Genauso, wie Sie erledigt sind, Miller, Sie und Ihresgleichen.“ Da überlässt sich Miller dem Furor einer maßlosen, selbstzerstörerischen Wut. Schlächter am Scheideweg: Ein Buffalo Bill war fitter für die postheroische Moderne. Als keine Bisons mehr zu jagen und zu verkaufen waren, wechselte er ins Showgeschäft und ging mit dreißig Eisenbahnwaggons voller Wildwestklimbim auf umjubelte Welttournee.
Wie „Stoner“ ist „Butcher’s Crossing“ eine Parabel über das Scheitern, das wie eine eigenständige Lebensmacht immer von neuem zu Schlägen ausholt. Während die meisten Kapitel von „Stoner“ in engen Zimmern spielen, endlose Seminar-Streitigkeiten und erbitterte Ehefehden schildern, überzeugt „Butcher’s Crossing“ durch die Weite der Räume und grandiose Landschaftspanoramen; die präzise, von Bernhard Robben geschmeidig übersetzte Sprache ist beiden Romanen gemeinsam.
Der Erfolg von „Stoner“ hat aber auch damit zu tun, dass es ein klassischer, in Bitternis getränkter Eheroman ist, ein Roman über das stoisch ertragene Unglück lebenslänglichen Zusammenseins. Dagegen gibt es in „Butcher’s Crossing“ nur eine einzige Frauenrolle am Rand: die Prostituierte Francine, nach der Fred Schneider giert und von der Will Andrews träumt. Sie findet Gefallen an dem romantischen jungen Mann und nimmt ihn am Ende in ihre Schule der Liebeskunst. So kann Will Andrews in der letzten Szene rundum initiiert, aber durchaus planlos in den Morgen reiten, die aufsteigende Sonne im Rücken.