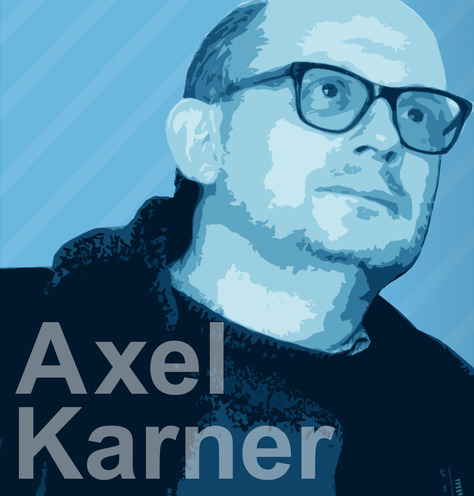Gewählter Autor: Axel Karner
Axel Karner
Bibliographie
2012
Der rosarote Balkon
Prosa

2010
Chanson grillée.
Mit Illustrationen von Anne Seifert.
Zehn ZEILEN. EINE ANTWORT
Der Verleger fragte den Dichter, warum er die
Gedichte drucken lassen wolle.
Der Verleger sagte dem Dichter, dass er ihm
Zehn Zeilen schreiben möge, warum er die
Gedichte drucken solle.
Ich weiß nicht. So oft ich’s les.
Ernst?
Ganz ernst!
Die Gedichte?
Was sonst?
Was wird?
Sag mir: warum?
Ich?
Gründe!
Genug.*
* Anregung für die Tiere nach dem Schlachten war die Lithografie des mexikanischen Malers Francisco Toledo Ein Grashüpfer kämpft mit dem Tod. Zudem erinnere ich mich an einen Bericht in der Süddeutschen Zeitung über eine Ausstellung Toledos in Madrid (Centro de Arte Reina Sofia, 2000) und die schwarz-weiße Darstellung einer Heuschrecke mit einem durchsichtigen Körper, wo entgegen der Wirklichkeit das Tier nicht äußerlich durch einen Chitinpanzer gestützt, sondern im Innern von einem menschlichen Skelett getragen wird.
In den Gedichten geht es um den Menschen. Es ist das Allzumenschliche, das sich hinter den Tierbildern verbirgt, das Komische, das Tragische, die Niedertracht und Gewalt, letztendlich das Alltägliche. Vor allem aber geht es um den Tod, der alles zum Vorschein bringt, aber schließlich auch endgültig verbirgt.

2007
Die Stacheln des Rosenkranzes.
Auch den, der Lissabon nie durchstreift hat, springen Axel Karners Gedichte an wie eine verwilderte Katze in der Alfama. Ein kleines, schweres Buch. Erich Schirhuber (Morgenschtean)
Doch trotz vieler Bilder von lauernder Bedrohung und stetem Zerfall findet Karner in diesen Gedichten gerade wegen der Zerschlagung und Konterkarierung von Tourismusklischees einen besonders tiefen und gefühlvollen Blick auf Lissabon. Sein bitterer Gesang auf die Stadt wird wohl bei vielen Lesern künftig "im Hinterkopf" nachklingen, wenn ihr Name fällt! Wolfgang Ratz (Literarisches Österreich)
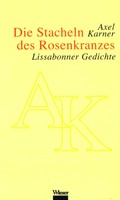
2007
Vom ersten Durchblick des Gewebes.
Axel Karners Kriminalgeschichten sind kurze Prosatexte, oftmals Miniaturen, die um menschliche Abgründe wie Mord, Gewalt, Sprachlosigkeit und Gefühllosigkeit angesiedelt sind. Seine Geschichten sind in Großbuchstaben verfasst, was nicht nur optisch sondern auch inhaltlich auf Zeitungsschlagzeilen verweist:
So bringt es die Geschichte „SEI MEIN GAST FLEISCHFRASS“ in kurzen Wort auf den Punkt: „ARMES SCHWEIN LIEGT TOT IN DER SAUCE DIE IHM GUT GESCHMECKT HAT“.
Karners Texte versuchen wach zu rütteln, auf Missstände hinzuweisen, Menschen zu hinterfragen. Obwohl im Brotberuf evangelischer Religionslehrer, zeigt sich in diesen Texten ein Axel Karner, der scheinbar im Widerspruch zu seinem Beruf steht. Doch diese Geschichten wirken verstörend, abstoßend. Sie erlauben tiefe Einblicke in Seelenbilder, die im Alltag oft nicht wahrgenommen werden oder gar nicht wahrgenommen werden wollen.
Es empfiehlt sich zudem diese Geschichten nicht nur einmal zu lesen, denn es lauern Spitzfindigkeiten in und zwischen den Zeilen versteckt: Humor und Satire ebenso wie Trauer und Gemeinheiten, wie im wirklichen Leben, nur drastischer und plakativer.
Axel Karners Kriminalgeschichten ergeben kein lautes Buch, aber ein auffälliges, bewusst oft blutiges lesenswertes Buch „Vom ersten Durchblick ... und danach“.
Von Rudolf Kraus am 09.10.2007
„Kriminalgeschichten" untertitelt der Autor Axel Karner (der Verlag?) sein Buch „Vom ersten Durchblick des Gewebes am zehnten November und danach". Das ist eine (Irre-)Führung: Dieser Band ist kein Krimi! Die Erwartungshaltung von (Mainstream) Krimilesern wird nicht erfüllt. Axel Karner geht einen andern Weg: Der Text präsentiert sich ausschließlich in Großbuchstaben und weist keine Interpunktion auf. Und: dem Autor gelingt es, eine wichtige ästhetische Maxime Friedrich Schillers zu widerlegen: „ [...] In einem wahrhaft schönen Kunstwerk soll der Inhalt nichts, die Form aber alles tun", schreibt Schiller 1801 in „Über die ästhetische Erziehung". Das trifft hier nicht zu: Form und Inhalt sind in diesem Buch eine selten ideale Symbiose eingegangen:
„ER SPUCKTE HINEIN UND HOFFTE SEIN SPEICHEL BRÄCHTE DAS MEER ZU ÜBERGEHEN DASS ER DARIN ERSAUFE DER POLIZIST ZOG IHM MIT SEINEM KNÜPPEL VON HINTEN EINS ÜBER DEN SCHÄDEL UND SPRACH SIEHE DEIN TOD IST MEINE ERLÖSUNG."
Das kommt einem irgendwie bekannt vor ..., wenn man einiges aus der Bibel kennt. Axel Karner, geboren 1955 in Zlan, Kärnten, unterrichtet Evangelische Religion. Unter anderem: Seit 1974 in Wien lebend, unterrichtet er an Wiener Pflichtschulen (auch) Darstellendes Spiel und Soziales Lernen. Womit wir beim zweiten Aspekt dieses Buches sind, dem sozialen: Karner verwebt die Sprache des menschlichen Leidens in der (historischen) christlichen Geschichte, mit dem Blut und dem Sterben des täglichen Alltags, mit jenen Ereignissen - meist menschliche Tragödien, Untergänge -, an denen wir allzu oft vorbeisehen. Der Autor spießt dabei die Missstände nicht auf, er lässt den Leser unverhofft und ahnungslos hineingleiten in die Abfallkübel der seelischen Schlachthöfe:
„... BEI DER MARKTHALLE AM FRANZJOSEFSBAHNHOF KAM IHM EIN MANN MIT ZWEI KÜBELN VOLL FLEISCHSTÜCKEN ENTGEGEN ER NICKTE IHM ZU AUF DER FRIEDENSBRÜCKE SAH ER DIE KREISSÄGE .. ." oder:
„... DENN ICH MUSS DEN KRANKEN ALTERNATIVEN ANBIETEN THERAPIEPLÄTZE NOTSCHLACHTUNGEN UND DERLEI", oder: „ES GING ALLES SEHR SCHNELL KEINE FÜNF MINUTEN SPÄTER WAR DER TISCH NEU GEDECKT SIE KÜMMERTEN SICH WEDER UM DEN REGEN NOCH UM DIE KÄLTE GEGEN MORGEN BEGANNEN DER KOCH UND DER SCHLACHTER ZU STINKEN."
Karner ist (seine!) Sprache sehr wichtig, meist geht es dabei ja um Leben und Tod: „SIE SPRACH MIT IHM NICHT IN GANZEN SÄTZEN DA ERSCHLUG ER SIE". Dieses Buch kann man nicht einfach „nur" lesen. Man muss die Texte, die einen bizarren Sog tiefer und tiefer in das Buch bewirken, auf sich einwirken, aber nicht eben auf der Zunge zergehen lassen. Axel Karner hat bereits einige Bücher vorgelegt, dieses Werk aber ragt heraus ..., und trifft hinein: ins Herz UND in die Seele. Und sollte man den 57 Seiten starken (!) Band dann aus der Hand legen, empfiehlt es sich, ihn sich möglichst bald wieder zu Gemüte - eher aber zu Gewissen - zu führen. So gelangt man (vielleicht) „Vom ersten Durchblick ..." bis „... danach".
Peter Miniböck, Podium 147-48, April 2008
An schaurigen Orten kriminellen Geschehens wird oft eine Gedenktafel aufgestellt, auf der in heftig blutigen Sätzen der Ablauf des Verbrechens im Inschriften-Stil dokumentiert wird.
Axel Karner gibt seinen Kriminalgeschichten äußerlich die Gestalt von Mahnmalen, in Blockbuchstaben läuft der kurze Text jeweils über die Seite und erinnert an Marterlen, auf denen bemerkenswerte Skurrilitäten verzeichnet sind.
Dabei sind die gut vierzig Geschichten wie in einer Kriminalsammlung zu Zyklen zusammengefasst. Ein etwas verstörter Kommissar K OTT und sein Adlatus MACHMUT sind scheinbar in privater Ermittlung unterwegs, als sie immer wieder auf Leichen stoßen, die in einem fast sakralen Ambiente ausgelegt sind. Gleich zu Beginn etwa liegt jemand wie eine Krippen-Installation unterm Weihnachtsbaum und gibt der ganzen ‚Weihnachterei‘ einen letalen Touch. Leicht schleißig ausgesprochen gibt ja auch der Name des Kommissars schon einen Hinweis, in alpinen Gegenden spricht man beispielsweise Gott durchgehend wie „Kott' aus.
Die morbide Stadt Wien liefert den Hintergrund für raunzerische Fälle, die meist in der Gastronomie angesiedelt sind. Nicht nur das Fressen selbst kann tödlich sein, auch diese absurd schwere Beisl-Kultur führt stracks in den Tod, wenn man sich nicht zwischendurch zurücknimmt. Und selbstverständlich wird alles mit dem goldenen Humor des fetten Wienerherzens ausgeschmückt. „Wenn es ums Scheißen geht, hat noch ein jeder sein Arschloch aufreißen müssen, sagte er larmoyant.' (29)
Liebe und Tod liegen in der forensischen Motivationskunde oft auf einer Ebene. Im Kapitel vom „Geliebten Mörder“ schießen denn auch Liebesbeweise oft über das Ziel hinaus und landen als Projektil im Kopf des Partners.
Axel Karners Geschichten haben manchmal etwas Erbauliches der süffisanten Art an sich, der moralisierende Zeigefinger bricht dabei lustvoll ab, noch während er ausgepackt wird. Was bleibt sind bis auf ein Sprichwort verkürzte Dialoge oder Gedankenspiralen. Das Leben ist durchaus lebensgefährlich, sobald man es in die Hand nimmt. Und die Aufklärung der Fälle bleibt meist an der Oberfläche hängen, denn das Tiefe der menschlichen und vor allem Wiener Seele, ist kaum zu durchschauen.
So erklärt sich vielleicht dieser wundersame Buchtitel vom ersten Durchblick des Gewebes am zehnten November und danach. Genau genommen lässt sich nur das Datum definitiv bestimmen, das Gewebe selbst bleibt rätselhaft und Dechiffrierungsversuche gehen ins Leere. - Kriminalgeschichten der philosophisch sarkastischen Art!
Helmuth Schönauer, 28.12.2007
http://www.biblio.at/rezensionen/details.php3?mednr[0]=pf2007568&katalog=all&anzahl=1&liststyle=tirol
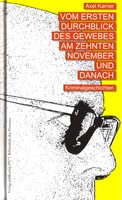
2004
schottntreiba
Gedichte
Mit Illustrationen von Ingeborg Kofler
Axel Karner, Kärntner Theologe, Lehrer, Dialektautor und Heimatverdichter in Personalunion, hat einen beeindruckenden Band moderner Mundartgedichte vorgelegt. In Karners lyrischer Welt gehen Tod und Gewalt aus und ein. „meada“, „sölbstmeada“, „ongst“, „toates kind“ sind nur einige wahllos herausgegriffene Titel. Dieses Werk fordert dem Leser einiges ab. Anstatt den aufrechten Vertretern einer heilen Bodenständigkeit begegnet man gefolterten, missbrauchten Kreaturen, Opfern ihrer selbst, aber auch jener, die immer das Aufrechte für sich in Anspruch nehmen.
Ein zeitgemäßer Expressionismus scheint für mich aus vielen der Gedichte zu sprechen:
gach amol/steaht/a schwoaze sun/aufm himml//da mond/bliaht/aus de kinda/und de weiba/vastecknd/en schottn/unta de reck
Vor der Lektüre des Buches empfiehlt es sich jedenfalls, das keineswegs erschöpfende Glossar aufzuschlagen, um sich einige, der für einen Nichtkärntner doch recht exotischen, Ausdrücke einzuprägen. Die Schreibung ist wie jede Mundartschreibung gewöhnungsbedürftig, aber hat man sich erst einmal ein- und die Texte laut mit gelesen, steht der bitteren Lesefreude nichts mehr im Wege.
Karners Schreiben hat eine seiner Hauptwurzeln im Leiden und Mitleiden. Oft leiht er Gezeichneten und Malträtierten seine Stimme – oder seinen Aufschrei:
in de haut/schreibnd se/dia eine/es tuat goa nit weah//de brennendn bana/holtnd/en otm/zruck
Ein sarkastischer Humor, so schwarz, dass er als solcher fast nicht mehr zu erkennen ist, prägt auch manche fast kubinhaft anmutenden Gedichte.
De leichntroga/woatnd/bis de fliagltian/aufgeahnd/und de leit/auswolgnd in wind//im banahaus/drinnen tonzend/de toatn/bis unta de stean
Axel Karner legt mit „Schottntreiba“ ein ungewohntes, unbequemes, schmerzhaftes Buch vor. Es wird sicher die Leserschaft spalten, denn alles Laue ist diesen Texten fremd.
Titelbild und Illustrationen stammen von Ingeborg Kofler und ergänzen in ihrer Kargheit Karners Gedichte aufs Beste.
Ein Inhaltsverzeichnis würde sicher von den meisten Lesern begrüßt.
Wolfgang Ratz, Literarisches Österreich 2/2004

2003
Kreuz
Gedichte
Mit Illustrationen von Joseph Kühn
Wo immer man den Gedichtband auch aufschlägt, man stößt auf Scherenschnitte, riesenhafte schwarz-weiße Konturen, die sich im graphischen Morphem dann doch fein ziseliert verfransen. Man erkennt beispielsweise ein Totengerippe, exakt ausgeschnitten, das auf einem Mobilar, halb Stuhl, halb Kruzifix posiert. Dabei versucht das Gerippe irgendwie den Korpus am Kreuz zu imitieren, vielleicht kratzt es sich aber nur aus Verlegenheit. Eine Krähe, absolutes Muß in der schwermütigen Lyrik, schaut dem Treiben halb gähnend zu. Diesem Scherenschnitt Joseph Kühns ist Axel Karners Gedicht "mein gott" gegenübergestellt, nicht minder schwarz-weiß, "mit dem kopf / im blut / und dem trommeln / der stiefel // bin an den tod ich gewöhnt". Text und Bild ergänzen sich hier nicht nur, sie kommen sich auch in die Quere oder kreuzen sich wie in der Vererbungslehre zu einem neuen, doppelt geschwärzten Produkt.
Axel Karners Lyrikband setzt sich aus zwei schroffen Teilen zusammen. Im ersten Teil ordnen sich die Gedichte im Sinne eines Kreuzwegs, freilich ohne die beiden letzten Erlösungsbildchen zu einer zwölfgliedrigen Orgie an Verknappung, Verzweiflung, Heilsverstümmelung und Sarkasmus. Hier ist von Schande, billigem Fleisch und unbarmherzigem Schweigen die Rede. Die Geschichte vom Kreuz wird vorgeführt wie der billigste Kreuzerlstich auf der Leinwand des Hauschmucks, die einfachen Botschaften der Kruzifixdramaturgie sind eine kleine Schraubendrehung weiter gespannt, bis an die Tragfähigkeit der Botschaften. "der mit dem kübel / stiehlt sich davon / seinen durst / im feuer ertränken" endet dieser scharf geflochtene Lyrikkranz realo-transzendent. Der gegenüberliegende Scherenschnitt spricht an dieser Stelle im Stile der Bremer Stadtmusikanten eine Botschaft mit Feuer und Schwert aus. (Die Scherenschnitte des ersten Teiles sind bis auf eine Ausnahme jeweils in ein Kruzifix eingesperrt.)
Der zweite Teil ist überschrieben mit der seltsamen Botschaft: "Das Wort ist geworden kleine Fische". Hier denkt man unwillkürlich an die saftige Formulierung des Volksmundes, wonach eine sinnlose Anweisung "für die Fisch" ist. In diesem Zyklus ist von seltsamen Umtrieben die Rede, aneinandergereiht ergeben die Überschriften einen Übersinn: "füllen / hallt / im schlachthaus / bei dem gestank / saßen / treibt / blühen / geht aus dem schlachthaus / lacht / werden sie leben / wachsen / neum jahwe". Jeder Parole folgt die Verhöhnung auf den Fuß, wer nicht sehen will, was wird der dann glauben, heißt es recht einleuchtend.
Axel Karners Gedichte arbeiten mit dem Material der Lehre vom Kruzifix, der übliche Kontext ist zerstört, statt der feierlichen Messgewänder zieren Scherenschnitte das meditative Arrangement. Das Überwort "Kreuz" ist zerlegt in religiöse und triviale Ansprüche, mal ist der Text ausgegossen wie für eine theologische Morgenbetrachtung, dann wieder eine Regieanweisung eines lyrischen Therapeuten. Dabei sind die Texte kaum länger als zehn Zeilen, die Zeilen oft zusammengeschrumpft auf einen einzigen Begriff. Wenn es in der österreichischen Epik einmal so etwas wie den negativen Heimatroman gegeben hat, worin sich durch Dekonstruktion der alten Idylle der Zustand der Peripherie herausgeschält hat, dann könnte man von Axel Karners Lyrik als "negativen Meditationen" sprechen. Auch hier ergibt sich der Sinn durch Dekonstruktion idyllischer Glaubensbildchen. - Eine interessante Zugangsweise zu unerklärlichen Dingen, und dazu ist Lyrik ja da.
Helmuth Schönauer, 12. Dezember 2003 (Originalbeitrag)
http://www.literaturhaus.at/buch/buch/rez/karner_kreuz/

1997
Georg Schurl. Mörder.
Kriminalgeschichten.
Alekto Verlag, Klagenfurt/Celovec;
Es ist wie beim Besuch des Wiener Kriminalmuseums. Von Saal zu Saal kommen einem die Gewalttaten absurder vor, gleichzeitig grausig in ihrer scheinbaren Alltäglichkeit - und alles so normal. Auch die Textminiaturen des Kärntner Autors Axel Karner fügen sich zu einem solchen paradoxen Reigen von Kriminalgeschichten. Morde - begangen aus den unterschiedlichsten Motiven und mit den verschiedensten Mitteln. Der Tod, vorwiegend der gewaltsame Tod, steht im Mittelpunkt. Karner erzählt die Geschichten mit einer sprachlichen Lakonie, die die Grausamkeit der Taten verstärkt. Denn grausam sind sie alle, sie lassen in die Welt der menschlichen Abgründe hineinblicken, ohne diese immer explizit zu machen. Die psychischen Störungen, die zur Kommunikation unfähigen Menschen, die vor Gefühlskälte abgestumpften Täter. Die Motive sind oft nur in den alltäglichen Katastrophen zu finden. Der Schritt zum Mord scheint dann ein kleiner. Als Ausweg denkbar.
Der Autor schafft es, in kurzen kompakten Sätzen unerträgliche Lebensgeschichten durchscheinen zu lassen. Nicht immer sind alle Taten psychologisch motiviert. Die Tathergänge lassen aber auf die Obsessionen, die dahinter stehen, und auf die Verzweiflung als Grundmotiv schließen. Die Tragik der Episoden wird ins Absurde gewendet, so wenn wir erfahren, dass sich der Jäger mit einer Schlinge der Vereinigten Draht und Alu AG. erhängte (S. 38). Der Autor spielt mit den an unzähligen TV-Krimis geschulten Leseerwartungen. Der Monolog eines potentiellen Täters entpuppt sich als innere Vorbereitung auf den Mord an sich selbst (S. 50). Aus verschiedenen Perspektiven wird erzählt: aus der Sicht des Täters, des Opfers, aus der Ich-Perspektive und der dritten Person. Der Leser wechselt so auch in die verschiedenen Rollen.
Die grafische Aufmachung der Texte - ohne Interpunktion, alles in Großbuchstaben - führt beim Lesen oft zu mehrdeutigen Überschneidungen. Subjekte und Handlungen können sich so verschieben und machen die Kriminalgeschichten mehrfach lesbar. Die trockene Sprache hält Distanz zum Thema: Vielleicht ist nur auf diese Weise eine Annäherung möglich. Zum Schluss ist es doch mehr wie ein Besuch im Gruselkabinett.
Ivette Löcker, Literaturhaus Wien 16. Juli 1998
www.literaturhaus.at/buch/buch/rez/axkarner/
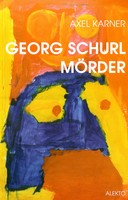
1995
A ongnoglts kind
Gedichte.
Alekto Verlag, Klagenfurt/Celovec
Pechschwarze Tinte. Zu den Dialektgedichten des Kärntners Axel Karner
Er stammt aus Oberkärnten – aus jener Region, die ein Josef Winkler schon vor Jahren in mehreren Romanen vorgeführt und über deren touristischen Ausverkauf ein Bernhard C. Bünker – ebenfalls schon vor Jahren – in etlichen Dialektgedichten gewettert hat.
Der 1955 in Zlan geborene Axel Karner lebt heute in Wien, seine Gedichte aber handeln allesamt von der „Kärntner Heimat“ von ihren Schrecken und Heimlichkeiten.
„ka scheanas lond/hot iba nocht/so vül hamlichkeiten/…/ka scheanas lond/konn/so vül stüll sein“ hieß es 1991 in Karners Debütband „a meada is aa lei a mensch“. Mit dieser Sammlung von Dialektgedichten war Karner gegen ewiggestrige Heimattümelei, provinzielle Intoleranz, und ländliche Brutalität zu Felde gezogen. Die Dorfgemeinschaft – eine Schar gemeiner Schläger und Schlächter. „Dazu eine „Kärntner Dreigewaltigkeit“ aus Fremdenverkehr, Deutschtum und Fremdenhaß. Karners Debüt war eine poetische Gewaltkur gegen Heimattümelei, mit der es ihrem Autor gelungen war, das in den letzten Jahren sanft entschlafene Genre der „neuen“ oder „kritischen“ Dialektdichtung wiederzubeleben.
Nach vier Jahren ist jetzt ein zweiter, schmaler Gedichtband Axel Karners erschienen. „a ongnoglts kind“ (Ein angenageltes Kind), so der Titel, enthält drei Gedichtzyklen – „schra“ (Schrei), „opfa“ (Opfer) und „bliah“ (Blüte)-, mit denen Karner scheinbar nahtlos an seinen Erstling anknüpft. „follnd/feiarote stean/vom himml/in meina hond/a toate bliah.“ Pechschwarze Untergangsvisionen und Todesphantasien, Geschichten über Mörder und Selbstmörder machen aus dem ländlichen Idyll eine auswegslose Folterkammer, in der jeder unters Messer kommt: „stüll tuand se/ans nochanonda/stechend de frau ob/des kind/donn de viecha/schneidnd en äpflbam um/stüll tuast/ans nochanonda.“
Von einer – wie auch immer gearteten – „kritischen Heimatverbundenheit“, die ja das ungeschriebene und immer wieder beschworene Gesetz der „neuen“ Dialektdichtung der 70er und 80er Jahre gewesen ist, ist bei Axel Karner nichts zu bemerken. Tod und Verwesung, Gewalt und Verzweiflung sind die Motive dieser Gedichte.
„eingfongen/de kinda/und aufgfiattat/im trog/se vakafnd/es aufgschwemmte fleisch/ohne kepf“.
War Karners Erstling in gewisser Weise auch ein programmatischer Versuch, eine persönliche und literarische Standortbestimmung fernab von Heimat und Heimatdichtung – einer der Gedichtzyklen hieß „de hamat“ – so wird man programmatische Texte in seinem neuen Buch vergeblich suchen. Die Gedichte sind noch knapper und sparsamer, noch dunkler und makabrer.
„gestan/is a auto/kemmen/ongfüllt mit kinda/steig ein do/weast hamgfiaht/a wolkn aus gas.“
Axel Karner funktioniert nach filmischen Gesetzen, eigentlich sind es hart und schnell geschnittene VideoClips, schwarzweiß, mit immer wiederkehrenden, bedrohlichen Standbildern. Die literarische Tradition, an die Karner anknüpft, ist nicht die der kritisch-engagierten Dialektdichtung der letzten Jahrzehnte, eher die der „Wiener Gruppe“. Hier schreibt einer mit pechschwarzer „dintn“.
Gerhard Moser, Literatur und Kritik 12/1995

1991
A meada is aa lei a mensch
Gedichte.
Alekto Verlag, Klagenfurt/Celovec;
Gewaltkur gegen Heimattümelei
„ka scheanas lond/hot iba nocht/so vül hamlichkeiten/…/ka scheanas lond/konn/so vül stüll sein.“
Das schöne Land heißt Kärnten, und von seinen Heimlichkeiten ist in einem eben erschienenen Gedichtband des Wahlwieners Axel Karner die Rede. a meada is aa lei a mensch, Karner lyrisches Debüt, ist wohl das makaberste Stück Dialektdichtung der letzten Jahre.
„de hamat“, „die meada“, „da toad“ – mit diesen drei Gedichtzyklen zieht der gebürtige Kärntner Karner gegen Heimattümelei, Intoleranz und Brutalität zu Felde.
Stickige Landluft
Da ist die Rede von der „Kärntner Dreigewaltigkeit“, die sich aus Fremdenhass, Deutschtum und Fremdenverkehr zusammensetzt; da führt die Landluft zu Erstickungsanfällen, und die Dorfgemeinschaft stellt sich als schar gemeiner Schläger und Schlächter dar: „es wead noch/vül/schiacha sein“, heißt es in Karners Gedicht „gwolt I“, „se weand da/ols lebendiga/de haut obziagn/aus de zähnd/stana brechn/und mitn fleisch/ziagl brennen/noach east/treibns di in kotta/und tuand da/liab.“
Gewalt und Gewalttaten, Mord und Selbstmord stehen im Zentrum dieser knappen, ausgefeilten und pechschwarzen Gedichte, mit denen sich Axel Karner nicht nur über Kärnten hinaus schreibt, sondern mit denen er auch den stillen Konsens der neuen Dialektdichtung bricht: den einer „kritischen Heimatverbundenheit“, wie auch immer diese aussehen mag.
Mit analytischer Präzision blickt Karner hinter die Schlagworte von Folklorismus und touristischem Ausverkauf, stellt die Dumpfheit und menschenverachtende Brutalität des Landlebens bloß.
Todes-Poesie
Rührseligkeit und Geschwätzigkeit – Markenzeichen der traditionellen Mundartdichtung aber auch des öfteren der neuen Dialektdichtung – sind seinen Gedichten fremd. Wo die Worte verdorren und die Bilder auf zerbissenen Lippen stehen bleiben, wie es in einem Gedicht sinngemäß heißt, bleibt kein Platz für eitles Parlando.
Axel Karner nennt sich selbst einer „Apokalyptiker mit Augenzwinkern“; und ein Gutteil dieses Gedichtbands hat den Tod zum Thema. Weniger Melancholie als vielmehr verzweifelnder Sarkasmus prägen diese persönlichen und kollektiven Untergangsvisionen, die einen öfters an die frühen Dialektgedichte der „Wiener Gruppe“ erinnern:
„in mein zimma/gonz allan/hänk i/am fensta/und da strick/drahtn vuahong/longsom/um de zechn.“, heißt es im Gedicht „sölbstmeada II“.
Axel Karners Gedichtband a meada is aa lei a mensch ist ein bislang viel zu wenig beachtetes literarisches Debüt: Eine Gewaltkur gegen Heimattümelei, aber auch ein Wiederbelebungsversuch der etwas träge gewordenen Gilde hiesiger Dialektdichter.
Gerhard Moser, Der Standard 11.12.1992