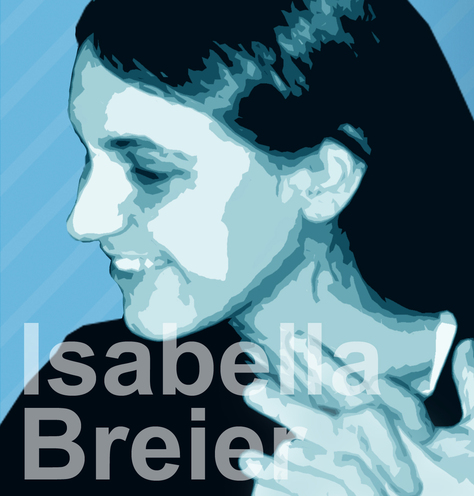Gewählter Autor: Isabella Breier
Isabella Breier
Bibliographie
2008
Interferenzen
Der Erzählband „Interferenzen“ pendelt um Dissonanzen zwischen Innen- und Außenwelt, Faktizität und Imagination, erzählt von ernsthaften wie halbherzigen Bestrebungen, andere zu verstehen, von der Schwierigkeit, sich selbst zu begreifen, dem, was man empfindet, sich zusammenreimt, vor sich hin denkt, einen Namen zu geben, mit der Welt zurechtzukommen, sich Klarheit zu verschaffen: Texte von Überlappungen, vom Hin- und Her-, vom Weglaufen, im weitesten Sinn. Vordergründig geht es in einigen der Texte um altbewährte Problematiken, die aus der Perspektive diverser (meist weiblicher) Ichs geschildert, konstruiert, verfremdet, vermischt werden: Begehren, Freundschaft, Verantwortung, Schuldgefühl, Absonderung u.ä.m. Der Großteil der Geschichten lässt sich allerdings nicht als „Nabelbeschau“ oder „Lifestyleskizze“ bezeichnen, sind die sozialpolitischen Rahmen, in die sich jeweilige Handlungen als Bilder einbetten, mitunter sehr deutlich und trotz zahlreicher Traumsequenzen, absurder Aspekte bzw. ironisierend grotesker Passagen äußerst realistisch.
Etliche Texte handeln von prekären Arbeits-, Lebensverhältnissen. „Ziel“ des Prosabandes - ist es auch, im Konkreten Allgemeines zu spiegeln bzw. jenes, was der Autor dafür hält. Was die äußere/innere Struktur anbelangt, so soll das Buch aus sowohl eher experimentellen als auch konventionell konzipierten Erzählungen bestehen, die auf personaler Ebene geflechtartig ineinander übergreifen. Das Personeninventar kehrt mittels anderer Perspektiven, in verschiedenen Kontexten, neuen Konstellationen in allen Texten wieder. Zueinander in Relation gesetzt zeigen diese eine Art Kosmos von Lebenswelten.
„(...) schon der Titel Interferenzen erläutert das Erzählprogramm, denn eine Interferenz ist physikalisch gesehen eine Überlagerung von zwei Wellen und sprachlich gesehen die Übertragung von einer Sprachstruktur auf die andere. Die 44 Prosa-Partikel lassen sich einerseits lesen wie eine Kurzgeschichtensammlung zu markanten Ereignissen, andererseits hängen diese Teile wieder rhizom-artig zusammen, eine Erzählung verschwindet plötzlich und taucht an anderer Stelle wieder unerwartet auf. (...) Die Figuren haben alle ein Dilemma: Wenn sie den Sachverhalt auf die Reihe kriegen, ist der Erlebnisinhalt weg, und lassen sie diesem freien Lauf, lässt sich nichts mehr so ausdrücken wie es nützlich wäre. (...) Und trotz des sozial rauen Tones sind die Erzählungen voller feinfühliger Poesie. (...) Isabella Breier gelingt etwas schier Unmögliches: sie legt jeweils Interferenzen zwischen einer hochintellektuellen Theorie und der griffig spannenden Darstellung im gewöhnlichen Leben.“ („Buchkultur“)
„(...) Unterhaltsame, mit leicht angeschrägten Passagen angerichtete Geschichten, die sich hauptsächlich im Dunstkreis des Hauses, des Auslandes und des Flohmarktes verteilen. (...)“ (E. Wurzenrainer, „DUM“)
„Isabella Breier vermengt und verfremdet die Sichtweisen ihrer meist weiblichen Protagonisten, die in Alltags- und Arbeitsverhältnisse eingebunden sind. Empfindungen, Gedanken sowie auch Betrachtungen stehen im Vordergrund der Geschichten, eingebettet in realistische Vorstellungsweisen mit grotesken und/oder skurrilen Zügen. (...) Breier vermischt experimentelle Texte mit konventionellen Erzählungen, wobei ihre Beschäftigung mit philosophischen, soziologischen Themen und Ansätzen durchaus spür- und lesbar ist.“ (R. Kraus, „Bücherschau“)
„Salopp gesprochen tritt eine Überlagerung von (tatsächlich) Stattgefundenem und („bloß“) Gedachtem als Kernelement auf. An und für sich wird diese Differenz auf formalem Gebiet mittels Absätze ausgedrückt. Das trägt jedoch nicht zur Erleichterung bei, denn der Text wird von einer nach vorwärts strebenden Sprache mitgetragen, mitgerissen, so dass der Rezipient den Absatz meist gar nicht als Trennung wahrnimmt, sondern seine Funktion brüsk ignoriert und einfach nur weiter lesen möchte. Die Autorin vermag redlich in ihren Bann zu ziehen. Wie macht sie das? (...) Breier hält sich mit keiner Vorgeschichte auf. Wenn man sagt, dass sie sich stattdessen von Beginn an auf Geschehnisse konzentriert, so zeugt dies ebenso von einem übereiligen Definitionsdrang. Nicht nur, dass Breier keine Geschehnisse erzählt: Es geht ihr überhaupt um etwas Anderes – um Wahrnehmungen. Man tut ihr ebenso nichts Gutes, unterstellt man ihr reine Wahrnehmungsschilderungen. Sie schildert keineswegs innere und äußere Zustände ihrer Figuren. Den traditionellen Erzähler hat sie verschluckt. (...) Wirklichkeit und Möglichkeit gehen ineinander über und zwar dermaßen übergangslos, dass zwischen ihnen nicht mehr unterschieden werden kann. So entsteht die Wirkung eines In-Frage-Stellens beider, ansonsten gründlich voneinander getrennten Komponenten. (...) Diese Verstrickungen sind virtuos zusammengeführt. (...)“ (D. Pölzl)

2007
101 Käfer in der Schachtel
Die Geschichte umkreist eine in all ihren Facetten politische Liebesbeziehung - in Gegenwartsreflexionen wie aus der Retrospektive, d.h. nach beendeter Liaison. Implizit zeigt sie eine Art Lebensentwicklungsabriss der Protagonistin. Rollenprosa, könnte man sagen, wenn es nicht genau darum ginge, in ironischer Selbstverständlichkeit diese Rollen aufzuheben, zum Verschwinden zu bringen. Noch immer mit dem wieder nach Kaschmir zurückgekehrten Ex in freundschaftlichem unregelmäßigen telefonischen wie e-mail-Kontakt, schreibt sich ein mitteleuropäisches weibliches namenloses Ich an seine oftmals wirren Erinnerungsspuren heran, verleiht ihnen eine Bedeutung, die nicht auf den Punkt zurechtgestutzt, vielmehr in zahlreiche Bausteine zersplittert wird. Die in 101 Einzelfragmente gegliederte Erzählung enthält oder streift scheinbar beiläufig philosophische Motive - etwa das Problem der Abgeschiedenheit und Ungewissheit des Ich, Textualitäten der Anderheit, des Begehrens, der Zeitlichkeit - , die bei der Lektüre als roter Faden dienen können, aber nicht müssen. Sie bietet mehrere Ebenen, bricht sich in Schleifen auf, die sich sozusagen unter der Hand wieder ineinander verflechten. Jedes Bild, jede Textpartie steht für sich und doch nicht abgekapselt. Lyrische Liebes- und spannende Aufdeckungsgeschichte und bewusst ausufernde Reflexionsprosa: eine in der linken Szene angesiedelte Beziehung zwischen einer ehemals politisch engagierten, berufstätigen Frau Anfang 30 und einem um siebzehn Jahre älteren Journalisten, der im pakistanisch besetzten Teil Kaschmirs zwar geboren wurde und dort seine frühe Kindheit verbrachte, allerdings - schon als Schulkind nach London gezogen - hauptsächlich eine von westlichen Standards geprägte Sozialisation erfuhr. Im Zentrum steht die weibliche Person, aus deren Perspektive die Episoden und Gespräche erzählt werden, mehr noch, ihr Versuch, zu verstehen: die Auflösung von Nähe, der Zusammenbruch des Vertrauens oder eher ein sukzessives Schrumpfen, das Verschwinden als Lebensgefühl, letztlich wieder der Zweifel am Urteilsvermögen oder seiner Verlässlichkeit, sogar die Unsicherheit in Bezug auf das eigene Erleben und Wahrnehmen.
„Der Ort des Verschwindens ist ein Moment, ist keiner, zerfällt in viele, senkt sich in eine Welt vor mir, die Zeit, an die ich mich nicht erinnern kann, und streckt sich weit aus, tastet an mir vorbei. Atmosphärisch dicht fühlt sich die Leere an, und die Leere ist doch nur ein Wort, sagen sie.“
„(...) „101 Käfer in der Schachtel“ ist ein Buch für Liebhaber der politischen und gesellschaftlichen Diskussion, vermengt mit dem Bericht einer ungewöhnlichen Liebesbeziehung. Nicht leicht zu lesen, aber dafür wirklich gehaltvoll.“
(Manuela Kaltenegger, „Bücherschau“)
„Isabella Breier stellt mit ihrer „Käfersammlung“ einen dichten, leidenschaftlichen, philosophisch fein ausgeloteten Roman auf die Füße, der vergessen macht, dass es in der Liebe manchmal trivial und alltäglich zugeht. Hier entwickelt sich vor den Augen des Lesers eine Lebenslust, die durchaus zu haptischen Aufgriffen fähig ist, sich aber über lange Passagen an die Leidenschaft hält, welche entsteht, wenn man den Gedanken freien Lauf lässt.“
(H.Schönauer, „Lesen in Tirol“)

2006
Dimensionen menschlicher Sinnstiftung in der Praxis
Zwischen Erkenntnis- und Kulturtheorie: Zur Poiesis, Ethik und Ästhetik in Cassirers Philosophie der symbolischen Formen und Wittgensteins Sprachspielbetrachtungen
Reihe: Hochschulschriften