Gewählter Autor: Ulrike Draesner
Ulrike Draesner
Bibliographie
2010
Beitrag in: KEIN THEMA
FIXPOETRY Leseheft 26
herausgegeben von Julietta Fix und Frank Milautzcki
Jörg Bernig, Volker Demuth, Ulrike Draesner, Bess Dreyer, Marius Hulpe, Angelika Janz, Sabina Lorenz, Jürgen Nendza, Hellmuth Opitz, Elisabeth Wandeler-Deck, Michael Wildenhain und Uljana Wolf.

2010
Vorliebe
Die Liebe ist eine Wissenschaft für sich
Ein Wiedersehen, das einschlägt wie ein Blitz: plötzlich steht die Astrophysikerin Harriet ihrer großen Liebe von einst gegenüber. Und allmählich, aber unaufhaltsam, gerät ihr bisheriges Leben aus seiner geordneten Umlaufbahn.
Harriet, halbindisch, mathematikbegeistert, macht in ihrem Beruf aus wissenschaftlichen Daten schöne kosmische Bilder, ein wenig Lüge darf dabei schon sein. Auch zuhause scheint alles gut eingerichtet mit Partner Ash und Ben, dessen Sohn aus einer früheren Beziehung. Doch dann fährt Ash mit dem Auto ausgerechnet die Frau von Harriets Jugendliebe an, und Peter, der Mann, den sie längst vergessen zu haben glaubte, tritt von neuem in ihr Leben. Ein vermeintlich harmloses Liebesgetändel beginnt: Man ist ja offen, Heimlichkeiten und Eifersucht sind antiquiert, man verhält sich den Klischees der Gefühlswelt gegenüber abgeklärt. Doch Ulrike Draesner schickt die Heldinnen und Helden ihres neuen Romans auf wunderbar verspielte Weise in ein irrlichterndes Labyrinth aus romantischen Verwicklungen, das eine der Figuren nicht lebend verlassen wird.
"Selten wurde ein Liebesdrama mit so viel Sprachwitz und Eleganz erzählt."
Frankfurter Allgemeine Zeitung (29.01.2010)

2009
Kästchengeschichten
J O H A N N P E T E R H E B E L
Ausgewählt, neu gelesen und literarisch beleuchtet von Ulrike Draesner

2008
berührte orte
Reisen: eine Lust. Ein Abenteuer. Ein Irrsinn. Wie lange braucht man, um zu lernen, wie ein Kamel auf Fersen zum Pool zu gehen? Zu verstehen, dass „Cbrt rntl“ Cabaret oriental heißen soll? Auf welchen Wegen nähert man sich Orten, an denen es nach Schweiß riecht, nach Feuer, Mensch und tierischer Angst?
Ulrike Draesners Gedichte: Das sind immer schon Reisen, Expeditionen in die Zentren der Wahrnehmung, in die Grenzzonen des Körpers und in eine plötzlich leuchtende Außenwelt. In „berührte orte“ wirft Draesner das sprachliche Netz nach wirklich bereisten Orten aus, fischt nach den historischen, religiösen und medialen Phantasmen von Städten wie Damaskus oder Casablanca und lässt deren Wirklichkeit die Sprache in Schwingung versetzen. Wie fängt man es ein, dieses verrückt machende süßluftige Aroma aus – nichts? Kluge Beobachtung, der Mut, sich Fremdem zu öffnen, gehören dafür ebenso zum Handwerkszeug wie der findige Umgang mit Sprache und Dichtungstradition. Auch Städte, die dem gemeinen Mitteleuropäer näher zu sein scheinen, kartografiert der Gedichtband: Mit Lessings Wald und Brechts Dänemark wird der leidigen, glückvollen Beziehung von Ort und Wort nachgeforscht. Doch wer vom Reisen spricht, darf die Bewegungslosigkeit nicht verschweigen: inmitten der „berührten orte“ findet sich eine Hymne an den Bürodrehstuhl.
"Offen, spielerisch, begabt mit allen Sinnen und in einem unablässigen Austausch von Außen- und Innenwelt."
Die Welt

2008
gedächtnisschleifen
Gedichte
(wieder aufgelegt 2008)
»gedächtnisschleifen« – in lockeren Schlaufen, kreisenden Bewegungen werden Materialien der Erinnerung zusammengetragen; sie stammen oft von weither, aus der Nachkriegszeit, aus der Kindheit, oder von ganz nahe, aus unserem Körper, unserem Wünschen. Die Wörter sind vieldeutig, sie werden aufgebrochen und angekratzt, bis sie auf irritierende, verführerische Art zu schillern anfangen und sich zum Hauptthema des Bandes fügen: Es heißt Abschied und Erinnerung, Ende und Anfang der Liebe.
»Eine Welt im Taumel. Nein, mit diesen Gedichten wird man nicht fertig, zu vieles rühren sie auf, zu vieles ziehen sie in ihr Magnetfeld.«

2007
Spiele
Die literarische Variante von Spielbergs Film „Munich“
1972 wurde mit der Geiselnahme der israelischen Sportler die demonstrative Weltoffenheit der olympischen Sommerspiele aufs Brutalste torpediert. 1972 war aber auch das Jahr, in dem Katja erwachsen wurde und ihre erste Liebe sie verriet und von ihr verraten wurde. 20 Jahre später beginnt für Katja eine immer dringlicher werdende Suche nach dem, was damals wirklich geschah. Und es zeigt sich, wie sehr die private Geschichte mit der großen, politischen zusammenhängt.
"Ein irres Buch (…) ein rasanter Erzählstrom. Man legt das Buch jetzt nicht mehr aus der Hand."
Die Zeit

2007
Schöne Frauen lesen
Eine persönliche Literaturgeschichte von einer der interessantesten Schriftstellerinnen ihrer Generation.
Wir glauben sie alle zu kennen: Droste-Hülshoff, Virginia Woolf oder Ingeborg Bachmann, denn sie sind Ikonen der Literatur. Aber kennen wir auch ihr Werk? Ulrike Draesner versammelt Autorinnen, die für sie als Leserin und Schreibende wichtig sind, bringt sie uns auf klarsichtige und intelligente Weise näher und untersucht, inwieweit deren Werke für ein heutiges Schreiben relevant sind. Und sie zeigt, wie sehr die „schreibende Frau“ auch immer ein Skandal war, schön und schräg, beängstigend und verwirrend zugleich.
"Wer Essays schreibt, sollte nicht nur schreiben, sondern auch denken können. Und beides mit Eleganz. Wie so etwas aussehen kann, zeigt die Lyrikerin und Prosaautorin Ulrike Draesner in ihrem nun vorliegenden Essayband."
Deutschlandradio Kultur

2007
Zauber im Zoo,
Bamberger Poetikvorlesungen, Wallstein, Göttingen
2006
mittwinter
Gedichtzyklus, Quetsche, Witzwort
2006
Hotdogs
Der Kampf eines kleinen überzüchteten Hundes mit der Urgewalt eines Raben; die ersten zärtlichen Berührungen, als beim Besuch des Atombunkers der Strom ausfällt – und immer wieder diese schreckliche Katastrophe, die Begierde heißt: Zwölf Erzählungen, die zielsicher mitten in Bauch und Kopf unserer übermütigen und manchmal so unterhaltsam verzweifelten Gegenwart treffen.
"Samenräuberin Gina konserviert gewissenhaft das Ejakulat ihrer Liebhaber, Nachbar Zack züchtet in seinen engen vier Wänden Pitbulls. Messerscharf seziert die Berlinerin Draesner in zwölf intelligenten und witzigen Erzählungen seelische Abgründe."
woman
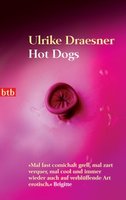
2005
Kugelblitz
Der neue Gedichtband von Ulrike Draesner über das kostbarste menschliche Gefühl und über die Schauplätze, zu denen es führt: lieben, kriegen, später. Mit großem Bildreichtum, mit frappierender musikalischer Intensität loten Ulrike Draesners neue Gedichte die Möglichkeiten sinnlichen Sprechens aus.
"Diese Lyrik macht den Leser reich."
Frankfurter Rundschau
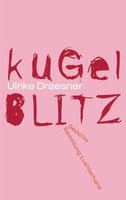
2005
Mitgift
Bedingungslose Hingabe an ihren Freund ist Aloes Wunsch. Aber Lukas, Astronom von Beruf, denkt in intergalaktischen Entfernungen, weniger in alltäglicher Nähe. Und Aloe, so aufgeklärt sie ist, leidet unter den Heimlichkeiten ihrer Kindheit: Was verbirgt sich hinter der seltsamen Schönheit ihrer Schwester? Wenn sie mehr und mehr abnimmt, kann Aloe aussehen wie die Schwester, vielleicht kann Aloe dann auch fühlen wie sie.
"Einer der intelligentesten Romane dieser Jahre."
NZZ
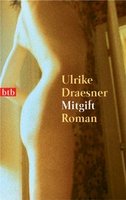
2001
für die nacht geheuerte zellen
Gedichte
Ulrike Draesners Gedichte handeln vom Alltag, von Liebe und Natur, von der Stadt. Sie spielen mit Formen der Dichtungstradition. Das Staunen über die Vielfältigkeit dieser Welt und ihre Gesetze, über ihre Vergangenheit und die abenteuerliche Zukunft der »schweren Körper« in ihr, setzt sich um in eine aus Rhythmus und Wortklang kombinierte zweite Stimme der Gedichte – eine Art innere Musik.
"Diese Lyrik macht den Leser reich."
Frankfurter Rundschau
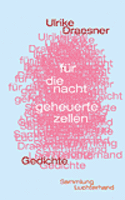
1999
Reisen unter den Augenlidern
Zehn Erzählungen
Ritter Verlag
Horror vacui
Ulrike Draesners lyrische Prosa
von Beatrix Langner
Wie eine Sintflut nach staubiger Dürre schwappen Ulrike Draesners Texte in die deutschen Sprachebenen. Nach dem Lyrikband "gedächtnisschleifen" (1995) und dem Roman "Lichtpause" (1998) sind es nun zehn Prosa-Etüden, die diesem erstaunlichen poetischen Temperament Schleusen und Dämme öffnen. Streng formale natürlich, das versteht sich fast von selbst. Ulrike Draesner erzählt nicht, beschreibt nicht, berichtet nicht. Ihre Prosa ist Lyrik im Blocksatz. Ihre Sprache ist Ur-Element, dessen Kraft aus Konzentration, aus der Verdichtung des Realitätskerns kommt. Wirklichkeit ist nicht die res extensa der alten Philosophen, nicht die ausgedehnte Leere der zeitgenössischen Romanliteratur, sondern das postmodernistisch Eingekochte. Je kompakter, um so explosiver.
Die neuen Texte, "Reisen unter den Augenlidern" überschrieben, sind Psychodramen, neurolinguistische Innenansichten mit Thriller-Qualitäten. Die Ultraschallvision einer Frühschwangerschaft aus Zellkernperspektive beispielsweise. Oder ein Beziehungsmyzel aus (mindestens) zwei Frauen, einem Mann, einem abgetriebenen Kind und irgend etwas unausdenkbar Furchtbarem, das sich zwischen Bad und Wohnzimmer einer Mietwohnung abspielt und entfernt an Hitchcocks Duschvorhangszene erinnert. Oder die gelungene Studie einer Magersüchtigen, die an ihrem eigenen Verschwinden arbeitet, oder die redundante Klage der fetten Frau, die durch Verdoppelung ihres Ich ihr Lebendgewicht zu reduzieren hofft.
Identität als ontologischer Holzweg: Jeder Versuch, das Ich am Körper festzumachen, ist aberwitzig sobald Identität phänomenologisch als Zweigestalt auftritt, Zwilling genannt (L x L). Die Rezensentin muss an dieser Stelle gestehen, dass sie stolz war, einige dieser Geschichten entziffert zu haben. Andere blieben ihr enigmatisch. "Unter der Rattenwelt liegt die Mauswelt" ist so ein hermetischer Text, in dem der Realitätskern verdampft ist. Die Draesner-Welt als Druckkessel - geschlossener Kreislauf von Sprache und Körper. Der Körper wird Ding, reine Substanz. Versprachlichung der Identität als Dauerschmerz, Verschwinden des Subjekts in der Sprache: die Verbalanästhesie gelingt (zum Glück) nicht volkommen. Ein Rest Realität bleibt immer, der weh tut. Die Angst vor der Stille, horror vacui, vor dem unbezeichneten Nichts, dem banalen deutungslosen Zeichen, schäumt diese Sprache hoch auf. Sie ist wie Pfeifen im Dunkel. Aber man hört ihr begeistert zu.
NZZ, 28. September 1999
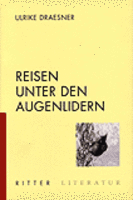
1998
Lichtpause
Roman
Volk & Welt 1998
Hilde, eine Zurichtung
Lichtpause, Lichtblick: Ulrike Draesners Debüt als Romanautorin
von Christiana Engelmann
"Da Lyrik offenbar ihr natürlicher Ausdruck ist, wehe uns, wenn sie mit Prosa kommt, dann hätte sie ja beides", prophezeit ein Rezensent, als ihr Gedichtband gedächtnisschleifen 1995 erscheint. Mit Lichtpause hat die 35jährige Lyrikerin Ulrike Draesner jetzt ihren ersten Roman vorgelegt, und weil die Lyrikerin und die Erzählerin so gut zusammenarbeiten in diesem Roman einer Kindheit, ist ihr Blick auf eine Durchschnittsfamilie in ländlich-katholischem Umfeld so ungewöhnlich.
Die frühen sechziger Jahre sind noch Lichtjahre von Achtundsechzig entfernt und die Umstände nur zu bekannt: Der Vater, Architekt und Herrscher im Haus, arbeitet im Bauboom Tag und Nacht, "nur für die Familie". Er liebt gerade Linien, Fleisch und Beton; die Mutter legt sich krumm, lenkt die Gefühle der Kinder (ihr habt eine schöne Kindheit!) und "schneidet die Wahrheit, so daß sie in den Kopf des Vaters paßt". Wie im Tierreich ist er schön, sie grau und anspruchslos, Tochter Hilde das Kuckucksei.
Die beiden, von der Tochter "das Elt" genannt, "brüten auf ihr und werfen die Schatten ihrer schwarz-weiß-gesprenkelten Ideen und Absichten" auf sie. Du sollst mein Abbild oder gar nicht sein, lautet der väterliche Auftrag. Nur zu gern hätte das Kind den Vaterwunsch erfüllt, aber das Kind ist ein Mädchen und zudem als solches ihr Geld nicht wert: dick, gescheit und eine "häßliche Brillenschlange". So wie die Lichtpausenmaschine die Entwürfe des Vaters abpaust, würde sich Hilde am liebsten nach seinem Bild vervielfältigen, doch in ihren Träumen kommt sie immer am falschen Ende heraus.
Nur eine Lesart von vielen ist die Abrechnung mit der schwarzen Pädagogik der Nachkriegszeit, der ungeheuerlichen Normalität einer lieblosen Kindheit. Zentral ist die Erfahrung einer fundamentalen Fremdheit. In keinem Punkt der Welt kann Hilde sich wiederfinden, so eng ist das Spektrum möglicher Identifikationen: Vaters wilde Hilde, Mutters "Dienstkind" oder Barbie kann sie nicht sein. Am ehesten erkennt sie sich noch im Los des Jungviehs, "demütig" und "zum Aufschauen" gezüchtet; in der Schule ist sie "williges Füllhorn". So wird der dicke Mädchenkörper zur Metapher für eine Identitätsverweigerung. In Traumschüben erscheint dem Kind die Wahl zwischen Anpassung und Widerstand im Bild des gehetzten Einhorns, das entweder in einen Käfig gesperrt und domestiziert oder von Hunden zerfetzt wird, woran es dann selbst schuld ist.
Weiblichkeit ist in dieser Welt rundum defizitär, "gekrümmt" und minderwertig, nahe dem Tierreich. "Die katholische Großmutter preßte schließlich zehn lebendige Kinder aus sich heraus, die alle an der Zitze hingen." Doch hier erlöst Sprache nicht aus der dumpfen Existenz, sondern schreibt sie fest, schreibt das Außen dem Innen ein. Gesagtes und Ungesagtes prägen die Atmosphäre. Das Kind Hilde ist "wie eine Spule, auf die sich die Sprache von z bis a aufspult", wie ein Korsett, das die Organe abdrückt. Für die erwachsene Hilde scheint Sprache, paradoxerweise, lebensrettend zu sein.
Der Leserin, dem Leser spult sich die Sprache dieser Kindheit allerdings so leicht nicht auf. Man muß sich den Weg durch das dichte Neuland sprachlicher Figuren erst bahnen, durch die Zeitsprünge, rätselhaften Verknüpfungen und die vielen Wortschöpfungen. Leichthändig verdichtet Draesner komplizierte Gefüge im treffenden Bild: Hildes "Abhängigkeitsfüße" stehen unter dem "Vatertisch", die Familie fährt "im Schwitzkasten der Vateridee" in Urlaub. In ungewöhnlicher Perspektive wird wie von außen und innen zugleich erzählt: "Ich bin damals und heute. Wenn ich will, hat sich die Perspektive wegerfunden", flüstert die Stimme, die sich nach dem "Unfall" auf den vergessenen Speicher rettet und als zweites Ich weiterlebt - eine narrative Strategie im Gewand einer Kinderfantasie.
"Manchmal schlüpfe ich in das Sehen-wie-früher", lockt das Ich. Und das ist tatsächlich keine leere Versprechung. Es ist die Leistung dieser virtuosen Sprachspiele, der mal kühlen, mal poetischen Tonlagen, daß sie dem kindlichen Wahrnehmen ganz nahe kommen, Kinderlogik, Ängste, Ohnmacht, Komik werden unmittelbar Sprache, ohne Naivität zu simulieren, in schlichten, zerhackten oder verdrehten Perioden, in expressionistischen Bildern, archaischer Verkehrung von Ursache und Wirkung - oder einfach so: "Eine Kuh hat zwei Enden. Vorn fließt die Wiese hinein, hinten wird sie wieder ausgespuckt." Körperteile schlingern durch die im Dauerschrecken zerplatzte Welt, allen vertraut, nur Hilde nicht. Der "Mund" schreit sie an, die Augen "biegen sich weg", "aus der Mutter fällt neues Schwesterfleisch". Nur einmal, als der Vater sie trägt, "hängt plötzlich alles zusammen". Die Mutter: "Wir sind eine gesunde Familie".
Natürlich liest sich Draesners Roman auch wie die hochliterarische Bewältigung einer Kindheit. Doch nur das Klima jener Zeit habe sie genau so erlebt, sagt die Autorin, fast alles andere sei frei erfunden. Für den Leser jedenfalls ist es ein wahrer Lichtblick zu erfahren, wie Sprache es vermag, die Automatismen der Wahrnehmung aufzubrechen und ihre eigenen Grenzen zu verrücken.
Tagesspiegel, 6. September 1998
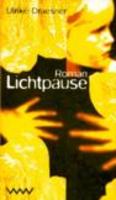
1997
anis-o-trop
Sonettkranz
Rospo Verlag 1997
Fluchtwege aus dem Maul der Echse
Wortwirbel und Formkraft: Ulrike Draesner
von Dorothea von Törne
...
Welches poetische Muster ist schwieriger zu meistern als der Sonettenkranz, bei dem das jeweils nächste Gedicht die letzte Zeile des vorigen wieder aufgreift und dessen letztes, fünfzehntes Sonett aus den Anfangszeilen der vierzehn vorausgegangenen besteht? Die Reime hat Ulrike Draesner aufgelöst zugunsten anderer Sprachklänge: Assonanzen und Alliterationen. Ein wohltönendes, durchkomponiertes System ist so entstanden, ein virtuoses Sprachspiel. Es setzt der Ästehtik des Verfalls, der Trauer und der Vergeblichkeit allen Tuns eine Grenze durch Form. Die wirkt wie ein Halt angesichts des Kernsatzes "... in wirklichkeit ist es zu spät, um zu wissen, ob man / im maul der echse - ist".
Der Zyklus verfolgt die Prozeß des sanften Sinterns von Wasser durch Mauern im Keller eines verlassenen Hotels. Adjektive des Zerfalls werden gehäuft, variiert, aufgelöst und wieder aufgenommen. Sie umkreisen Strömungen, die auf inner Welten deuten: unbenutzt, bröckelnd, zerschlagen, geborsten, rattendurchsetzt, unbetreten, erstarrt, vergessen, leer, spurlos, gepreßt. Das wirkt zusammengenommen wie die Metapher eines menschlichen Daseinszustandes. De Sprache folgt in wortschöpfenden Wirbeln einem wuchernden Nichts durch kafkaeske Räume. Absurd ist die Bewegung einer Reisegruppe, die durch ein "krüppelheim" der Einsamkeit und Zerstörung geführt wird. Konsequent werden die "parallelleben" filigraner Innenwelten durch den Strudel der äußeren Form getrieben und am Ende gebündelt.
ndl 5/1999
Die Worte und die Dinge
von Jochen Hörisch
Gedichte macht man - wie man seit Mallarmés schlagender Auskunft weiß - nicht mit Ideen, sondern mit Worten und Buchstaben. Die 1962 geborene poeta docta Ulrike Draesner kombiniert diese avantgardistische Maxime mit der klassischen Sonettform. Und heraus springen 15 kunstvoll ineinander verschlungene Gedichte, genauer Kettengedichte, deren jeweils letzte Zeile zur ersten Zeile des folgenden Sonettes permutiert. Ein Sonett hat bekanntlich 14 Zeilen (je zwei Quartette und Terzette). Und so ist das letzte und fünfzehnte Gedicht überzählig. Oder eben gerade nicht: es versammelt doch formvollendet Schluss- bzw. Startsätze der vorangehenden Gedichte, um sie zum finalen Telos-Sonett zu kombinieren - auf dass zum Text-Gewebe werde, was zuvor Ansammlung von Wörtern und Worten war.
All das ist sehr kunstvoll gemacht. Natürlich kann man solche Textgewebe, je nach Urteilslust, auch artifiziell nennen. Von rätselhaft schöner Stimmigkeit sind die fünfzehn Sonette zweifellos. Und das verdanken sie natürlich dem Umstand, dass ihr Wörterreigen einem ideenreigen entspricht. Die sprachlichen Fragmente, die die einzelnen Gedichte häufen, handeln von steinernen Fragmenten, von Ruinen. Ruinen sind die Orte, an denen deutlich wird, dass Natur sich zurückholt, was Menschen ihr abgetrotzt haben. An Ruinen erfahren triumphalistisches Denken und selbstbewußte Technik ihren Ruin.
...
[Ulrike Draesners] Gedichte sind wohl deshalb so faszinierend, weil sie ganz bewusst und buchstäblich Poesie sind, weil sie "gemacht" und konstruiert sind - wie Gebäude, bevor sie zu Ruinen werden. Draesner aber kehrt diese Entropiebewegung um. Ihr Schlußsonett ist aus den Wortsplittern konfiguriert, die die vorangehenden Gedichte aufgelesen haben. So bewährt sich der Titel des Bandes. Ist das rätselhafte Wort "anis-o-trop" doch der Begriff, mit dem das Phänomen beschrieben wird, dass Pflanzen und Kristalle unter ähnlichen Bedingungen verschiedene Wachstumrichtungen annehmen.
NZZ, 17. Dezember 1997

Buchpublikationen Übersetzungen:
The First Reader, von Gertrude Stein, übersetzt von UD, Ritter Verlag Klagenfurt/Wien 2001
Heimliche Deutung, Gedichte von HD (Hilda Doolittle), Urs Engeler Editor, Basel 2006
Averno, Gedichte von Louise Glück, Luchterhand, München 2007
Wilde Iris, Gedichte von Louise Glück, Luchterhand, München 2008
Weg, fünf Füße breit, Langgedicht von Michèle Métail, Wien 2009
Hörspiele
beziehungsmaschine, BR 1998
dieser Bottich, ach das Ich, BR 1998
Monographien über Ulrike Draesner
Familien Geschlechter Macht. Beziehungen im Werk Ulrike Draesners, hg. von Stephanie Catani und Friedhelm Marx, Göttingen 2008
