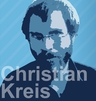Monatskolumne
Hallescher Bildungsabend. Ein Mitläufer berichtet
Sabine Trauder (auch zu ihrem Schutz habe ich wie üblich alle Namen in der Kolumne bis zur Unkenntlichkeit verändert), die uns zu diesem Abend überredet hatte, weil ich etwas von dem Thema des Abends verstünde – ich fühlte mich geschmeichelt und konnte ihr doch nur recht geben in dieser Annahme – wollte mich als Joker im Publikum sitzen haben, falls sie als Podiumsdiskutantin bei einer Frage nicht mehr weiterkäme. Die Veranstaltung hieß nicht „Wer wird Millionär“, sondern „Utopie – schwarz auf weiß“. Die Stuhlreihen waren mäßig, aber letztlich für diesen Anlaß ausreichend besetzt mit graumelierten Herrschaften im Abendrot ihrer Tage.
Aus der Fraktion der Sonnenuntergangsgeweihten trat nun ein bärtiger Herr an das Stehpult heran und verschwand vollständig dahinter. Es erklang Klaviermusik. Dann war es plötzlich wieder still. Nach einigen Sekunden setzte sie erneut ein, Musik von Erik Satie, die von Frau Dr. von Witz, der Impressaria des Abends, gleich im Anschluß näher erläutert werden sollte. Vorerst hörten wir sie nur. Wir befanden uns im Englischen Haus der Frankeschen Stiftungen, über die uns eine Stimme vom Band in der Straßenbahn aufklärt, sobald die Haltestelle Frankeplatz erreicht wird, daß sie ein bedeutendes Zentrum der europäischen Aufklärung gewesen seien. Die Betonung liegt auf gewesen. Die computergenerierte Frauenstimme klärt übrigens im ganzen Innenstadtbereich über die in der Nähe der jeweiligen Haltestelle befindlichen Sehenswürdigkeiten auf. Wahrscheinlich eine Initiative des halleschen Stadtmarketing für Hallebesucher. Die Auswirkungen auf die Einwohner hat mal wieder niemand berücksichtigt.
Wir lauschten also der Musik und der bärtige Herr war seltsamerweise immer noch nicht hinter dem Pult hervorgekommen. Meine katholische Freundin flüsterte mir zu, es sei wohl unten im Pult ein kleines Klavier eingebaut. In dem Moment tauchte er auf und ging zurück an seinen Platz. Ich flüsterte zu meiner Freundin, ob wir, wenn die Musik vorbei ist, klatschen sollen oder nicht, worauf sich eine Dame zu mir umsah, so daß ich nicht mehr flüsterte, sondern lieber mit andächtigem Gesichtsausdruck weiterlauschte. Ich wünschte einen Wackelkontakt herbei, der sich aber nicht einstellen wollte, dafür trat der bärtige Herr wieder an das Pult heran und stellte die Musik ab. Wir klatschten nicht, obwohl ich das Gefühl hatte, mich in einer sozialen Situation zu befinden, in der man eigentlich klatschten sollte. Eine junge Frau im schwarzen Kostüm trat nun nach vorn, bedankte sich bei den Anwesenden für ihr Kommen, begrüßte Frau Dr. von Witz, die daraufhin ihren Platz hinter dem Stehpult einnahm und sich ebenfalls bei den Anwesenden für ihr Kommen bedankte. Welch schöne, einleitende Musik, sagte sie, und erklärte, daß das Erik Satie gewesen sei, und wer noch nichts von ihm gehört haben sollte, später würde sie, wenn denn Interesse bestünde, noch gern ein bißchen mehr Auskunft über Satie geben, der ja nun wirklich sehr schöne Stücke komponiert habe, es seien hier nur die … (usw. ich kürze hier etwas ab). Frau Dr. von Witz war nicht nur an diesem Abend aktiv, sondern sie kümmert sich alljährlich um die „Halle liest“ Veranstaltung, die man inzwischen auch „Frau von Witz – liest“ nennen könnte. Irgendwann war sie einfach da, aus dem Westen Deutschlands nach Halle gekommen, und seit ihrem Ruhestand, sucht sie die Stadt mit Vorträgen heim.
Diesmal zum Thema Utopie. Und sie frage sich, ob die Utopie heutzutage überhaupt noch präsent sei in der Literatur bzw. der Kunst im allgemeinen und auf das Besondere wolle man ja noch zu sprechen kommen. Oder sei die Utopie längst aufgegangen in der Sience fiction? Nun ja, „Saiäns-Fiktschen“ heiße übrigens ein Erzählband von Franz Fühmann, dessen Erzählung „Pavlos Papierbuch“ sie zur Basis ihres Abendgesprächs genommen habe. Der im Westen leider kaum bekannte Franz Fühmann. Wie schade eigentlich, aber sie fühle sich nicht berufen den Westen mit Literaturhinweisen zu missionieren und umgekehrt nicht den Osten, wenngleich sie, falls von Interesse, im Anschluß noch einige Hinweise geben könne, denn man müsse doch auch mal in Betracht ziehen, daß … (auch hier kürze ich etwas ab). Also Franz Fühmann, der auf bemerkenswerte Weise das E-book bereits vorhergesehen habe, sagte sie. Sie las dazu eine Stelle vom Anfang seiner Erzählung laut vor, in der das Verschwinden des Papierbuches und die Verbreitung des Mikrofilms konstatiert, aber die sinnliche Qualität eines Buches betont wird. Diese Veranstaltung habe man ja nicht zufällig auf den Internationalen Tag des Buches gelegt.
Dann überstürzten sich die Gedanken etwas. Sie streifte Grimmelshausen, erwähnte Münchhausen, ergo Gottfried August Bürger. Und wie sich das alles so wunderbar füge, da man ja gerade in Halle Gottfried August Bürger und Kurt Goetz ein „Halle liest“ Themenjahr gewidmet habe. Hokuspokus!, sagte nun Frau Dr. von Witz triumphierend. Diese Bemerkung erschließt sich für den Nicht-Hallenser leider nur durch Erklärung und für den Hallenser auch nicht anders. „Hokuspokus oder wie lasse ich meine Frau verschwinden“, ist ein ehemals berühmtes Stück des ehemals berühmten Schriftstellers Kurt Goetz, der vor über hundert Jahren in Halle zur Schule gegangen war und der in diesem halleschen Themenjahr Gottfried August Bürger gegenübergestellt wurde, der ebenfalls, allerdings vor über zweihundertfünfzig Jahren, in Halle zur Schule gehen mußte. Frau Dr. von Witz hätte der Versuchung erliegen können, auch noch weitere Autoren, die nichts miteinander zu tun haben, außer, daß sie zufälliger Weise in Halle einmal zur Schule gegangen sind, miteinander zu vergleichen, hat sich aber wohlweislich auf diese beiden beschränkt.
Der bärtige Herr, der als vollfunktionstüchtiger Multimediamann erneut zu Diensten war und sich später als ihr Ehemann und emeritierter Theologieprofessor herausstellte, schaltete den Overheadprojektor ein und an die Wand wurde eine Buchillustration aus einem alten Münchhausenband geworfen: Ein Jäger schießt auf einen Hirsch, der einen Kirschbaum im Geweih trägt. Er schieße sich nicht nur ein Wildbret, so scherzte Frau Dr. von Witz, sondern auch gleich noch das Kompott dazu. Auch dieses sei doch irgendwie eine Utopie und eine gute Überleitung zum Gespräch.
Die Gesprächsteilnehmer seien, wie sie ja meistens sind, illustre, und Frau von Witz stellte dann vor: zuerst den Ranghöchsten, einen Professor für Medizingeschichte, als zweiten den Begründer der temporären, alternativangehauchten Ufo-Universität, nun auch die Schriftstellerin der Runde, unsere Freundin Sabine Trauder, und, last but not least, die Künstlerin, die aber ursprünglich Design studiert hatte, worauf die Künstlerin bereits zum zweiten Mal hinwies, da Frau von Witz wiederholt der Auffassung war, die Künstlerin hätte freie Kunst studiert, wie der Studiengang im Osten ja geheißen habe, beinah ein Pleonasmus, nicht wahr. Das war also halbwegs geklärt.
Utopie gehe von einem Mangel aus, meinte nun Frau von Witz, und richtete sich an den Professor, der als Medizinprofessor erst einmal feststellte, daß eine naturwissenschaftliche Disziplin wie die Medizin landläufig nicht mit Utopie in Verbindung gebracht werde und auch nicht gebracht werden möchte. In ihren Problemlösungsversuchen, sprich Heilungsbemühungen, entwerfe die Medizin jedoch Vorstellungen und Visionen, von denen die kühnste sicher die Überwindung des Todes gewesen sei.
Er dozierte noch ein bißchen vor sich hin und man ließ ihn gerne gewähren, sonst steht beziehungsweise sitzt man gleich wieder vor der Situation, selbst etwas zum Thema beitragen zu müssen. Die Künstlerin war berechtigterweise sehr zurückhaltend. Frau von Witz voll des Lobes, dies sei ja ein schönes Einführungsreferat gewesen.
Weggehen kann man jetzt wohl nicht mehr, fragte ich meine Freundin. Sie schüttelte mit dem Kopf. Ich wurde wieder etwas aufmerksamer als der Name Thomas Morus fiel. Doch kaum war die klassische Utopie gestreift worden, wollte Frau von Witz, obwohl man es nicht ansatzweise probiert hatte, gar nicht näher auf den Begriff der Utopie eingehen, sondern lieber mal so allgemein darüber reden, ob und wie die Kunst heute mit der Utopie umgehe. Das löste dann allerdings Reaktionen im Publikum aus. Besser gesagt in einer sehr speziellen Person. Man könnte sie auch die jüngere Schwester der Petra Pau nennen, nur ohne die linke Weltanschauung, dafür mit einer esoterischen, und natürlich mit dem obligatorisch feuerroten Kurzhaarschnitt. Sie meldete sich aus der dritten Reihe zu Wort, das heißt, sie sprach einfach drauf los, was denn nun mit Utopie gemeint sei, ob auch Visionen darunter fallen und übersinnliche Erfahrungen, Nostradamus und Numerologie; ob Avatare im Gespräch hier eine Rolle spielen werden, denn man müsse sich fragen, ob man nicht in der Zukunft verwandelt wiedererscheine, wovon sie der festen Überzeugung sei. Der Ausdruck von Ratlosigkeit und Belustigung wechselte in den Gesichtern ab. An dieser Stelle fühlte ich mich berufen, den Utopiekenner heraushängen zu lassen, eine Rolle, auf die ich mich schon den ganzen Abend gefreut hatte. War ich denn nicht eingeladen worden, mein fundiertes Wissen des utopischen Genres, das ich mir bis weit über die Regelstudienzeit hinaus angeeignet hatte, im rechten Moment en detail zu präsentieren, notgedrungen auch ungefragt? Ich meldete mich zu Wort, was mir leichtsinnigerweise erteilt wurde und sprach solange, bis mich Frau Dr. von Witz harsch unterbrach, der die Gesprächsführung langsam zu entgleiten drohte. Ich war nicht sehr weit mit meinen Ausführungen gekommen, gerade mal bis zu den sozioökonomischen Bedingungen, die Morus zu seiner Utopie veranlaßt hatten. Frau Nostradamus Pau wollte auch noch was sagen und konnte mit vereinten Kräften daran gehindert werden. Sie war zumindest unbeabsichtigt in den Dienst der Aufklärung getreten, insofern sie allen klar machte: Wer die Begriffsarbeit scheut, wird mit Esoterik bestraft.