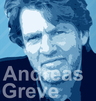weitere Infos zum Beitrag
Portrait
Im Reimgehege
Im aktuellen Jubläums-Editorial zum 20jährigen Bestehen der Zeitschrift „Das Gedicht“ schreibt Matthias Politycki: „Realpoeten sind Lyriker, die in allererster Linie für Leser schreiben, ob sie dabei mehr ins Sprachexperimentelle oder ins Erzählerische gehen, ist sekundär. Sie möchten eine Erfahrung nicht nur irgendwie zu Papier bringen, sondern mitteilen, mehr noch: mit ihren Lesern teilen. Und tragen also immer Sorge, dass die poetische Botschaft auch ankommt. " Wer als Dichter an den Leser denkt, wird dessen Verständnis nicht noch Steine in den Weg legen wollen. Die Sprache verfügt zu diesem Zweck nicht nur über die inhaltlichen Mittel einer klaren Botschaft, sondern auch über formale Kniffe wie Rhythmus und Reim. Besonders der Reim unterstützt das Verständnis des Lesers. Er vermittelt ihm durch das Zusammenklingen zweier Reimwörter den Eindruck von etwas Geglücktem, ja von Harmonie. Nicht zu vergessen die wichtige Funktion der Gedächtnis-Unterstützung: Der Reim fördert die Merkfähigkeit eines Gedichts. Kein Wunder, dass sich zu allen Zeiten Dichter gern des Reims bedienten. Selbst auf Zeiten, in denen der Reim als formales Kennzeichen bürgerlicher Lyrik-Schmocks diffamiert wurde wie etwa von den 60er bis hinein in die 80er Jahre des vergangenen Jahrhunderts, folgte eine Renaissance des Reims durch formbewusste Dichter. Heute erfreut sich der Wort-Gleichklang generationsübergreifender Beliebtheit, von etablierten Lyrikfürsten á la Durs Grünbein bis hin zu jungen Rappern und Poetry Slammern. Wie lässt sich hier – um endlich zum Thema zu kommen – der versierte Reimdichter Andreas Greve verorten?
Ziehen wir doch mal virtuelle, aber lyrische Koordinatenachsen durch das 20. und 21. Jahrhundert. Nehmen wir vier repräsentative Dichter, die – genau wie das Wörtchen „Reim“ – allesamt mit „R“ beginnen: Rainer Maria Rilke, Joachim Ringelnatz, Eugen Roth und Peter Rühmkorf. Wollte man auf diesem Koordinatenkreuz für Andreas Greve einen Fixpunkt setzen, so würde dieser – ohne ihm zu nahe treten zu wollen – näher an der Achse Ringelnatz–Roth zu suchen sein, nicht allzu weit von Fixsternen wie Robert Gernhardt, Heinz Ehrhardt, F.W. Bernstein und Thomas Gsella entfernt. Wie der große Ringelnatz hat sich nämlich auch Andreas Greve einen präzisen Blick für die skurrile Situation bewahrt. Allein wie er in dem Gedicht „Reine Panik“ in virtuos alternierenden Reimen den Schreckensmoment einfängt, in dem ein lyrisches Ich sein Portemonnaie vermisst, hat Tempo, Witz und Verve. Und in den letzten Versen wird dann auch klar, wer sich hinter dem hektischen Sucher verbirgt, der Autor selbst – identisch mit dem lyrischen Ich:
Doch da wird es von Gott gesandt,
den ich zuvor verfluchte:
In einer Seitentasche fand
ich endlich das gesuchte …
… verdammte Portemonnaie!
So bin ich halt: A. G.
Greve nun anhand seiner hochkomischen Reime ausschließlich in die Abteilung „heiter-besinnlich“ zu stecken, wäre indes verfehlt. Es gibt Gedichte, die man auch als Bezug zu aktuellen poetischen Diskursen lesen kann. Nehmen wir einmal das Gedicht „Im Zweifel: Zweifel“
Ich habe ein Gedicht gemacht,
aus Tinte und aus Worten.
ich habe selbst dabei gelacht:
Was will ich mehr!
Was will ich mehr???
Darüber hab ich lange nachgedacht …
Wer sich noch das große internationale Medienecho erinnert, dass das missglückte politische Gedicht „Was gesagt werden muss“ von Günter Grass auslöste, kann diese Gedicht auch als subtile Bezugnahme lesen. „Die stockende Tinte“ bei Grass wird zur flüssig laufenden und zugleich unentbehrlichen Gedichtzutat bei Greve. Selbst wenn sein Gedicht gar nicht auf Grass gemünzt war, sondern einem anderen Anlass entsprang, das Innehalten, das unausgesprochene resümierende Nachfragen „Was will ich eigentlich – auch jenseits des Lachens“ offenbart eine Nachdenklichkeit, die Grass vor Verfassen seines Gedichts sicherlich auch gut zu Gesicht gestanden hätte. Die subkutanen Verknüpfungen von Laut und Bedeutung thematisiert Greve sehr souverän im folgenden Gedicht:
SILBENMOND
Zwischen Buch und Stab verborgen,
ganz tief drin in Melodien,
sitzen Laute, die versorgen
Sinn und Sinne balerin.
Selbstvergessen Summton singend,
leicht entfallen dem Gehirn,
ohne Logik, niemals zwingend:
Silbenmond. Vokalgestirn.
Besser kann man die Kraftanstrengung, die notwendig ist, ein Gedicht mühelos klingen zu lassen, nicht auf den Punkt bringen. Mit nur acht feinen Versen öffnet Greve Horizonte, für die manch anderer Dichter zwei Semester Poetikvorlesungen in Frankfurt halten muss.
Bisweilen pendelt Greve allerdings auch in Richtung Eugen Roth. Dann geht es ins allgemein Menschliche; Roths allgegenwärtiger Protagonist in seinen Gedichten war ja auch „Ein Mensch“. Bei Greve heißt es:
EIN SCHLAF-LIED
Sehr gut bekommt dem Mensch der Schlaf,
versöhnt ihn so mit mancherlei,
das ihn am Tag verletzend traf.
Nachts scheint das Leben faltenfrei.
Der Schlaf entschädigt ungefragt,
und gleicht das Schicksalskonto aus;
er macht uns nächtens unverzagt.
Das hat die Nacht dem Tag voraus.
Nur eines macht mich da betrübt,
was ich hier öffentlich bekenn
(nicht etwa als Kritik geübt):
Dass ich den schönsten Schlaf verpenn!
Eine einzelne Wahrnehmung wird zur allgemeinen Erkenntnis erhoben und bekommt damit zuweilen etwas Gymnasial-Sentenzhaftes. Und dann wirkt der Reim nicht als etwas Geglücktes, dass Rhythmus und Klang zugleich schafft, sondern harmonisiert altväterliche Lehrsätze. Mit der letzten Strophe allerdings, die wieder auf das lyrische Ich zurückführt, schafft Greve hier noch einmal die Kurve. Was hat der Reim mit diesen Ausflügen in angestaubte Traditionen zu tun? Wer den Reim und damit ein klanglich geschlossenes System – verwendet, fühlt sich oft der hohen Form verpflichtet. Die hohe Form wiederum greift häufig „hohe“ Inhalte auf, Erfahrungen; Lebensweisheiten und Traditionen, die von allen geteilt werden können. Zeitgenössische Dichter merken beim Schreiben allerdings oft selbst, dass der Reim inhaltlich zu Lebensweisheiten führen kann, die sich längst zu Allgemeinplätzen verfestigt haben. Deshalb brechen sie die tradierte Form durch humoristische Inhalte auf. Der Gegensatz zwischen hoher Form und banalem Inhalt schafft eine Fallhöhe, die dem Reim wieder auffrischende Elemente verleiht. Dichter von Gernhardt bis Gsella leben von dieser Reibungsfläche. Und auch Greve schafft dies – etwa in seinem Sanitär-Sonett „Verminderte Spendenfreude.“ Den Verlauf vom heiter gebackenen Allgemeinplätzchen zur subversiven List verkörpert ein Gedicht wie „Wer zuletzt lacht“ exemplarisch:
WER ZULETZT LACHT
Zum Lachen braucht man den Humor.
Das Weinen kleidet Traurigkeit.
Beim Morden kommt oft Totschlag vor.
Enttäuschung ruft nach Bitterkeit.
Nur wenn ein Humorist dran glaubt,
der immer einen Lacher fand,
erhebt die Trauer froh ihr Haupt
und spricht am Grab als Gratulant.
Was zunächst noch wie ein Satz aus der lyrischen Hausapotheke klingt „Zum Lachen braucht man den Humor“, endet mit dem latent hämischen Bild von der Trauer als kondolierendem Begräbnis-Gast. Apropos Bilder: Ist der Reim eigentlich ein Verhinderer subtiler poetischer Bilder? Das ist eine meiner Thesen, die ich immer wieder bestätigt finde. Wer Gernhardt oder Eugen Roth liest, könnte es glauben. Da herrschen Erkenntnis und Effekt über die Bildhaftigkeit, die sich eben oft nicht in einem Reim-Vierzeiler fassen lässt. Widerlegt haben meine These bislang hauptsächlich expressionistische Dichter wie Ernst Blass, Alfred Lichtenstein, Ernst Stadler, Georg Trakl, aber auch Else Lasker-Schüler und Gottfried Benn. Verse wie „Ein dicker Junge spielt mit einem Teich“ (Lichtenstein: „Nebel“) oder „Die Straßen komme ich entlang geweht“ (Blass) sind unvergesslich, weil es ihnen gelingt, ein atemberaubendes Bild in einer Zeile zu fassen. Greve gelingt dies übrigens auch – in dem exzellenten Gedicht “Schusterplatz am Samstag.“
SCHUSTERPLATZ AM SAMSTAG
Ein kleiner Özil bolzt mit einem Jungen.
Ein Vater kaut Lakritz mit seinem Kind.
Die große Schwester schiebt ganz ungezwungen
die Jüngste dahin, wo die Schaukeln sind.
Die Häuser stehen hinter hohen Bäumen.
Die Pracht entspringt in dichten Kronen
die im Quadrat den schlichten Platz umsäumen.
Der Kiosk brüht den Kaffee ohne Warten
Die gelbe Post verteilt Samstagsbriefe.
Ein Dichter schreibt Gedankliches auf Karten,
so wie er blickt, sogar von großer Tiefe.
Ein fernes Auto hustet kurz beim Starten.
Es ist so friedlich, gänzlich ohne Eile
In Platzes-Mitte steht ein Baum für sich.
Der Dichter formt daraus die schöne Zeile:
„Ich traf Dich nicht, auch nicht vor einer Weile.
Wenn ich ganz ehrlich bin: Ich kenn Dich nich“
Auch hier greift nahezu durchgängig das Formprinzip „Ein Bild pro Vers.“ Und es sind wunderbare Bilder in dieser Samstagsidylle dabei, das beim Start hustende Auto ist wohl besonders eindrücklich. Der Dichter darf in dieser nachmittäglichen Siesta-Stimmung nicht fehlen, einer Stimmung, in der sich Menschen, Dinge und Natur zu duzen scheinen. Einzig die wunderbaren Zeilen des Dichters sorgen für einen Moment der Entfremdung, der aber mit lakonischem Humor abgefedert ist. Greve hat hier eine rundum geglückte Momentaufnahme geschaffen.
Fazit: Von einem Dichter, der formal so auf der Höhe ist wie Andreas Greve, würde man gern auch einmal mehr ungereimte Gedichte lesen. Das starke Gedicht „Hand aufs Herz“ gibt – trotz manchmal allzu sehr forcierter Emphase – Anlass zu Neugier und zur Lust auf mehr, kurz: Man möchte von Andreas Greve sehr gern mal einen Gedichtband lesen.