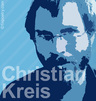weitere Infos zum Beitrag
Monatskolumne
Schöne neue Politik
April 2013
Vielleicht mache ich jetzt meine katholische Freundin ein bißchen eifersüchtig, wenn ich sage, Marina Weisband von der Piratenpartei ist der Traum des kleinen Piraten, der ich einst beim Fasching war. Das hat nicht wenig zu meiner Motivation beigetragen, mir die Talkshow, in der sie neulich auftrat, bis zum Schluß anzusehen. Petra Pau hätte das vermutlich nicht geschafft. Pumuckl war nicht so mein Ding. Deshalb ist für den optischen Wahlkampf bei den Linken auch Sarah Wagenknecht zuständig. Leider stellte Marina Weisband gleich zu Beginn des Gesprächs klar, daß sie die Reduzierung auf ihre Schönheit sehr lästig findet. Ich glaube allerdings nicht, daß sie beispielsweise mit dem Umweltminister Peter Altmaier tauschen wollte, der sich in seinem Leben bestimmt einmal gewünscht hat, auf Schönheit reduziert zu werden. Auch ich hätte dieses Schicksal mit Marina Weisband gerne geteilt, zumindest damals auf dem Schulhof oder in der Diskothek. Inzwischen versuche ich mich wenigstens auf meine Intelligenz reduzieren zu lassen, was auch nicht immer gelingt. Dafür habe ich mit meinem Rundrücken und dicker Unterlippe viel bessere Chancen, bei der nächsten Neuverfilmung des Glöckners von Notre Dame mitzumachen.
Jedenfalls hatte Marina Weisband ein Buch geschrieben, was vermutlich einer der Gründe war, warum sie dort saß. Sie sagte entnervt, nachdem sie nach diesem Buch gefragt wurde, auf dem ein schönes Foto von ihr abgebildet war, sie wolle jetzt gar nicht über ihr Buch sprechen. Mir schien, daß sie wahrscheinlich weniger Probleme gehabt hätte, wenn sie kein Buch geschrieben hätte und richtig häßlich gewesen wäre. Doch dafür war es nun zu spät. Der Moderator fragte sie, worüber sie denn nun eigentlich reden wolle. Und dann sprach sie über den Stil der Piratenpartei: Keine fertigen Programme, kein Komplettpaket an politischen Lösungsvorschlägen, sondern lieber Fragen statt Antworten. Und ich dachte, möglicherweise ist es bei den Piraten üblich, sich nicht auf etwas reduzieren zu lassen, zum Beispiel auf Inhalte. Die Menschen sollen die politischen Inhalte selber entwickeln. Diese Idee paßt zur postmodernen Dienstleistungsgesellschaft. Man fummelt am Automaten, um die richtige Fahrkarte zu kriegen, checkt selber im Hotel ein. Inzwischen gibt es sogar Firmen, die die Kunden das Produkt entwickeln lassen, das sie dann kaufen sollen. Der Kunde ist kein König, sondern der Praktikant. Und anstatt alle Jahre wieder, nach einem gemütlichen Sonntagsfrühstück, zur nächsten Grundschule zu spazieren, um seine Stimme abzugeben, womit man seine politische Verantwortung glücklicherweise auch schon los war, soll man nun in einem permanenten Abstimmungsprozeß über selbsteingereichte Anträge abstimmen. Liquid Democracy[1] wird das genannt. Für meine nazistische Oma, die Anglizismen auf den Tod nicht leiden kann, läßt sich das sprachbarrierefrei mit „flüssige Demokratie“ übersetzen. Bei einem Kaffee, den man im Gehen trinkt, schaut man also auf sein tragbares Bildtelefon und betreibt dann, so oft es geht, flüssige Demokratie. Nichts für Oma, die eher dem Prinzip des „hard dictatorship“ anhängt.
Die Kritiker der liquid democracy sagen, daß die Menschen überhaupt keine Lust haben, sich so intensiv mit Politik zu beschäftigen. Ich bin wahrscheinlich so ein Mensch. Ich beschäftige mich mit Literatur, Philosophie, meiner katholischen Freundin, und vor allem mit sehr vielen Dingen überhaupt nicht. Ich bin ein Freund der arbeitsteiligen Gesellschaft, wo es Politiker, Kolumnisten und Metzger gibt. Wenn mir Veganer vorwerfen, ich dürfe nur ein Tier essen, das ich selbst geschlachtet habe, dann sollen sie auf dem Acker Gemüse ernten, bis ihnen der Rücken weh tut. Aber vielleicht gilt es ja noch, um meinen Fleischkonsum zu rechtfertigen, daß ich als Jugendlicher Tauben vom Dach geschossen habe.
Der Systemtheoretiker Niklas Luhmann meinte: „Vielleicht am weitesten fortgeschritten ist die Wahlforschung mit der Einsicht, daß Apathie positive Funktionen haben kann.“[2] Und wenn ich mich so umschaue, bin ich tatsächlich froh darüber, daß sehr viele Menschen in meinem Bundesland nicht zur Wahl gehen, vor allem, daß meine Nachbarin vorerst kein größeres Maß an politischer Mitgestaltung erhält. Es reicht schon, daß sie auf den Putzplan Einfluß nimmt.
Mit solchen Ansichten hätte ich vermutlich keine Chance bei Marina Weisband. Als Mensch mit ästhetischer Beeinträchtigung im Gesichtsbereich bin ich das gewöhnt. In einer Bar fiel mir ein Plakat für eine Tanzveranstaltung ins Auge, bei der ich hoffen konnte, vom weiblichen Geschlecht mal nicht benachteiligt zu werden. Darauf stand: „Que(e)relle, Tanzen gegen die heteronormative Matrix Vol. 2. With 4 DJ_anes on 2 Floors“. Seltsame, wie von Kinderhand gemalte Phantasie-Figuren, die mir signalisierten, daß dort jede Ungewöhnlichkeit willkommen sei, bevölkerten das bunte Plakat. Auch das Cover des Suhrkampbandes von Judith Butler, der amerikanischen Gendertheoretiker_in, die zuletzt den Adorno-Preis bekommen hat, war abgedruckt. Und dann stand da noch: „Sexismus, Rassismus, Homophobie, Transphobie, Klassismus, Ableismus und Lookismus müssen draußen bleiben!“ Immerhin, diese Tanzveranstaltung böte einem die Gelegenheit, mal in sehr viele Fettnäpfchen zu treten. Es gäbe dort genug Personen_innen, die theoretisch auf der Höhe und sehr beleidigungsempfänglich sind. Doch ob man angesichts dieser breiten Palette an Diskriminierungsmöglichkeiten auch die nötige Kränkungskompetenz hätte? Wie man/frau/es rassistisch oder sexistisch sein kann, ist mir noch einigermaßen gut bekannt. Doch was läßt sich unter Klassismus, Ableismus und Lookismus verstehen? Ist man_frau bereits klassistisch, wenn man_frau jemanden ausgrenzt, der/die/das Goethe und Schiller nicht gelesen hat? Peter Hacks müßte ein ganz schlimmer Klassist gewesen sein. Ich habe dann diese Begriffe gegoogelt. Klassismus meint, jemanden_jemande wegen seines_ihres ökonomischen Status’ zu diskriminieren, Lookismus, Menschen aufgrund ihres Äußeren. Zum Beispiel, weil eine/einer/es schöner aussieht als ihre_sein Mitbewerber_in, kriegt er/sie/Es/Ich/Über-Ich den Job (oder wird in eine Talkshow eingeladen). Ob es bereits Lookismus ist, wenn ich auf der Tanzfläche lieber die hübschere Gendertheoretiker_in anmache, als die weniger hübsche, wäre noch herauszufinden.
Da ich nun schon Luhmann (bzw. Luhfrau) zitiert habe, möchte ich im Sinne der Gleichberechtigung zum Schluß auch einen Vertreter der Kritischen Theorie zu Wort kommen lassen, nämlich Adorno, der in der Minima Moralia schrieb: „Frauen von besonderer Schönheit sind zum Unglück verurteilt.“[3] Ich finde, da hat Petra Pau noch mal Glück gehabt.