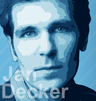weitere Infos zum Beitrag
Essay
anything goes
Juli 2013
Ich höre ein fertig produziertes Hörspiel über Brian Wilson, den Mastermind der Beach Boys, ab. Nachdem mein Kollaborateur bei dieser freien Produktion die letzten Schnitte angelegt hat, erreicht mich die fünfte Endfassung. Wir haben es geschafft, es gibt nichts zu meckern. Nur das Windspiel am Anfang, das sich mit den Schritten von kalifornischen Badetouristen im Sand vermischt, stört mich. Da ist ein Knistern, denke ich. Und halte mein Ohr zum 20. Mal dicht an den Lautsprecher, einen Hörsturz riskierend. Ich höre weiße Mäuse, sagt mein Kollaborateur. Da ist nichts, kein Knistern, kein Rauschen, nur das Windspiel.
Goethe sagt: „Das höchste zu begreifen wäre, dass alles Faktische schon Theorie ist.“ Recht hat er. Von meinen weißen Mäusen kann mich niemand erlösen. Ich muss praktisch darüber nachdenken, warum Kunstwerke heute auf den Punkt produziert sein müssen. Eine Theorie der Überproduktion ist gefragt, und warum sie unsexy ist und Hörstürze riskiert, damit ich unsere freie Produktion über Brian Wilson abnehmen kann. Ein besonders schillerndes Beispiel der Überproduktion fällt mir ein. Das Riesen-Rundbild des Künstlers Yadegar Asisi, das den Amazonas auf einer Leinwand in einem Leipziger Gasometer zeigt, und bereits 900.000 Besucher anlockte. Nun will Yadegar Asisi sein Riesen-Rundbild im Amazonas aufhängen, meldet die Bild-Zeitung. Und damit fängt die Überproduktion, meine ich, an.
Waren schon die Hetären, jene Geliebten bedeutender Männer im alten Griechenland, Meisterinnen der Überproduktion? Und wurde der Hang zur Überproduktion, also dem Überschuss formaler vor inhaltlichen Mitteln, von den überschminkten Kurtisanen am Hof des französischen Sonnenkönigs weitergereicht? Was heute an mein Ohr dringt, ist vielleicht schon seit vielen tausend Jahren abendländische Praxis. Zwei weitere Kollaborateure der Überproduktion fallen mir ein. Friedrich Nietzsche erhob das Dionysische zum Urprinzip der Kunst, und der von ihm zeitweise verehrte Richard Wagner inszenierte seine Opern auf dem Grünen Hügel in Bayreuth als auf den Punkt oder satt darüber produzierte Gesamtkunstwerke.
Heute ist jeder Kommentar auf Twitter oder Facebook Teil einer ähnlich raffinierten Inszenierung aus Schauder und Verblüffung, die nur verbergen muss, dass hinter der Bühne nicht immer viel Neues geschieht. Wir begreifen uns allesamt als Kulturproduzenten, was eine Überproduktion schon durch die schiere Menge an Playern nahelegt. Das Riesen-Rundbild reicht nicht aus, es muss zum Ort seiner Herkunft zurückkehren, um als eine relevante Produktion wahrgenommen zu werden. Falls ein brasilianischer Urwaldbewohner den westlichen Fetisch beherzt mit seiner Machete durchtrennen sollte, mag das immerhin noch einen Tweet wert sein.
Natürlich ist meine Strategie durchschaubar. Ich schlage kulturpessimistische Töne an, um davon abzulenken, dass ich unser Hörspiel über Brian Wilson nicht abnehmen kann. Ich höre dieses Knistern am Anfang. Aber vielleicht kommt es gar nicht aus dem Lautsprecher, sondern liegt über unserer gesamten Kultur. Weiße Mäuse eben. Wie schön waren die Zeiten, als sich Brian Wilson als einziger Überproduzent unter kalifornischen Hippies die Nächte um die Ohren schlug, jedes Geräusch aus dem Lautsprecher manisch prüfend. Keine Tweets oder Facebook-Kommentare mussten abgegeben werden, die Kino-Kritiken forderten nicht nachdrücklich auf: Angucken! Kult-Film! Ein Muss! Dagegen geht es uns heute wie den Hetären und Kurtisanen, die jederzeit nachströmende Konkurrenz aus den ländlichen Teilen des alten Griechenland oder Frankreichs fürchten mussten. Wer zu spät schminkt, den bestraft das Leben.
Mein Kollaborateur und ich stellen uns außerhalb dieser absolutistischen Paläste auf. Das ist eine Frage der Integrität, unsere freie Produktion über Brian Wilson beweist es. In den Medienanstalten grassiert die Überproduktion als Hochglanz-Fotostrecke, Expertenrunde, Krimi mit Starbesetzung. Der Feierabend lässt uns weiße Mäuse sehen, aufpolierte Produktionen, die sich mehr und mehr um einen lächerlichen Anlass drehen: Das Riesen-Rundbild wird von Leipzig in den Amazonas transportiert. Wir sind live dabei und haben das gute Gefühl, im medialen Dauereinsatz zu stehen. So ziehen jene berühmten 15 Minuten Ruhm, von denen Andy Warhol sprach, bestimmt nicht an uns vorüber. Wer nicht mitspielt in dieser Dauer-Lotterie, kann ohnehin nicht gewinnen.
Ich erinnere mich an eine Mitschülerin, deren Familie keinen Fernseher hatte. Das war bereits in den 90er Jahren ein schwerer Verstoß gegen das mediale Hetärentum, die Hänseleien blieben nicht aus. Dabei halte ich sie heute für tapfer. Was haben mir die Medien in den letzten zwei Wochen gebracht? Die Schlagzeile vom Amazonas-Riesen-Rundbild im Amazonas. Deutschlands ersten Wasser-Sommelier. Diverse Experten für bewusstes Gehen und Fahrtüchtigkeit im fortgeschrittenen Alter. Ich hätte mir das alles auch selbst denken können. Das Knistern des Windspiels, das ich am Anfang unseres Hörspiels über Brian Wilson höre, ist meine kulturelle Unfähigkeit, Feierabend zu machen.
An dieser Stelle ein Lob auf B-Movies und dänische Dogma-Filme. Ein Lob auf den Spaghetti-Western, den Quentin Tarantino zur Reanimierung der Kultur bemüht. Wir hätten unser Hörspiel über Brian Wilson unterproduzieren sollen. Ja, Überproduktion ist unsexy, und sie versauert mir den Feierabend. Jede Kameraeinstellung muss perfekt sein, jeder Ton von kristalliner Schärfe? Quatsch. Da sprechen schon Brecht und der gute Geschmack dagegen. Übrigens auch Aristoteles, man nehme einen harmlosen Satz aus einem fiktiven Drehbuch: Ich hole Gurken, Schatz. Natürlich wird er später im Film durch einen opulenten Gurkenmord motiviert gewesen sein.