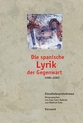weitere Infos zum Beitrag
Anthologie
Der Musik näher und dem Lied - Spanische Lyrik der Gegenwart
Im Unterschied zur deutschen Lyrik, die sich nach 1947 und seit dem Diktum, nach Auschwitz könne man keine Gedichte mehr schreiben, sehr lange politisch oder apolitisch-experimentell gegeben hat, jedenfalls kulturverschüchert und europascheu, fällt in der spanischen nachfranquistischen Dichtung der Trend des „culturalismo“ auf: Man beruft sich in der Postmoderne gern auf einen Bildungskanon als Religionsersatz. Anspielungen auf die Antike und selbstverständlicher Umgang mit ihrem Figuren- und Geschichtenrepertoire sind in der spanischen Lyrik der 1980erjahre häufiger als in der deutschen des selben Zeitraums, wo man sich nur erzählerisch-episch mit Griechen und Römern einlässt. Nicht nur seit Heinrich Bölls „Wanderer, kommst du nach Spa...“ ist humanistische Bildung in Misskredit geraten und seit 1968 alles Übernommene ohnehin verpönt.
Dagegen Spanien galt das Misstrauen eher den langjährigen Zensoren katholische Kirche und Militärdiktatur, aufgeklärter Humanismus ist dort Spätzünder.
Den sogenannten Kulturalismus gliedern Hispanisten sogar in zwei Gruppen: die klassische und die hellenistische. Die Definition der „hellenisierenden Dichtung“ durch Luis Antonio de Villena hätte Joseph Brodsky („Sehnsucht nach Weltkultur“) begeistert, sie lautet: Sehnsucht nach dem Heidentum <...> als mythische Liebe zum Leben <...> geschaffen vom Christentum. (S. 19)
Leider sind nicht alle Beispiele, die zur Illustration im Vorwort beschrieben wurden, in dem Buch zu finden; etwa Maria Sanz ist überhaupt nicht und Ana Rossetti mit anderen Texten vertreten als ihrem antikisierend-erotischen in der Persona der Diotima.
Feministische Gedichte sind bei spanischen Dichterinnen weiblicher, nämlich erotisch, als bei deutschen, wo sie politisch sind.
Dichtung, bei der das Liebesideal homoerotisch ist, war in Spanien von Kirche und Franco, also länger, verboten. Sie ist relativ neu und liest sich frischer.
Berührungsangst mit dem Folkloristischen ist beim deutschen Gedicht in der Panik vor Blut-und-Boden-Ideologie begründet, die Spanier legen keine an den Tag. Im Gegenteil, durch die ganze Moderne, angefangen bei García Lorca, haben einzelne Dichter gern damit herumprobiert, einfache oder regionale Alltagssprache mit hochsprachlichen oder feierlichen Sprachebenen zu konstrastieren oder abzuwechseln.
Wie alle romanischen Sprachen sind die drei spanischen mit einem Klang gesegnet, der von sich aus sangbar tönt, und ein regelmäßiges Metrum ist auch im zeitgenössischen spanischen Gedicht keine Seltenheit, sondern eher zu finden als im deutschen. Wenn auch in den Beispielen die Freien Verse die große Mehrheit sind, zeugen doch die Binnenreime und Assonanzen von der Vollmundigkeit im Dichtungsverständnis der Spanier, die Sprache der Dichtung ist der Musik näher als die zurzeit romantikscheue deutsche Leselyrik, in der spanischen und lateinamerikanischen Literatur sind Liedermacher in erster Linie Dichter, es ist nicht selten, dass gute Gedichte vertont werden und weite Verbreitung finden. Die Freude der Spanier am Gedicht wirkt sich auf das Selbstbewusstsein der Dichter aus, man merkt vielfach den Versen an, dass ihre Schöpfer wissen, man wird sie hören oder lesen.
Zugegeben, mir waren alle 22 Namen der Sammlung neu. Einige erscheinen mir – mein persönlicher Geschmack – besonders interessant und haben meine (dank Internet und sorgfältigen Literaturverweisen stillbare) Neugierde geweckt. Hier meine Eindrücke:
Der Kanare Andrés Sánchez Robayna, geb. 1932, gehört zu den Dichtern des reduzierten Materials, seine Texte sind manchmal wie Säulen aus Einsilblern anzusehen. Er ist auf maximale Konzentration Richtung Schweigen spezialisiert – Gennadi Ajgi nicht unähnlich; eine Richtung, wie man sie von – in deutschen Sprachraum ungleich bekannteren, wenn auch jüngeren – Jaime Siles (geb. 1951, im Vorgängerband „Spanische Lyrik der Moderne“ bereits vorgestellt) kennt.
Dagegen Spanien galt das Misstrauen eher den langjährigen Zensoren katholische Kirche und Militärdiktatur, aufgeklärter Humanismus ist dort Spätzünder.
Den sogenannten Kulturalismus gliedern Hispanisten sogar in zwei Gruppen: die klassische und die hellenistische. Die Definition der „hellenisierenden Dichtung“ durch Luis Antonio de Villena hätte Joseph Brodsky („Sehnsucht nach Weltkultur“) begeistert, sie lautet: Sehnsucht nach dem Heidentum <...> als mythische Liebe zum Leben <...> geschaffen vom Christentum. (S. 19)
Leider sind nicht alle Beispiele, die zur Illustration im Vorwort beschrieben wurden, in dem Buch zu finden; etwa Maria Sanz ist überhaupt nicht und Ana Rossetti mit anderen Texten vertreten als ihrem antikisierend-erotischen in der Persona der Diotima.
Feministische Gedichte sind bei spanischen Dichterinnen weiblicher, nämlich erotisch, als bei deutschen, wo sie politisch sind.
Dichtung, bei der das Liebesideal homoerotisch ist, war in Spanien von Kirche und Franco, also länger, verboten. Sie ist relativ neu und liest sich frischer.
Berührungsangst mit dem Folkloristischen ist beim deutschen Gedicht in der Panik vor Blut-und-Boden-Ideologie begründet, die Spanier legen keine an den Tag. Im Gegenteil, durch die ganze Moderne, angefangen bei García Lorca, haben einzelne Dichter gern damit herumprobiert, einfache oder regionale Alltagssprache mit hochsprachlichen oder feierlichen Sprachebenen zu konstrastieren oder abzuwechseln.
Wie alle romanischen Sprachen sind die drei spanischen mit einem Klang gesegnet, der von sich aus sangbar tönt, und ein regelmäßiges Metrum ist auch im zeitgenössischen spanischen Gedicht keine Seltenheit, sondern eher zu finden als im deutschen. Wenn auch in den Beispielen die Freien Verse die große Mehrheit sind, zeugen doch die Binnenreime und Assonanzen von der Vollmundigkeit im Dichtungsverständnis der Spanier, die Sprache der Dichtung ist der Musik näher als die zurzeit romantikscheue deutsche Leselyrik, in der spanischen und lateinamerikanischen Literatur sind Liedermacher in erster Linie Dichter, es ist nicht selten, dass gute Gedichte vertont werden und weite Verbreitung finden. Die Freude der Spanier am Gedicht wirkt sich auf das Selbstbewusstsein der Dichter aus, man merkt vielfach den Versen an, dass ihre Schöpfer wissen, man wird sie hören oder lesen.
Zugegeben, mir waren alle 22 Namen der Sammlung neu. Einige erscheinen mir – mein persönlicher Geschmack – besonders interessant und haben meine (dank Internet und sorgfältigen Literaturverweisen stillbare) Neugierde geweckt. Hier meine Eindrücke:
Der Kanare Andrés Sánchez Robayna, geb. 1932, gehört zu den Dichtern des reduzierten Materials, seine Texte sind manchmal wie Säulen aus Einsilblern anzusehen. Er ist auf maximale Konzentration Richtung Schweigen spezialisiert – Gennadi Ajgi nicht unähnlich; eine Richtung, wie man sie von – in deutschen Sprachraum ungleich bekannteren, wenn auch jüngeren – Jaime Siles (geb. 1951, im Vorgängerband „Spanische Lyrik der Moderne“ bereits vorgestellt) kennt.