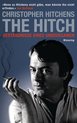Roman
CHRISTOPHER HITCHENS IST TOT „Niemals den Zugriff auf den Zorn verlieren“ – die Lebenserinnerungen des Publizisten und Provokateurs Christopher Hitchens
In Großbritannien gab es im 19. Jahrhundert eine beim Lesepublikum beliebte literarische Gattung: die Kriegsberichterstatter-Erinnerungen. Sie gehen zurück auf die Jahre des Krimkrieges 1853 bis 1856, den ersten Medienkrieg in der Geschichte. Ein Pionier dieser Disziplin war William Howard Russell, der damals für die Londoner „Times“ von der Krim berichtete. Die britischen Leser rissen sich nach seinen Reportagen von der Front. In der Folgezeit gab es kaum noch einen Kriegsschauplatz auf der Welt, zu dem die Zeitungen nicht ihre Reporter entsandten, selbst dann, wenn die Kämpfe in Russland, den USA oder Südafrika ausgetragen wurden. Der bekannteste Vertreter dieser Zunft war niemand geringerer als der spätere britische Premierminister Winston Churchill, der im Burenkrieg (1899-1902), über den er eigentlich berichten sollte, sogar selbst zur Waffe griff, um die eigenen Truppen zu unterstützen. Mit der Neutralität der Presse war es im Zeitalter des Nationalismus nicht allzu weit her. Die Erinnerungsbücher, die die Kriegsreporter nach ihren Einsätzen veröffentlichten, waren häufig Bestseller. Nicht selten erzählten sie reißerische Abenteuergeschichten, die von Heldenmut, Gefahren und einem gerechten Kampf handelten, und sich in fernen und exotischen Regionen zutrugen. Erst der Erste Weltkrieg sorgte dafür, dass der Krieg in den Köpfen der Menschen seine Romantik einbüßte.
Hätte Christopher Hitchens im 19. Jahrhundert gelebt, er wäre vermutlich Kriegsreporter geworden. Seine Berichte, so viel steht fest, wären immer von der vordersten Frontlinie gekabelt worden, und sie hätten stets ganz besonders anschauliche Schilderungen der Ereignisse enthalten. Da aber der Beruf des Kriegskorrespondenten in Zeiten allumfassender Zensurmaßnahmen seinen ursprünglichen Abenteuercharakter weitgehend verloren hat, wurde Hitchens Publizist und Buchautor, was freilich nicht bedeutet, dass es ihn nicht doch bisweilen in Kriegsgebiete gezogen hat, wie etwa während der Golfkriege, als er unter anderem aus Kurdistan berichtete. Doch auch ohne Krieg agiert Hitchens am liebsten an vorderster Front. Nun hat er seine Lebenserinnerungen vorgelegt; sie lesen sich streckenweise wie ein Abenteuerroman.
Der Sohn eines Marineoffiziers strebte, tatkräftig unterstützt von seiner Mutter, früh den gesellschaftlichen Aufstieg an. Während des Studiums in Oxford gegen Ende der 1960er Jahre engagiere er sich, wie so viele, in der politischen Linken und gegen den Vietnamkrieg. Im renommierten Debattierclub der Hochschule fiel er frühzeitig durch seine rhetorische Begabung auf, eine Fähigkeit, die er später bei unzähligen Vorträgen und Auftritten in Fernsehshows perfektionierte und die zu einem Art Markenzeichen von ihm wurde. Nach dem Studium ging er nach London, wo er für den (damals noch viel gelesenen) „New Statesman“ und zahlreiche weitere Blätter schrieb.
Anfang der 1980er erfolgte der Umzug in die USA, unter anderem als Kolumnist für „The Nation“ und „Vanity Fair“, später dann auch für das Online-Magazin „Slate“.
Im Gegensatz zu anderen Publizisten besetzte Hitchens nie eine thematisch Nische, sondern vertrat selbstbewusst die Auffassung, die ganze Welt sei sein Thema. Er schrieb über die Bücher seiner Freunde Salman Rushdie, Martin Amis und Edward Said ebenso wie über die Politik Henry Kissingers, die islamische Revolution im Iran, den Kalten Krieg, das kommunistische China oder jüngst die Auswirkungen der weltweiten Finanzkrise auf das kapitalistische System. Seine Beiträge und Aufsätze sind stets auf den Punkt und in ihrem Urteil eindeutig, Grautöne sind seine Sache nicht. Wenn Hitchens seine Meinungen änderte (was nicht selten vorkommt), begründete er es damit, dass sich die Welt verändert habe, er hingegen sich treu geblieben sei. Etwa während des Zweiten Golfkrieges, als der ehemalige Marxist auf die Linie der US-Regierung einschwenkte und – Hitchens macht keine halben Sachen - werbewirksam mit dem stellvertretenden Verteidigungsminister Paul Wolfowitz, einer Hassfigur der Linken weltweit, durch den Irak tourte.