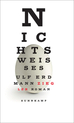Roman
Das Weiße für den Leser
09.11.2012 | Hamburg
Es gibt Leute, die, egal, wo sie sich befinden nach Lesbarem Ausschau halten. In fremden Städten nach Straßennamen, um sich zu orientieren, in Wartezimmern nach den bunten Zeitschriften, die man sich sonst nicht kauft. Auf der Toilette nach der Werbung auf dem Toilettenpapier, nach den kleinen handgeschriebenen Obszönitäten an den Wänden. Man will sich orientieren, verstehen, sich unterhalten.
Die Hauptfigur in Ulf Erdmann Zieglers Roman „Nichts Weißes“ schaut sich ebenfalls stets aufmerksam um, aber nicht, um sich zu orientieren, zu verstehen oder sich zu unterhalten. Sie schaut nach den Formen der Buchstaben, nach der Typografie. Marleen Schuller träumt von einer Schrift „ohne Stil“, einer Schrift, „die man gar nicht bemerkt“. Ein Traum, der am Schluss des Romans und damit Ende der 1980er Jahre etwas verschwommen in Erfüllung zu gehen scheint, als Marleen eine Software entwickeln soll, die es jedem Unbedarften ermöglicht, wie ein Grafiker zu arbeiten. Marleen ist Zeugin der ersten Reihe beim Übergang des Druckens vom Lichtsatz (mit einem kurzen Rückblick in den Handsatz) ins digitale Zeitalter.
Erstaunlicherweise wird Marleens Begabung von allen, die ihre Ausbildung begleiten, erkannt, überall wird sie gefördert, weiter gereicht. Sie beginnt in einer Handsatzdruckerei, wo man sie als Praktikantin auch schon mal Korrektur lesen lässt. Doch Marleen liest langsam, später wird sich herausstellen, dass sie als Kind sogar an Legasthenie litt. Sonst ist sie anstellig und wird heimlich „Juniorchefin“ genannt, bekommt sogar einen Heiratsantrag, aber sie muss weiter. Nach Kassel zum Studium, wo die Kommilitonen nach den Buchstaben heißen, die sie als erstes zu entwerfen haben. Das e wird „ihr“ Buchstabe, das „Auge“. Und der das schöne m entwirft, das auf seinen drei Beinen fort zu krabbeln scheint, wird ihr Freund Franz. Als er weg ist, wie „sein“ Buchstabe schon prophezeit hat, geht Marleen nach Paris, ohne das Studium zu beenden. Sie entwirft Logos für kultige Modegeschäfte. Franz findet sie in Paris, beschert ihr ein Kind und geht dann ins Kloster. Erst ohne, dann mit Kind geht Marleen nach New York in eine große Firma.
Ulf Erdmann Ziegler ist Jahrgang 1959, hat visuelle Kommunikation studiert und als Kunstkritiker gearbeitet. 2007 erschien sein erster vielbeachteter Roman. Mit „Nichts Weißes“ kam er nun auf die Shortlist des Deutschen Buchpreises in diesem Herbst.
Ziegler erzählt nicht chronologisch. Er beginnt mit Marleens Praktikum und Studium Anfang bis Mitte der 1980er Jahre. Am Schluss die Pariser und die New Yorker Zeit. In der Mitte des 250 Seiten- Romans wendet er sich der Elternebene zu. Der Vater, als Kind in der Nazi-Eliteschule Napola, lernt in den 1950ern Lore kennen, Absolventin der Kölner Werkschulen. Bei ihrem ersten näheren Beisammensein zerkracht sensationell eine Biedermeiercouch. Insgesamt entstehen vier Kinder. Sie ist eine erfolgreiche Kinderbuchillustratorin, er ein noch erfolgreicherer Werbeguru, den die Kampagne für die o.b.-Tampons bis nach Amerika führt. Seine Töchter müssen die Tampons noch vor der Menstruation testen. Marleen verweigert die katholische Glaubensunterweisung, als dem Mädchen verwehrt wird, Ministrantin zu werden. Die ältere fromme Schwester hat eine Erklärung, Mädchen seien unrein und wer menstruiert, darf eben nicht ministrieren. Der Kaplan informiert Mutter Lore über das Fernbleiben der Tochter vom Unterricht, und die Mutter findet den Kaplan attraktiv. Ihr Mann ist seit Jahren in Indien in einer Sekte. Der Kaplan kehrt in seinen alten Beruf als Arzt zurück und zieht später zu Lore.
Ulf Erdmann Ziegler legt also viele Fäden aus, seine Figuren tragen bedeutungsschwere Namen, der Vater Petrus, Marleen ist ein Kürzel von Maria Magdalena, die fromme Schwester heißt Johanna und der ins Kloster flüchtende Freund Franziskus (man kann nun vor alle Namen ein „heilig“ setzen). Autor und Typograf setzen die die einzelnen Buchstaben, die Handlungsstränge nebeneinander. Die Napolaschule, die erfolgreichen Eltern in der Nachkriegszeit, das o.b.-Tampon und das Ministrieren. Der Geistliche wendet sich dem Weltlichen zu, Anspielungen auf die „Heilige Schrift“ spiegeln sich in der Schrift, nach der Marleen so zielgerichtet sucht. Und – die Bibel steht dem Ende der Gutenbergära gegenüber. Das vom Autor Gesetzte wäre also das Schwarze, das Weiße dazwischen soll offensichtlich der Leser selbst ausfüllen. Jeder gute Roman macht ein solches Angebot an seine Leser. Aber wenn die Absicht bereits im Titel didaktisch suggeriert wird, könnte es dem Leser wie dem Schicksal gehen, von dem im ersten Absatz des Buches geschrieben steht: „das Schicksal hebt die Schultern und lässt sie wieder sinken“.
Exklusivbeitrag
Ulf Erdmann Ziegler: Nichts Weißes. Roman. Gebunden, 259 Seiten. 19,95 Euro ISBN: 978-3-518-42326-4, Suhrkamp Berlin 2012