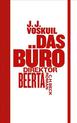weitere Infos zum Beitrag
Roman
Am Ende der Suche nach der verlorenen Zeit – J.J. Voskuils sensationelles „Büro“-Epos gibt es jetzt auch auf Deutsch
28.11.2012 | Hamburg
Es gibt Formate, die an bestimmten Orten funktionieren, anderswo aber nicht. Ein Beispiel dafür ist die ARD-Krimireihe „Tatort“. Am Beginn jeder Folge steht ein Mord. Daraufhin nehmen die Kommissare – es sind immer zwei, sonst klappt das launige Zusammenspiel nicht – die Fahndung auf, reißen ein paar Witze und präsentieren exakt 90 Minuten später den (oder die) Täter. Schwarz ist schwarz, Weiß ist weiß; die Guten sind gut, die Bösen böse. Dann kommt Günther Jauch und es wird Montag.
Erzählt man Besuchern aus dem Ausland, dass „Tatort“ hierzulande allsonntäglich zehn Millionen Menschen vor die Bildschirme zieht, erntet man ungläubige Blicke. Undenkbar, dass sich in den USA oder Großbritannien, wo Serien wie „The Wire“ oder jüngst „Boardwalk Empire“ die Maßstäbe setzen, eine vergleichbare Zuschauerzahl finden ließe, die bereit wäre, anderthalb Stunden einer mühsam dahinplätschernden, über die Maßen vorhersehbaren guter-Cop vs. böser-Gangster Geschichte zu folgen.
Ganz ähnliche Überlegungen könnten es sein, die internationale Verlage lange Zeit davon abgehalten haben, „Het Bureau“ aus der Feder des niederländischen Autors J.J. Voskuil anzufassen. Nur so lässt es sich erklären, warum das Buch, das in Voskuils Heimat ein Megabestseller war, erst 16 Jahre nach seiner Veröffentlichung auf Deutsch vorliegt (übersetzt von Gerd Busse, erschienen bei C.H. Beck). Denn zum einen handelt es sich bei „Das Büro. Direktor Beerta“ lediglich um den ersten Band einer Romanserie, die immerhin sieben Teile umfasst und gut 5.000 Seiten füllt. Allein der Gedanke an die Übersetzungskosten dürfte etliche Verleger abgeschreckt haben. Zum anderen präsentiert sich der Inhalt auf den ersten Blick nicht gerade als verkaufsfördernd: Über drei Jahrzehnte begleitet der Leser den „wissenschaftlichen Beamten“ Maarten Koning bei seiner ebenso eintönigen wie zweckfreien Arbeit am Amsterdamer Institut für Volkskunde. Damit nicht genug, ist das Buch gespickt mit Anspielungen auf niederländische Einrichtungen und Personen, die sich dem ausländischen Leser nicht erschließen. Und dennoch, es funktioniert: „Das Büro“ fesselt auch nicht-niederländische Leser von der ersten bis zur letzten Seite. Ein Grund dafür könnte sein, dass das besagte Amsterdamer Institut wirklich existiert – und es dort zwischen 1957 und 1987 tatsächlich einen Mitarbeiter namens Johannes Jacobus Voskuil gegeben hat.
Aber der Reihe nach: Eigentlich hatte Maarten Koning ja Lehrer werden wollen. Das allerdings hat er nach einer kurzen Versuchsphase schnell wieder aufgegeben. Da er anders als seine Frau Nicolien, die jede Form von Ambition oder Karrierestreben als eine Verletzung des „wahrhaftigen“ Lebens strikt ablehnt, aber der Auffassung ist, dass man irgendeiner beruflichen Tätigkeit nachgehen müsse, tritt er 1957 eine Stelle am volkskundlichen Institut an. Nicht zuletzt weil er vermutet, dass man es dort mit der Arbeit nicht übertreibt; zu Recht, wie sich schnell herausstellt.
Maartens Vorgesetzter ist der nicht unfreundliche, aber mit allen Wassern gewaschene Direktor Anton Beerta. Dieser meidet Entscheidungen wie der Teufel das Weihwasser, schafft es aber über ein Geflecht an Beziehungen und Gefälligkeiten, sein Institut immer weiter zu vergrößern. Jahr für Jahr werden neue überflüssige Forschungsprojekte ersonnen sowie dazugehörige Stellen im Haushaltsplan beantragt, die dann auch stets genehmigt werden. Das hat zur Folge, dass sich das „Büro“ immer mehr als eine Ansammlung kruder Gestalten entpuppt. Auf dem regulären Arbeitsmarkt kaum vermittelbar, nutzen sie das Institut, um in Seelenruhe und staatlich alimentiert ihren spleenigen Hobbies nachzugehen.
Zu Maartens ersten Aufgaben gehört die Erforschung der Wichtelmännchen-Erzählungen im niederländischen Kulturkreis (ein Lieblingsprojekt Beertas). Dem folgt eine großangelegte Feldstudie zum Umgang mit der Nachgeburt des Pferdes, die in manchen Regionen offenbar vergraben, anderenorts hingegen aufgehängt wurde. Maarten wittert eine Kulturgrenze, kann diese aber leider nicht begründen. Derlei spektakuläre Erkenntnisse werden dann in regelmäßigen Abständen bei feuchtfröhlichen Zusammentreffen mit den Kollegen in Antwerpen oder Münster erörtert. Und es werden neue – gerne internationale – Forschungsvorhaben entwickelt, von denen man dem Steuerzahler besser nichts erzählt. Das Ergebnis von alldem ist eindeutig: Ein Kreislauf öffentlich geförderter Sinnlosigkeit, der wohl auch heute noch das Wesen zahlreicher Einrichtungen der öffentlichen Hand treffend beschreibt.
Vor allem zwei Dinge sind es, die an Voskuils „Büro“-Epos faszinieren, sowohl als Lektüre wie auch als literarisches bzw. gesellschaftliches Phänomen. Da ist zum einen die schiere Unglaublichkeit, dass dieser über 800 Seiten starke Band tatsächlich von der ersten bis zur letzten Zeile ein kurzweiliges Lesevergnügen darstellt, obwohl praktisch nichts passiert und auch kein Spannungsmoment vorhanden ist. Zum anderen kann und sollte man sich dem Hype, den das Buch seit seiner Veröffentlichung Mitte der 1990er Jahre in den Niederlanden ausgelöst hat, nicht entziehen (Gerd Busse informiert darüber in einem Nachwort). „Das Büro“ wurden mit Preisen überhäuft, Fanclubs wurden gegründet (nicht selten Bürogemeinschaften), Theaterwerke entstanden und wie bei Harry Potter oder dem neuen iPod versammelten sich Menschenmassen morgens vor den Buchhandlungen, wenn die Veröffentlichung eines weiteren Bandes anstand. Und das reale „Büro“ am Amsterdamer Stadtrand? Dort wurden Führungen veranstaltet, bei denen die Mitarbeiter Namensschilder mit sowohl ihrem wirklichen Namen als auch dem ihres Roman-Egos trugen. Unnötig zu betonen, dass sich unzählige wissenschaftliche Arbeiten mit den soziologischen Hintergründen des phänomenalen Erfolgs von „Das Büro“ befassen.
Eine besondere Ironie ist außerdem, dass sich mittlerweile immer mehr Menschen für die bis dato komplett unbeachteten volkskundlichen Arbeiten Voskuils interessieren (z.B. die Nachgeburt des Pferdes). Was der Autor davon gehalten hätte, kann man sich denken. Dazu befragen kann man ihn leider nicht mehr. J.J. Voskuil ist 2008 im Alter von 81 Jahren gestorben. Schwer erkrankt nahm er Sterbehilfe in Anspruch. Als Todestag wählte er den 1. Mai, den „Tag der Arbeit“.
Eine Ankündigung über das weitere Erscheinen der „Büro“-Serie steht bislang noch aus. Man kann nur hoffen, dass der Verlag an dem Projekt festhält und bald auch die noch fehlenden Bände in deutscher Sprache vorliegen werden.
Exklusivbeitrag
J.J. Voskuil: Das Büro. Direktor Beerta. Aus dem Niederländischen von Gerd Busse. ISBN 978-3-406-63733-9 25 € Verlag C.H. Beck München 2012.