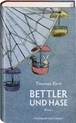weitere Infos zum Beitrag
Roman
Von Bülte zu Bülte ziehen Bettler und Hase in »Bettler und Hase«, dem verrückten Roman von Tuomas Kyrö.
30.06.2013 | Hamburg
Natürlich hätte unser Held auch andere Optionen ge-
habt, er hätte Autos oder das Kupfer aus Telefonkabeln
stehlen oder eine Niere verkaufen können. Aber von allen
schlechten Angeboten war das von Jegor Kugar das beste.
Schon der erste Satz aus „Bettler und Hase“ von Tuomas Kyrö macht deutlich, worauf man sich gefasst machen muss: auf ein Buch voll schwarzem Humor, das zugleich reale Probleme und Missstände der Wohlstandsgesellschaft ganz offen anspricht. Hinter Humor und Ironie verbergen sich auch visionäre Aspekte: der Traum von Gerechtigkeit und Menschlichkeit.
„Bettler und Hase“ von Tuomas Kyrö beschreibt eine Odyssee ins Ungewisse, von Rumänien bis in die Moltebeeren-Felder des finnischen Lapplands. Unser Held: Vatanescu, ein Bettler und geschickter Pechvogel. Sein Begleiter: ein Hase, der eigentlich ein Kaninchen ist. Das Ziel: die allerbesten Stollenschuhe für den Sohn Miklos, zurückgelassen in Rumänien.
Harte Wirklichkeitsbeschreibung, modernes Märchen, Sozialsatire – der Roman entzieht sich einer definitiven Einordnung, sodass nicht immer eindeutig ist, woran man als Leser gerade ist:
Sprichst du in Gleichnissen?
„Wenn es nur so wäre!
[...]
Sprichst du konkret?
„Ich rede in Gleichnissen.“
So harmlos komisch der Roman vielleicht wirken mag – er wurde oft auch als modernes Märchen bezeichnet – dieser Eindruck täuscht gewaltig. Denn der Roman enthält eine starke politische Aussage: Es geht nicht um Integration, sondern um Akzeptanz. Der Roman ist somit eine literarische Antwort auf den zunehmenden Fremdenhass unserer Gesellschaft. Er entwirft ein Gegenmodell einer offenen Gesellschaft. In „Bettler und Hase“ gibt es keine unüberbrückbaren Unterschiede. Weder die Sprache noch die Kultur sind in Tuomas Kyrös Roman ein Hindernis. Vatanescu kann kein Finnisch, kann sich aber trotzdem leidlich verständlich machen:
Sie mussten vier schlechtgespro-
chene Sprachen miteinander kombinieren, erst dann
gelangten sie zu einer Art Kommunikation.
Die gelungene Verbindung von verschiedenen Kulturen führt Ming Po in seinen Gerichten vor, mit welchen er selbst seinen finnischen Schwiegervater für sich gewinnen konnte:
Ming kochte für alle, und wie soll man einem Mann
misstrauen, dessen Karelischer Braten einem auf der
Zunge zergeht? Er selbst nannte das Gericht Fhong-Bai-
Braten, nach einem Rezept seiner Mutter, bloß dass er in
der finnischen Variante sämtliche Gewürze wegließ.
Der ganze Roman ist durchzogen von einer leichtgenommenen und daher umso schockierenderen Tragik:
Dem alten Mann fehlten ein Arm und ein Bein.
Er antwortete auf die Frage, die Vatanescu gar nicht
gestellt hatte, indem er erzählte, Arm und Bein seien
während der Reise auf der Strecke geblieben, so wie uns
immer etwas abhandenkommt, der eine vergisst die Uhr,
der andere verliert sein Herz, der Dritte lässt den Mantel
an der Garderobe hängen.
Erzählt wird die meiste Zeit aus der Sicht von Vatanescu. Bei ihm wird nicht zwischen gedachten und gesprochenen Sätzen unterschieden – beide sind kursiv und stechen dadurch schon allein optisch sehr stark hervor. Eine zweite Perspektive kommt mit dem einohrigen Drogen- und Menschenhändler Jegor Kugar hinzu, welcher seine Memoiren schreibt. Dann gibt es noch einen versteckten allwissenden Erzähler, dessen Ironie und Schmunzeln oft zu spüren ist, auch wenn er nur selten so offen hervortritt, wie in dem folgenden Zitat:
Nun war es Sanna Pommakka, die ihre Hand auf Va-
tanescus Hand legte, ohne zu wissen, warum. Ich aber
weiß es, denn ich bin der allwissende Erzähler, ich krie-
che den Figuren unter die Haut, und wenn es nötig ist,
steige ich zum Himmel auf, um sie von oben zu betrachten.
Dadurch, dass auch der „Bösewicht“ des Romans Jegor Kugar zu Wort kommt, wird auch sein Charakter klarer fassbar. Seine derbe Schreib- und Ausdrucksweise bilden einen starken Kontrast zum sonstigen Sprachduktus des Romans. Jegor Kugar stellt den Gegenpol zu Vatanescu dar. Geht es dem einen gut, geht es dem anderen schlecht und vice versa. Der Kriminelle Jegor Kugar sieht in Vatanescu seinen persönlichen Feind und die Ursache für all sein Übel. Zunehmend steigert er sich in eine Art Wahn hinein, in dem er Vatanascu die Schuld für alles gibt. Während Vatanescu sich unabhängig macht, quer durch Finnland reist und ohne sein Wissen im Fokus der ganzen Nation steht, geht es mit Jegor immer weiter bergab. Ohne dass es Vatanescu selbst bewusst wird, entwickelt sich ein immenser Medienhype rund um seine Person. Zufällig ist er immer am Ort des Geschehens:
In den Leserbriefspalten wurde über-
legt, ob vielleicht eine Werbeagentur diesen Typen,
der zufällig immer am richtigen Ort war, erfunden
haben könnte.
Während Vatanescu nichts von seiner unvermuteten Berühmtheit ahnt, verfolgt Jegor Kugar alles mit großem Entsetzen:
Als Jegor Kugar erkannte, welch großer Beliebtheit sich
Vatanescu in den sozialen Medien erfreute, ließ er sich
ebenfalls bei Facebook registrieren. Er wollte seinen
Marktwert testen.
„Einen Freund bekam ich. Meine Mama. Sie wollte
wissen, wann ich sie besuche, sie hatten keinen
Schnaps mehr. [...]“
Vatanescu ist ein sympathischer Antiheld, ein Jedermann, wie er sich selbst oft bezeichnet. Im Buch heißt es über seine Herkunft:
der an einem imaginären Ort in einem imaginären Jahr geborene Vatanescu
Er nimmt jede Arbeitsmöglichkeit an, die sich ihm bietet und schlüpft damit auch gewissermaßen in eine neue Rolle. Er ist, was seine Mitmenschen in ihm sehen, eine Projektionsfläche für Erwartungen, die sein Äußeres hervorrufen. Damit kommt es zu zahlreichen Missverständnissen, welche Vatanescu in der Regel gar nicht erst aufzuklären versucht, sondern schweigend hinnimmt.
Vatanescu ist jedoch nicht der einzige Held oder Antiheld des Romans. Die eigensinnigen Figuren sind eine weitere Qualität des Romans. Selbst Nebenfiguren, welche nur in wenigen Sätzen auftauchen, verleiht Kyrö einen klar erkennbaren Charakter. Besonders liebenswert ist die, um sich Unannehmlichkeiten vom Leibe zu halten, in alle Himmelsrichtungen spuckende Mutter Vatanescus:
Sie blickte nach rechts und
sah eine Reihe Häuser, die genauso aussahen und ebenso
große Gärten hatten. Sie blickte nach links und sah eine
Reihe gleichförmiger Häuser mit großen Gärten. Sie
stand im Freien, weil ihr die Fußbodenheizung im Haus
nicht geheuer war. Als würde unter einem die Hölle Fun-
ken sprühen.
Tuomas Kyrö verwendet gängige Stereotype und Vorurteile so bewusst und überspitzt, dass er sie damit schon fast wieder aufhebt. Dabei verschont er niemanden, so tauchen auch immer wieder einmal schlecht Englisch sprechende Finnen auf („Du ju nou hu ei äm?“) oder auch Holländer auf Motorschlittensafari:
Die Rentiere glotzten Vatanescu mampfend an, ließen
sich von ihm aber ebenso wenig aus der Fassung bringen
wie von allen anderen Jedermännern. Es gab ja mehr
als genug davon, Akademiker auf Skiern, Holländer auf
Motorschlittensafari, Männer in Fernpatrouillen und
Schlagerstars aus den Skizentren.
Manches an „Bettler und Hase“ erinnert stark an Arto Paasilinna. Beispielsweise das Setting – quer durch Finnland bis nach Lappland – einige der Figuren wie z.B. ganz besonders Harri Pykström, oder ganz einfach die vielen völlig verrückten Einfälle. Eine gewisse Nähe zu Arto Paasilinna ist kein Zufall oder Versehen, sondern eher eine kleine augenzwinkernde Verbeugungen des jungen Autors Tuomas Kyrö vor dem Großmeister Paasilinna. Denn Paasilinna taucht mehrmals namentlich im Buch auf, wenn er von den Figuren genannt wird. Harri Pykström beispielsweise ist ein großer Arto Paasilinna-Verehrer, zugleich könnte er selbst eine Figur aus einem Roman von Paasilinna sein (er erinnert mich leicht an Major Remes aus „Im Wald der gehenkten Füchse“ von Paasilinna):
Am Krankenbett schwor Frau Pykström, ihren ver-
rückten, fetten Mann keinen Moment mehr aus den Au-
gen zu lassen. Sogar Jorma schickte aus Australien den
dezenten Wunsch, nicht schon bald zur Beerdigung flie-
gen zu müssen. Mit der Hand auf Arto Paasilinnas Ge-
samtwerk schwor Harri Pykström, es von nun an ruhiger
angehen zu lassen.
Selbstverständlich stammt auch folgende Denkmal-Idee von Harri Pykström:
PS: Ich hätte eine Denkmal-Idee!!! Vor der Hauptpost
wäre ein guter Platz: ein Denkmal für Arto Paasilinna
als Bahnbrecher!!!
Doch nicht nur der Autor Arto Paasilinna wird mehrmals im Roman namentlich erwähnt, auch seine Werke werden angesprochen. Bei ihrer allerersten Begegnung schießt Harri Pykström auf den Beerensammler Vatanescu. Wenige Stunden später schwitzen sie bereits gemeinsam in der Sauna. Zu verdanken ist dies einzig und allein dem Kaninchen, welches im richtigen Moment auf einen Stein springt. Und Harri Pykström als eingefleischter Paasilinna-Fan ist sofort gerührt. Warum? Weil ihn Vatanescu mit seinem Kaninchen sofort an Vatanen mit seinem Hasen im Roman „Das Jahr des Hasen“ von Paasilinna erinnert. Zu Recht. Denn in diesem Buch reist der Held auch mit einem zunächst verletzten Hasen quer durch Finnland. Die Parallelen und Anlehnungen sind so offensichtlich wie ironisch. Allein schon, dass aus Vatanen bei Tuomas Kyrö Vatanescu wird und aus dem Hasen ein Hase, der eigentlich ein Kaninchen ist, zeigen wie selbstbewusst Tuomas Kyrö diese Verbindung offenlegt. Pykström in „Bettler und Hase“ spricht lange von „Das Jahr des Hasen“ und der Verfilmung des Romans. Treu seinem Idol ist für Pykström das Kaninchen eindeutig ein Hase:
Wenn das ein Kaninchen ist,
bin ich Vegetarier!
Während ansonsten im Roman schon sehr deutlich festgehalten wird, dass es sich um einen Hasen, der eigentlich ein Kaninchen ist, handelt.
Überzeugt hat mich der Roman schon vor dem eigentlichen Lesen. Ja sogar schon bevor ich ihn überhaupt das erste Mal aufgeschlagen hatte. Genauer gesagt war es schon „der Hase, der eigentlich ein Kaninchen ist“ aus dem Klappentext, der mich gänzlich für den Roman eingenommen hat.
Die Handlung ist Großteils so verrückt, dass es schon viel Vergnügen bereitet, sie in einigen wenigen Sätzen nachzuerzählen. So gern ich auch mehr nacherzählen würde, ist das doch nicht die vorwiegende Aufgabe einer Rezension. Außerdem erzählt Tuomas Kyrö seinen Roman am besten selbst. Daher sei mir als Abschluss nur eine einfache Nacherzählung eines kurzen Abschnittes aus „Bettler und Hase“ erlaubt, einfach weil es so schön ist:
Auf den Rat des Restaurantbesitzers Ming Po bricht Vatanescu in den hohen Norden Finnlands auf, um Moltebeeren zu sammeln. Im Zug halten ihn drei Jugendlichen für einen Investmentberater. Beim Aussteigen wird er für einen reichen Mann gehalten, der bewusst versucht arm auszusehen, und so findet er sich unversehens in einem neuen Volvo wieder. Nach dem ersten Beerensammeltag trifft er auf Harri Pykström, der zunächst auf ihn schießt, bis er das Kaninchen erblickt. Danach lädt er den „Sizilianer“ Vatanescu zu sich ein und der Tag endet mit viel Bier, Sauna und anschließendem Bad im eiskalten Bach. Am nächsten Tag wird Vatanescu von Frau Pykström nahe den besten Beerensammelplätzen abgesetzt mit Proviant und einem Handy, damit sie ihn mit den Beeren wieder abholen können. Nach unzähligen Blaubeeren und Preiselbeeren und Blaubeeren und Preiselbeeren und Blaubeeren und ... blitzt es endlich gelb auf und Vatanescu verfällt in einen richtiggehenden Moltebeeren-Goldrausch. Nur um danach zu bemerken, dass er zwar mehr Kübel voller Moltebeeren hat, als er tragen kann, aber das Handy irgendwann unbemerkt in den Sumpf gefallen ist...
Von Bülte zu Bülte, ab und zu auf Stegbäumen durchs
Moor, dann wieder bis zu den Knien im Sumpf – so zogen
Bettler und Hase Seite an Seite voran.
Eldorado.
Stollenschuhe.
Moltebeeren.
Exklusivbeitrag
Tuomas Kyrö: Bettler und Hase. Roman. Aus dem Finnischen von Stefan Moster. ISBN 978-3-455-40374-9 19,99 € Hoffmann und Campe Verlag, Hamburg, 2013.
Astrid Nischkauer hat zuletzt über »Variationen in Prosa« von Michael Donhauser auf Fixpoetry geschrieben.