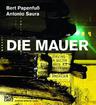weitere Infos zum Beitrag
Kunst und Poesie
Das Mehr an Grenze und die Freiheit des Innern. »DIE MAUER« von Antonio Saura und Bert Papenfuß.
24.07.2013 | Hamburg
„Angesichts der jetzigen, unerhörten Verhältnisse in der DDR würde ich das lieber verneinen“, antwortete Bert Papenfuß der Zeitschrift tip auf die Frage hin, ob er denn ein politischer Poet sei. Das war nicht lang nachdem sein erster Gedichtband, der mehr als ein Jahrzehnt von bis dato nur im literarischen Underground kursierenden Texten versammelte, in der vom ostdeutschen Aufbau-Verlag frisch etablierten Serie Außer der Reihe erschienen war. dreizehntanz wurde 1988 veröffentlicht, mit der tip sprach Papenfuß am 9. November des Folgejahres. An dem Tag also, als die Mauer fiel. Eben dieser Mauer widmet sich nun ein ganzer großformatiger Band, der einige, zwischen 1977 bis 2011 entstandene Gedichte, Aphorismen und Prosa- sowie essayistische Texte des Schriftstellers neben die in den Jahren 1984 und 1985 entstandenen Arbeiten Antonio Sauras stellt.
Anlässlich einer Ausstellung fertigte der spanische Künstler acht abstrakte, gestische Arbeiten, übermalte aber vor allem Fotografien und Postkarten mit expressiven, fetten Pinselstrichen und verteilte Farbkleckse – grau und schwarz, seltener weiß – auf Aufnahmen, die Alltagsszenen im Schatten der Mauer abbildeten. Menschen – »mensch kleingeschrieben durchgestrichen grenze / mensch grossgeschrieben untergestrichen grenze / anfuehrungsstriche mensch abfuehrungsstriche«, heißt es treffender Weise dazu in Papenfuß‘ Gedicht deutschland dunkelhell – werden auf diese Art aus den Fotografien getilgt. Und auch der Horizont, der über der über der Mauer zu sehen ist (oder eben zu sehen wäre) fällt dem aggressiven Duktus Sauras zum Opfer. Lediglich Fenster, so scheint, werden verschont – ganz so, als wolle Saura den BetrachterInnen noch die Restmöglichkeit lassen, zumindest einen schemenhaften Eindruck von dem zu gewähren, was dahinter liegt.
Was genau Saura dazu brachte, diese Darstellungsform zu wählen ist auf den ersten Blick ebenso unklar wie seine Intention. In einem die Bilder begleitenden Text erzählt er, dass die »graue Steinmauer«, die vom Fenster seines Ateliers zu sehen war, ihm in seiner Konzentrationsfähigkeit behilflich war, als »Zäsur zwischen dem beherrschten Tanz und der abenteuerlichen Freiheit«. Ob es sich dabei tatsächlich um die Mauer handelt, die aus Westberlin das abgeschottete, virile Soziotop machte, als das es uns die urbanen Mythenerzählungen verkaufen will, wird jedoch nicht klar. Denn da war ja noch die andere Mauer, die »zwanghaft nahe« stand. Vielleicht handelt es sich bei keiner der beiden Mauern um den sogenannten antifaschistischen Schutzwall, vielleicht aber meint Saura in beiden Fällen eben jenen. So oder so: Durch die Eingriffe, die stellenweise wie zensierende Schwärzungen anmuten, schafft Saura ein Mehr an Grenze. Er limitiert den Blick auf das Geschehen und die architektonischen Gegebenheiten. Durch das Übermalen, so Saura selbst, komme »der groteske und dramatische Charakter einer repressiven Situation ebenso zum Tragen wie der persönliche Ekel vor einem eingemauerten Begehren«.
Das entspricht ziemlich genau dem, was sich aus einigen Texten Papenfuß‘ herauslesen lässt. Nur hat der nicht nur auf eben der anderen Seite gelebt und damit das gesehen, was Saura, bei dem der Blick meist bei der Mauer aufhört, so rabiat wegstreicht, sondern musste sich auch eben an der Zensur vorbeibewegen. Sein Freund Karl Mickel bezeichnete Papenfuß einmal als einen »Meister nicht-syntaktischer Grammatik«. Als »Sklavensprache« wurden die akrobatischen, mit den gängigen Konventionen von Orthografie und Grammatik brechenden Verse Papenfuß‘ bezeichnet. Extrem kodifizierte Kritik, die Straßenslang auf etymologische Figuren und anarchische Rechtschreibung treffen ließen. Papenfuß distanzierte sich auf seine ganz eigene Art von der Fremdzuschreibung: Sklaven hieß eine Zeitschrift, die er gemeinsam mit Stefan Döring, Stefan Ret und Klaus Wolfram ins Leben rief – 1994, im wiedervereinten Deutschland.
Das führt wieder zu Papenfuß‘ unverfänglicher Antwort, die Papenfuß der tip am Tag des Mauerfalls gab. Und wirft die Frage auf: Hat der sich denn wirklich, auch, wenn einige seiner Texte so stark dafür zu sprechen scheinen, als Unterdrückter wahrgenommen? Wollte der sich wehren? Wollte und konnte eventuell gar nicht? Die Lektüre von denen in Die Mauer versammelten Texten liefert keine eindeutige Antwort. Was sie umso stärker macht. Schon Ernst Jandl schrieb ganz recht über Papenfuß: »Zu den bedeutenden Vorzügen des Lyrikers Papenfuß-Gorek gehört es, daß er sich weder auf ein Zukunftsbild beruft, welches […] keinen Wirklichkeitswert besäße, noch aus sich selbst und seiner Einsamkeit ein Modell macht, das für alle zu gelten hätte.« »ich lasse meine ferdichtung taetig eingreifen / eine eindeutige stellungnahme fuer alles schoene / ich besinge den kampf & heisse recht das schlechte / & gut den mut zur noetigen auseinandersetzung / dann & wann streue ich aufmunternde korken ein«, spitzt Papenfuß sein Programm selbst auf ironische Art und Weise zu, beziehungsweise: verkehrt es. Ambivalenzen prägen seine Texte, wo sie am stärksten – was bei Papenfuß zumeist heißt: am kürzesten – sind.
Da, wo sich Papenfuß Lizenzen herausnimmt, nicht nur auf grammatikalischer und orthografischer Ebene, reiben sich seine Texte denn auch am stärksten an den Bildern Sauras. Dessen Worte vom »eingemauerten Begehren« scheinen ihr zynisches Echo in Zeilen wie »hunger, durst & sucht sind die früchtchen der furcht« zu finden. Der – wortwörtlich gesprochen – Insider Papenfuß weiß eben noch besser Bescheid als Saura, der ja selbst schon sein eingeschränktes Sichtfeld thematisiert. Papenfuß weiß, dass und wie sich Repression und Begehren schnell Bahn brechen.
Wo sich in der Gegenüberstellung der künstlerischen Programmatiken die schärfsten Diskrepanzen zeigen, ist Die Mauer auch am eindrucksvollsten. Der Band lebt von seinen Widersprüchen. Den klaustrophobischen Arbeiten Sauras stellt Papenfuß immer wieder die radikale poetische Freiheit des Innern gegenüber, ohne wirklich eindeutig Stellung zu beziehen – ihn zu fragen, ob er denn ein politischer Poet sei, zeugt eigentlich von einem großen Missverständnis. Das Nebeneinander von Bild und Text verspricht nur ein ästhetisches Erlebnis, sondern reflektiert die künstlerische Verarbeitung von historischen Prozessen überhaupt.
»Man trauert den Jericho-Trompeten nach: Bis zum heutigen Tag vermochte es kein einziges, Buch, eine Mauer zu Fall zu bringen«, schließt Sauras kurzer, den Band eröffnende Text. Bleibt allein die Hoffnung, dass es dort draußen genug Bücher gibt, die den Bau einer Mauer verhindern können. Und sei es nur die im eigenen Kopf. Die Mauer ist vielleicht so eines.
Bert Papenfuß / Antonio Saura: Die Mauer. Hardcover, 192 Seiten, 73 Abbildungen, 29,80 Euro. Gestaltung: Ralph Gabriel. ISBN: 978-3-7757-3409-7.. Hatje Cantz Verlag, Meinier/Genf 2012.
Kristoffer Cornils hat zuletzt über »Riot Grrrl Revisited« auf Fixpoetry geschrieben.
© Fixpoetry.com 2013
Alle Rechte vorbehalten
Vervielfältigung nur mit Genehmigung von Fixpoetry.com
Sie können diesen Beitrag aber gerne verlinken