Teil 2: Neue Entwicklungen im Datenschutz, bei der E-Mail-Werbung, Haftung für Blogbetreiber, Ausblick auf künftige Entwicklungen

Gastbeitrag von Rechtsanwalt Dr. Marc Laukemann
Im ersten Teil meines Berichtes habe ich mich vor allem mit der Rechtsentwicklung im Bereich SEO, SEM und Affiliate beschäftigt.
IV. DATENSCHUTZ
1. War da nicht doch was zu beachten?
Google Analytics spielt bekanntlich nicht nur bei der Adwords-Optimierung eine große Rolle. Nach langen Diskussionen mit Datenschützern unter Federführung des Hamburgischen Datenschutzbeauftragten Johannes Caspar kann Google Analytics seit einigen Monaten datenschutzkonform betrieben werden. Nutzer müssen jedoch einige Punkte beachten:
- Den Website-Besuchern muss die Möglichkeit zum Widerspruch gegen die Erfassung von Nutzungsdaten eingeräumt werden. Google hält für diesen Zweck ein Add-On bereit. Bislang war dies nur für Internet Explorer, Firefox und Google Chrome verfügbar. Der Datenschutzbeauftragte hatte daher in der Vergangenheit moniert, dass Nutzer von Safari und Opera keine Widerspruchsmöglichkeit haben. Google bietet nun aber auch für diese Browser das Add-On an, so dass nun alle gängigen Browser berücksichtigt sind.
- Es darf keine vollständige IP-Adresse von Besuchern einer Website getrackt werden. Verwender von Google Analytics müssen daher die “IP-Masken-Funktion” der Google-Tracking-API in dem auf den Seiten implementierten Code aktivieren.
- Wer Google Analytics einsetzt, muss in einer Datenschutzerklärung über die Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen von Google Analytics aufklären und auf die Widerspruchsmöglichkeiten gegen die Erfassung durch Google Analytics hinweisen. Hier sollte auch auf die Website http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de verlinkt werden.
- Im Verhältnis zwischen Verwender von Google Analytics und Google liegt eine Auftragsdatenverarbeitung vor. Die Voraussetzungen des § 11 BDSG wurden in der Vergangenheit jedoch nicht eingehalten. Google hat nun aktualisierte Nutzungsbedingungen eingeführt, die mit den Datenschutzbehörden abgestimmte Regelungen zur Auftragsdatenverarbeitung beinhalten” (PDF des Nutzungsvertrags).
Die Datenschutzbehörden vertreten weiter die Auffassung, dass die Verwendung von Google Analytics in der Vergangenheit rechtswidrig war. Konsequenterweise fordert er deshalb die Löschung der unrechtmäßig erhobenen Altdaten. Dazu muss anscheinend das bestehende Google-Analytics-Profil geschlossen und ein neues eröffnet werden.
2. EU-Richtlinie
Mittlerweile ist der deutsche Gesetzgeber fast ein Jahr im Verzug mit der Umsetzung der EU-Cookie-Richtline des Europäischen Parlaments vom 25.09.2009. Diese sieht unter anderem vor, dass Cookies grundsätzlich nur noch mit Zustimmung des Internetnutzers gesetzt werden dürfen.
Aktuell wird folgender Wortlaut eines neuen § 13 Abs. 8 Telemediengesetzes (TMG) zwischen Bundestag, Bundesregierung und Bundesrat diskutiert:
„Die Speicherung von Daten im Endgerät des Nutzers und der Zugriff auf Daten, die im Endgerät des Nutzers gespeichert sind, sind nur zulässig, wenn der Nutzer darüber entsprechend Absatz 1 unterrichtet worden ist und er hierin eingewilligt hat. Dies gilt nicht, wenn der alleinige Zweck die Durchführung der Übertragung einer Nachricht über ein elektronisches Kommunikationsnetz ist oder wenn dies unbedingt erforderlich ist, um einen vom Nutzer ausdrücklich gewünschten elektronischen Informations- oder Kommunikationsdienst zur Verfügung stellen zu können.“
Bei Umsetzung des Gesetzes in dieser Form dürften Webseiten-Betreiber zukünftig personenbezogene Daten nur noch speichern und nutzen, wenn die Nutzer zuvor unterrichtet worden sind und der Speicherung eingewilligt haben. Natürlich ist völlig unklar, wie eine solche Einwilligung rechtssicher gewährleistet werden kann, so dass man bei strengster Auslegung zu dem Ergebnis kommt, dass der Nutzer bei Betreten einer jeden Webseite zuvor zugestimmt haben muss.
Auch für Webseitenbetreiber nutzergenerierten Inhalten (wie Social Media Dienste, Blogs, Foren, Gästebücher, sonstige Bewertungsplattformen) hat der Gesetzgeber neue Pflichten parat. Diese sollen verpflichtet werden, dem Nutzer zunächst umfassend über seine Absichten zu informieren und ihm die Möglichkeit zu bieten, seine Inhalte vor dem Zugriff Dritter, wie z. B. Suchmaschinen, zu schützen. Insoweit ist als Grundeinstellung die höchste Sicherheitsstufe voreinzustellen.
3. Eine weitere Runde in der Frage: Sind IP-Adressen personenbezogene Daten?
Seit langem ist umstritten, ob dynamische IP-Adressen nun personenbezogene Daten i. S. v. § 3 Abs. 1 BDSG oder diesem Schutzbereich doch nicht unterliegen.
Scheinbar nebenbei erwähnte der EuGH in einem seiner jüngeren Urteile (Urteil vom 24.11.2011, Az. C-7/10), dass er der Meinung ist, dass IP-Adressen personenbezogene Daten sind. Jedoch handelt es sich hier nicht um ein Grundsatzurteil. Der EuGH hatte sich nämlich thematisch nicht mit der vorangegangenen Frage zu beschäftigen. In diesem Verfahren wurde ein Access Provider von einer Verwertungsgesellschaft verklagt. Streitgegenstand war die Einrichtung eines Filtersystems, womit User eines Peer-to-Peer-Netzwerkes identifiziert werden könnten.
Dass diese gespeicherten Daten für den Access Provider personenbezogene Daten im Sinne des § 3 Abs. 1 BDSG sind, wird von keiner Seite bestritten.
Der EuGH hat in diesem Urteil somit nur Unbestrittenes als selbstverständlich in seiner Urteilsbegründung aufgenommen. Es ist also weiterhin davon auszugehen, dass die Frage der Personenbezogenheit von IP-Adressen noch nicht endgültig geklärt worden ist.
4. Ablauf der Übergangsfrist des § 47 Nr. 2 BDSG
Am 31. August diesen Jahres läuft eine sehr interessante Übergangsfrist im Bundesdatenschutzgesetz für die Behandlung von Werbung ab. Bisher durften Daten, die vor dem 01. September 2009 zum Zwecke der Werbung gespeichert worden waren noch nach dem alten § 28 BDSG behandelt werden.
Nach Ablauf dieser Frist des § 47 Nr. 2 BDSG müssen diese gespeicherten Daten zum Zwecke der Werbung allerdings nach dem neuen § 28 BDSG behandelt werden. Dieser sieht unter anderem das sogenannte „Opt-In Prinzip“ bei Werbung vor. Das heißt, dass der Betroffene nun der Speicherung seiner Daten zum Zwecke der Werbung vorher zustimmen muss, wenn nicht die Ausnahmen des § 28 Abs. 3 Satz 2 BDSG einschlägig sind. Daten, die von Unternehmen vor dem 01.09.2009 gesammelt, jedoch zu Werbezwecken noch nicht benutzt wurden, bedürfen ab 01.09.2012 dann der gesonderten Einwilligung des Betroffenen.
V. HAFTUNGSRISIKEN FÜR WEBSEITENBETREIBER
1. Werbung – egal in welcher Form – muss erwünscht sein
Ein Oberlandesgericht hat erst im Februar letzten Jahres in einem Urteil (Leitsätze hier) entschieden, dass der Verbraucher sowohl der Gestattung zur Werbung via E-Mail, Fax oder Telefon gesondert (durch sog. Opt-In – Erklärung) zustimmen muss, und hat den Bundesgerichtshof (BGH) damit in seiner “Payback” Entscheidung bestätigt.
Die Parteien stritten um die Zulässigkeit folgender AGB-Klausel im Rahmen eines DSL-Flatrate-Vertrages.
“Ich bin widerruflich damit einverstanden, dass der Anbieter meine Kontaktdaten (Post-, E-Mail-Adresse sowie Fax- und Rufnummer) zur Beratung und Werbung ausschließlich für eigene Zwecke nutzt und mir auf diesem Wege aktuelle Produktinformationen bzw. den Newsletter zukommen lässt. Meine Einwilligung kann ich jederzeit zurückziehen.“
Nach Auffassung des Gerichts verstieß diese Klauseln gegen die Regelung des § 4 Abs. 1 BDSG, wonach ein Betroffener zur Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten ausdrücklich zustimmen muss. Diese Einwilligung muss die Voraussetzungen des § 4 a Abs. 1 BDSG erfüllen, wonach der Betroffene zwar nicht explizit jedoch aus freien Stücken und bewusst der Nutzung der personenbezogenen Dateien zustimmen muss. Da die Klausel nicht besonders hervorgehoben wurde, war die Einwilligung zur Benutzung der Daten für Werbung per Post nicht erteilt worden.
Auch für Werbung per E-Mail oder Fax hatte der Kläger seine Einwilligung nicht erteilt. Diese hätte nach § 7 Abs. 2 Nr. 3 UWG mittels gesonderter Erklärung oder der Markierung eines Feldes („Opt-In“ Erklärung) erfolgen müssen. Dasselbe war für die Werbung per Telefon zu urteilen, da hierfür § 7 Abs. 2 Nr. 2 UWG gilt.
Aufgrund dieser Rechtsverletzungen hatte das Gericht dem Kläger in allen drei Varianten einen Anspruch auf Unterlassung nach § 1 UklaG zugesprochen.
In diesem Zusammenhang entschied das Oberlandesgericht München mit Urteil vom 21.07.2011 noch strenger.
Es stufte die Klausel
„Von den AGB von Sky, von Kabel Deutschland sowie der Widerrufsbelehrung und der datenschutzrechtlichen Einwilligungserklärung habe ich Kenntnis genommen und bestätige dies mit Absendung dieses Formulars” in Verbindung mit der Regelung “Der Abonnent willigt mit Abschluss dieses Abonnementvertrages ein, dass Sky die angegebenen personenbezogenen Daten auch zu Marketingzwecken für eigene Produktangebote per Telefon, SMS, E-Mail und Post sowie zur Marktforschung nutzen darf”.
als unzulässig ein und eine strikte Trennung einer wettbewerbsrechtlichen Werbe-Einwilligung zu anderen Erklärungen. In diesem Fall wurde eine AGB-Klausel des PayTV Senders sky für unzulässig erklärt.
2. Verfallsdatum von Newsletter-Einwilligungen
Spannend und bisher weitgehend ungeklärt ist die Frage, für wie lange eine einmal erteilte Einwilligung zum Erhalt eines Newsletters für Werbung eigentlich gilt. So kommt es immer wieder vor, dass man auf einer Homepage eine Einwilligung erteilt und erst Jahre später Werbung dieses Unternehmens erhält.
Die Rechtsprechung in dieser Frage ist noch sehr dünn gesät. Das Landgericht Hamburg stellte fest, dass eine Einwilligung, die vor 10 Jahren erteilt und bisher ungenutzt geblieben sei, als verfallen anzusehen ist. Das Landgericht Berlin verkürzte das „Verfallsdatum“ drastisch auf zwei Jahre. Zuletzt verkürzte das Landgericht München I die Frist nochmalig auf 1,5 Jahre.
Bei diesem Thema wird nochmals darauf hingewiesen, dass die Übergangsfrist des § 47 Nr. 2 BDSG abläuft. Daten für Newsletter, die vor dem 01.09.2009 gesammelt wurden, jedoch noch nicht eingesetzt wurden, sollten vor dem 31.08.2012 benutzt werden, da sonst der neue § 28 BDSG hierfür Anwendung findet.
3. Bald magere Zeiten für Abmahnkanzleien?
Die Justizministerin Frau Leutheuser-Schnarrenberger hat für das kommende Jahr interessante Gesetzesänderungen im Bereich des Wettbewerbs- und Urheberrecht angekündigt.
Zweck dieser Gesetzesänderung wird vor allem der Schutz des Verbrauchers vor zu ungerechtfertigt hohen Abmahnungen. In der Öffentlichkeit werden diese Abmahnungen schon seit langem kritisiert. Bisher wurde jedoch in erster Linie nur auf die Kanzleien geschimpft, die aus moralischen Gründen freiwillig auf Umsatz verzichten sollten um den Verbraucher zu schonen. Völlig unberücksichtigt blieb in dieser Diskussion, dass der erste Versuch des Gesetzgebers diese Abmahnungen in der Höhe zu verhindern fehlging. In § 97 a Abs. 2 UrhG werden die Kosten auf 100 € gedeckelt, wenn es sich um einen „einfach gelagerten Fall“ handelt. Die Rechtsprechung ging jedoch in den seltensten Fällen von einem „einfach gelagerten Fall“ aus und sah die Abmahnkosten als gerechtfertigt an.
Diesem Umstand soll nun im zweiten Versuch dadurch begegnet werden, dass der Gesetzgeber für bestimmte Rechtsverletzungen einen Streitwert vorschreibt. Ob dadurch die Massenabmahnungen reduziert oder durch diese Einschränkung noch mehr Abmahnungen verschickt werden um den Umsatzverlust zu kompensieren bleibt abzuwarten.
In diesem Zusammenhang ist besonders interessant, dass auch der fliegende Gerichtsstand des § 32 ZPO im Bereich der Abmahnungen in noch nicht genau erklärter Art und Weise beschnitten werden soll, wie Frau Leutheuser-Schnarrenberger in einem Interview in der Süddeutschen Zeitung erklärte. Dieses Vorgehen könnte durchaus viel effektiver sein, da die Kosten der betreffenden Kanzleien empfindlich steigen könnten.
Zu guter Letzt möchte die Justizministerin für wettbewerbsrechtlich zu Unrecht Abgemahnte einen Kostenerstattungsanspruch im Gesetz verankern.
In allen drei Angelegenheiten lassen genaue Gesetzesentwürfe noch auf sich warten. Erst eine genaue Prüfung wird ergeben wie erfolgreich diese Gesetzesänderungen im Kampf gegen die als zu hoch empfundenen Abmahnungsgebühren sein wird.
Fortsetzung folgt mit einer Übersicht über die jüngste Rechtsentwicklung zur Haftung von Webseitenanbietern, insbesondere bei Bewertungsportalen und neuen Rechtsproblemen bei der Übernahme von Zahlungsvermittlungsdiensten bei Onlineshops.
Der Autor ist Rechtsanwalt, u. a. Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz und beschäftigt sich seit über 10 Jahren mit dem Glückspielrecht in Deutschland (www.wir-beraten-unternehmer.de).
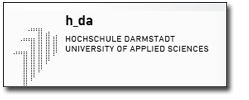 Wie schon 2010 halte ich auch in diesem Jahr wieder eine offene SEO Vorlesung an der Hochschule Darmstadt.
Wie schon 2010 halte ich auch in diesem Jahr wieder eine offene SEO Vorlesung an der Hochschule Darmstadt. ![]()





 Update: Die Show ist mittlerweile online –
Update: Die Show ist mittlerweile online –  Nach einer geselligen
Nach einer geselligen 

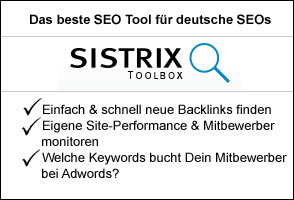














Top Commentators