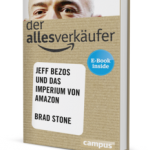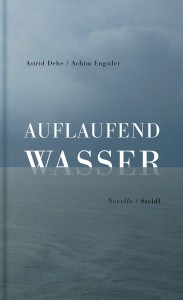Ein Gastbeitrag von René Kohl
»Wenn man klein ist, kann jederzeit jemand Größeres kommen und einem alles wegnehmen. Wir müssen für Chancengleichheit hinsichtlich der Kaufkraft mit den etablierten Buchhändlern sorgen.« Jeff Bezos 1996
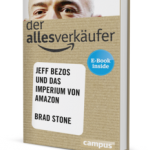
Brad Stone, Wirtschaftsjournalist der New York Times und Bloomberg Businessweek, hat mit Der Allesverkäufer ein außergewöhnlich gut recherchiertes Buch abgeliefert, das dem gewöhnlich äußerst zugeknöpften Amazon-Imperium und seinem kommunikationsgeschulten CEO reichlich oft hinter die Fassade schaut.
Ich habe das Buch vor allem mit Blick auf die jüngere Geschichte, Gegenwart und mögliche Zukunft der Buchbranche gelesen und will mich hier auf diesen Bereich fokussieren.
Bezos erkannte Mitte der 90er Jahre, dass sich das Internet dank der Erfindung des Browsers eines explosiven Nutzerwachstums erfreute, und dachte früh über einen everything store nach. Warum (zunächst) Bücher? Nun, man konnte unmöglich mit allen Artikeln zugleich beginnen, und Bücher waren perfekt für den Start: »Der Käufer wußte […] genau, was er bekommen würde.« Es gab mit Ingram und Baker & Taylor zwei maßgebliche Barsortimente, also Zwischenhändler, man mußte daher nicht alle Verlage einzeln abklappern, und das weltweite Titelangebot war größer, als jeder stationäre Laden es hätte abbilden können – wer dies online konnte, hatte also in punkto Titelfülle schon mal die Nase vorne. Und praktischerweise hatte man auf diesen Titelkatalog direkten Zugriff und bekam ihn von R.R. Bowker, der Firma, die für die ISBN-Nummern in den USA zuständig ist, zur Verfügung gestellt (in Deutschland fand man ähnliche Bedingungen vor – Barsortimente, die gerne die Ware lieferten, und das VLB, das äußerst günstig die Katalogdaten für 1 Mio Titel lieferte – ein ziemlich gemachtes Nest).
Am 16.7.1995 ging die Webseite Amazon.com offiziell online; und schon in der ersten Woche gingen Bestellungen über 12.000 Dollars ein – ein kleines Indiz dafür, wie sehnsüchtig in dem großen Land ein Versandservice wie der von Amazon erwartet wurde. Bereitet war der Boden (auch hier gibt es Analogien zu Deutschland) auch durch eine vorangegangene Expansion der großen Buchkaufhaus-Ketten Barnes & Noble und Borders (seit 2011 insolvent) – die u.a den Marktanteil der unabhängigen Buchhandlungen von 1991 bis 1997 von 33 auf 17 Prozent fallen ließen.
Die ersten Jahre bei Amazon wurden schon häufiger erzählt: Legendäre Weihnachtsgeschäfte, bei denen die ganze Belegschaft vom Lagerarbeiter bis zum Chef anpacken mußte, wohlmeinende Presse- und TV-Berichte, die das Unternehmen häufig über die Kapazitätsgrenzen brachten – und bei allem ein brutales Tempo, das Bezos auf seinem Erorberungsfeldzum im eCommerce vorlegte. Er hatte eine ziemlich klare Vorstellung des Darwinismus, der den Umgang unterschiedlich starker Unternehmen miteinander bestimmte (in Deutschland diskutierte nicht nur die Buchbranche die Verdrängungsmechanismen, mit denen etwa Thalia sich Platz für die Expansion verschaffte) - eine Erkenntnis, die ihm als kleinem Unternehmer genauso klar war wie später als Großkonzernchef, der von eben diesen Größenvorteilen Gebrauch machen sollte
Es zeigte sich allerdings, dass die Großen, wie etwa die Riggio-Brüder, die Chefs von Barnes & Noble, nur halbherzig in das Online-Geschehen eingriffen: »Die Riggios verloren nur ungern Geld mit einem letztlich relativ kleinen Teil ihres Geschäfts und hatten nicht die Absicht, ihre tüchtigsten Mitarbeiter auf ein Unterfangen anzusetzen, das am Ende nur Umsatz von ihren lukrativen Ladengeschäften abzog.«
Genau dieses Innovators Dilemma beschrieb Clayton Christensen in einem von Bezoz’ Lieblingsbüchern 1997. Bezoz selbst zog in Kenntnis dessen, als das Thema eBook auf die Agenda kam, für sein Unternehmen einen anderen Schluss und beauftragte einen seiner besten Männer folgendermaßen: »Ich möchte, dass Sie vorgehen, als wollten Sie den ganzen traditionellen Buchhandel arbeitslos machen«, womit er nicht nur das stationäre Sortiment, sondern durchaus auch die Abteilungen von Amazon, die mit dem Vertrieb physischer Bücher beschäftigt waren, einbezog.
Nach einem kühnen Start geriet Amazon, wie viele andere dotcoms um die Jahrtausendwende auch, ins Straucheln. Die auf Langfrist angelegte Strategie von Bezos kollidierte mit der nun eintretenden Kurzfrist-Analyse, der sich die ganzen Start-Ups in der Ernüchterung nach 9/11 ausgesetzt sahen, und Bezos’ offenbar unerschöpflicher Optimimismus geriet fast an an eine Grenze, für deren Beschreibung sich Brad Stone im Buch viel Zeit läßt: Ein Lehmann Brothers Analyst namens Ravi Suria veröffentlichte eine Reihe von sehr kritischen Bewertungen der Wirtschaftlichkeit Amazon und schaffte es offenbar fast im Alleingang, die Aktie von Amazon in den Keller zu schicken – ein interessantes Detail, das die Verwundbarkeit des Unternehmens auf Grund kritischer öffentlicher Meinung darlegte (mich erinnerte die Passage an das Frühjahr dieses Jahres in Deutschland, als ein TV-Bericht des HR Amazon mindestens einen Monat lang einen ordentlichen Prozentsatz des Umsatzes gekostet haben wird).
Aber Amazon überlebte diese Zeit, und Bezos konnte sich fast sicher sein, dass, wenn sein Unternehmen durchkam, es gestärkt aus der Krise hervorgehen würde. In diesen Monaten erarbeitete man bei Amazon dann das »Konzept des Schwungrades«, mit dem man die Zukunft angehen wollte: »Niedrige Preise bringen mehr Kundenbesuche. Mehr Kunden erhöhen das Umsatzvolumen und ziehen mehr (Provision zahlende) Fremdanbieter an. Das gestattet es Amazon, mehr aus seine Fixkosten – wie etwa den Logistikzentren und den zum Betrieb der Website nötigen Servern – herauszuholen, Diese verbesserte Effizienz gestattet eine weitere Senkung der Preise.« Hat man diese Mechanik erst einmal erkannt, so kann man künftige potentielle Schritte darauf hin prüfen, ob sie Teil dieses Schwungrades sein können, um sie dann einzubauen und andernfalls zu verwerfen.
Tiefpreise sind also ein zentrales Element in der Amazon-Geschäftsstrategie. Falls noch irgendjemand in Deutschland Zweifel hegt, wieso die Buchpreisbindung dem stationären Sortiment dient, findet er in der brutalen Anwendung der Preisdumping-Strategie – wenn es sein muss, Verkaufspreise unter Einkaufspreisen – viele Beispiele in diesem Buch.
Tiefpreise kann derjenige am besten gewähren, der sein komplettes Geschäft der Kostenanalyse unterwirft. Und hier scheint Bezos ein Meister zu sein: Das Buch zeigt eine große Palette an Elementen in der ganzen Prozesskette auf, deren Effizienz von Bezos und seinen Leuten hinterfragt wird; und oft kommen sie bei Amazon zu dem Ergebnis, dass es nicht reicht, Produkte von der Stange einzusetzen, sondern dass man sich seine Lösungen selbst auf den Leib schneidern muss. So bauen sie am Ende die komplette Software für ihr Fulfillment selbst – und bekommen so dafür den perfekten Schlüssel geliefert, um für jede Produktpalettenerweiterung und den sehr elastischen Marketplace gewappnet zu sein.
Wenn man groß genug ist, kann man auch an den Lieferanten-Preisen drehen, und Bezos weiß genau, wann er groß genug ist. Zahlreiche Beispiele im Buch zeigen, wie er die Verlage, die ihn offensichtlich in mehrerlei Hinsicht unterschätzt haben, mit Konditionenforderungen quält, sobald er am Drücker ist. Stone beschreibt im Buch das Gazellen-Projekt: »Im Rahmen des Gazellen-Projektes teile Blakes Gruppe [Lyn Blake war für die Verlagskontakte zuständig] Verleger in Kategorien nach ihrer Abhängigkeit von Amazon ein und fing bei den Verhandlungen mit den verwundbarsten Verlagen an [...] wie ein Gepard eine kranke Gazelle verfolgt.«
Randy Miller, Nachfolger von Blake, »gab selbst zu, dass er ein geradezu sadistisches Vergnügen dabei empfand, Verlegern günstigere Konditionen abzupressen.« Er setzte bei den europäischem Verlegern mit massivem Druck bessere Konditionen durch. Das Prinzip der Stärke scheint sich, wenn ich richtig unterrichtet bin, bis heute nicht geändert zu haben – viele deutsche Verlagskollegen erzählen unter der Hand von dem massivem Druck, dem sie Jahr für Jahr ausgesetzt sind.
Während die Verlage also im Vertrieb mit physischen Büchern durchaus hätten gewarnt sein können, was die Preispolitik und Ausnutzung von Marktmacht anging, wiederholte Amazon seine Verhandlungen mit erneut erstaunlich kurzsichtigen Verlagen zur Einrichtung des Kindle-Shops.
Amazon spielte seine Marktmacht wiederum aus, um an möglichst viele eBooks zu kommen, ließ die Verlage über relevante Aspekte des Geschäfts, vor allem seine (Niedrig-)Preisvorstellungen im Unklaren und sorgte mit dem Startschuss des eBook-Geschäftes bereits für ein extrem ungleich verteiltes Kräfteverhältnis, das sich das Unternehmen dann auch noch in dem mehrjährigen juristischen Streit um das Agency Modell juristisch absicherte, indem es allen Formen einer vermeintlichen oder tatsächlichen Absprache unter den Verlegern im Verbund mit Amazons Mitbewerber, Apple, den Riegel vorschieben ließ.
Einer der Executives eines großen Verlagshauses wird von Stone so zitiert: »Es war ein weiterer Nagel in den Sarg, der sich über uns schloss, ohne dass es jemand merkte, obwohl kein Tag verging, an dem wir uns nicht darüber unterhalten hätten.«
Während die Buchbranche seit ein paar Jahren an den Konsequenzen der Digitalisierung und der starken Vorherrschaft Amazons im Bereich des eBook-Vertriebs zu knabbern hat, setzt Amazon bereits auf das nächste Geschäftsfeld: Mit Amazon AWS steigt Amazon in großem Stile in das Cloud Computing ein – und nutzt auch hier den Umstand, zunächst zum Eigenbedarf Technologie entwickelt zu haben, die man nun auch für Dritte anbieten kann (eine umfangreiche Analyse zum AWS-Projekt gibt es vom FAZ-Wirtschaftsjournalisten Carsten Knop: Amazon kennt Dich schon).
Brad Stone beendet sein Buch mit einigen fragenden Prognosen – die er für Amazon sämtlich mit »Ja« beantwortet:
Kommt Same-Day-Delivery? In eigenen Fahrzeugen? Die Lebensmittellieferung? Amazons Mobiltelefon?Weltweit?
Jeweils ein klares »Ja« von Stone – aber auch zur Frage, ob sich die Kartellbehörden mit Amazons Marktmacht befassen werden.
Dringender denn je, so scheint es, muß eine Chinese Wall zwischen die unterschiedlichen Geschäftsfelder von Amazon gezogen werden. Zu sichtbar wird die negative Ausnutzung der Marktmacht und -kenntnis auf zunächst unterschiedlichen Geschäftsfeldern von Amazon, und die präzise geschilderten Beispiele dieses Machtmißbrauchs durch Stone könnten das Thema schneller auf die Agenda der Kartellbehörden bringen.
Bezos selbst scheint in seinem Optimismus weiterhin unerschütterlich. Nur eines noch, so scheint es, könnte die Entwicklung von Amazon wirklich beeinflussen: Eine veränderte öffentliche Meinung.
Stone nennt in seinem Buch ein wohl relativ junges Bezos-Memo mit dem Titel »amazon.love«. Bezos fragt sich und seine Mitarbeiter darin, warum manche Unternehmen gemocht werden, als cool gelten, und andere nicht. Offenbar sieht er im Coolnessfaktor einen relevanten Erfolgsschlüssel, und offenbar ist er sich nicht ganz sicher, ob es Amazon mittelfristig gelingt, zu den coolen Unternehmen zu gehören.
Wal-Mart zum Beispiel, so sieht er es, »habe es mit einer Fülle sympathischer Konkurrenten in Form kleiner Läden im Ort zu tun, die im Wettbewerb zum Unternehmen stehen« und gilt eher als uncooler Riese.
»Wir haben nicht viele große Vorteile«, wird Jeff Bezos im Gespräch mit dem Verleger Tim O’Reilly zitiert. »Also müssen wir einen Strick aus vielen kleinen Vorteilen drehen.«
Jeff Bezos wird in dem Buch nicht mit Samthandschuhen angefaßt. Seinen Umgang mit den Kollegen und mit seinen Geschäftspartnern empfehle ich nicht zur Nachahmung. Von seinem unermüdlichen Optimierungsdrang, von seiner Neugierde und seinem Optimismus jedoch können wir sicherlich vieles lernen – daher empfehle ich dieses Buch jeder Kollegin und jedem Kollegen sehr zur Lektüre und zur Ermunterung, selbst einen Strick aus den vielen kleinen Vorteilen des stationären Handels zu drehen.