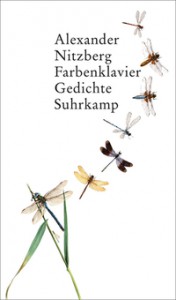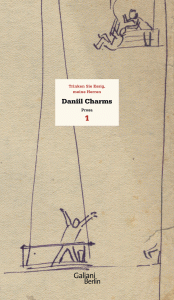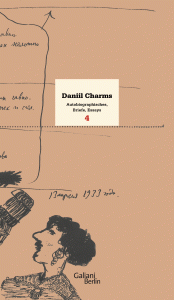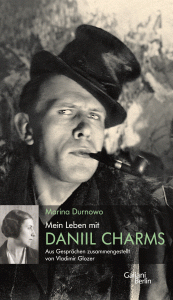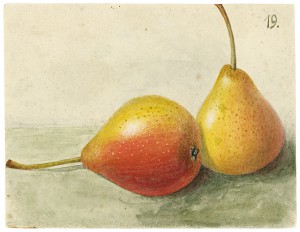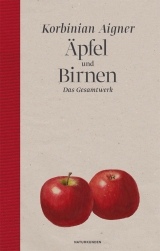Alexander Nitzberg zu seiner Übersetzungsarbeit an „Meister und Margarita“. In einem Interview mit Ralf Diesel.

R. D.: Ist eine Übersetzung nicht grundsätzlich zum Scheitern verurteilt? Und wenn, was würden Sie am ehesten sagen, woran Sie gescheitert sind? Und was haben Sie an der vorherigen Übersetzung verbessert?
A. N.: Na ja, mit derselben Berechtigung könnte man behaupten, unser ganzes Leben sei zum Scheitern verurteilt ... Das wäre wahrlich kein motivierendes Ziel, um fünf Jahre lang an einer Übersetzung zu arbeiten. Natürlich will ich nicht scheitern, sondern im Gegenteil etwas erschaffen. In einer neuen Sprache. Etwas Bleibendes. Die Tragik ist dabei allerdings, daß Übersetzungen gewöhnlich eine kürzere Lebenszeit haben als die Originale. Aber gilt das auch wirklich immer? Wie schaut es zum Beispiel aus, wenn die Übersetzung selbst inspiriert und nicht einfach nur eine reine Routine ist? Ich jedenfalls lese Homer viel lieber in der zweihundert Jahre alten Übersetzung von Johann Heinrich Voß als in einer zeitgenössischen. Sie erscheint mir einfach viel kunstvoller. Und das Alter ihrer Sprache paßt zu Homer weit besser als die Sprache von heute. Doch zurück zu Ihrer Frage: Die Übersetzung ist langsam, prozeßmäßig gewachsen. Nach meiner Entscheidung, Bulgakows Roman aus der Sprache der russischen Moderne in die Sprache der deutschen Moderne zu übersetzen, habe ich erst einmal viel experimentiert. Um zu erkennen, wie weit ich überhaupt gehen kann. Und je weiter ich kam, um so mutiger wurde ich und mußte anschließend die ganze erste Hälfte überarbeiten, um sie an den inzwischen erprobten Stil anzupassen. Vielleicht hätte der Text noch eine oder zwei solcher Schichten benötigt? Wer weiß? Vielleicht würden dann die besonders dramatischen Stellen noch kühner klingen? Vielleicht auch nicht. Nach zwei oder drei weiteren Jahren. Doch so läßt sich ein Werk auch zu Tode übersetzen. Dann ist es doch gut, anzuhalten und sich zu sagen: Ich habe alles gegeben, was zu geben ich in der Lage war. Im übrigen verbessere ich nur sehr selten alte Übersetzungen. Wenn ich mit ihnen unzufrieden bin und neue Möglichkeiten sehe, die mir damals verborgen blieben, dann übersetze ich die Werke lieber neu. Doch manche empfinde ich als vollendet, zum Beispiel meine Übersetzungen der Sonette von Edmund Spenser. Da möchte ich nicht eine Silbe daran verändern. Auch in zwanzig Jahren nicht.
Haben Sie vielleicht wegen einiger Stellen dem Autor gegenüber ein schlechtes Gewissen? Welche eventuell unumgänglichen Lücken im Übersetzen sehen sie als tragisch an?
Warum fragen wir nicht einmal umgekehrt den Autor: Ob er nicht wegen einiger Stellen ein schlechtes Gewissen dem Übersetzer gegenüber hat? Denn M&M ist kein wirklich abgeschlossenes Werk, es hat sehr viele Unebenheiten und, wie ich meine, nicht nur bewußte ... Der Übersetzer, der tief in den Text eindringt, bemerkt sie viel eher als der Leser und muß mit ihnen verzweifelt ringen. Das Tragische sind nicht so sehr die unumgänglichen Lücken als vielmehr das manchmal unumgängliche Füllen dieser Lücken ...
Was achten Sie am meisten – an Bulgakow sowie an M&M?
Seine nicht nachlassende Energie. Er ist immer sprungbereit, niemals lauwarm. Seine Sprache ist nie gefällig. Das fordert heraus, das verlangt geradezu nach einer Konfrontation, einem Kräftemessen. Ich hasse das von den Feuilletonisten mit Anhauch ausgesprochene Wort »einfühlsam übersetzt«. Angesichts der Bulgakowschen Sprache klingt das beinahe wie blanker Hohn. Denn hier darf richtig zugepackt werden. Es ist ein Kampf mit harten Bandagen. Keine philologischen Streicheleinheiten. Und aus dieser widerborstigen Sprache gelingt es Bulgakow mit diesem Roman, eine eigene Welt entstehen zu lassen. Einen Kosmos. Etwas, wo man bis heute ausländische Touristen hindurchführt und ihnen erklärt: Hier hat Margarita gewohnt, dort ist Berlioz überfahren worden. Gut schreiben können viele, aber einen lebenden Mythos erschaffen ...
Ihr „vorläufig abgeschlossenes Lektorat“, wie stark arbeitet das noch in Ihnen?
Ich habe, wie bereits gesagt, irgendwann einen Punkt gesetzt. Ich halte nichts von Werken, die nie zu einem Ende kommen. Das ist ungesund. Erst wenn etwas fertig ist, wird es überhaupt als Ganzes erkennbar, bekommt es überhaupt eine Form. Ich betrachte die Übersetzung also als abgeschlossen und kann seitdem wieder ruhig schlafen. Es sei denn ich arbeite an etwas Neuem.
Wenn das im Umkehrschluss die Frage zulässt: Trieb die Arbeit an der Übersetzung Sie eher aus dem Schlaf oder transportierte sie Sie eher aus der Realität? Oder anders: Wie viel Mühe kostete es Sie, die Fäden in der Hand zu halten?
Ein Schriftsteller und auch ein Übersetzer müssen nicht selbst in Trance geraten, um Trance literarisch darzustellen. Sie müssen jedoch die Kunstgriffe beherrschen, um den Leser in Trance versetzen zu können. Ich war also beim Arbeiten durchaus hellwach. Manchmal fast schon zu wach.
Die Diskussion um Übersetzungen ist eine unter Spezialisten – sehen Sie das auch so?
Die Leser sollten sich mehr zutrauen. Sie, nicht die Kritiker, sollten die Bücher beurteilen. Dazu müssen sie auch nicht unbedingt die Ausgangssprache kennen. Mit etwas Fingerspitzengefühl sind sie in der Lage, sehr viel mehr zu bemerken, als sie ahnen. Oscar Wilde sagte einmal: »Ich kann alles beweisen!« Auch ein Spezialist kann das. Für jede noch so abwegige übersetzerische Entscheidung lassen sich auf der Ebene der Theorie die passenden Argumente finden.
Wenn es den Konjunktiv nicht gibt im Russischen, kann er im Deutschen nicht eine Entsprechung eines Duktus‘ sein?
Natürlich verwende ich in meiner Übersetzung auch den Konjunktiv. Zum Beispiel, wenn Woland spricht, der sich ja meistens vornehm auszudrücken pflegt. Nur in der indirekten Rede wirkt er aus meiner Sicht problematisch. Weil die entsprechenden Sätze auf Russisch eben überhaupt nicht indirekt klingen. Der Konjunktiv würde dort eine wesentlich größere Distanz schaffen, als es vom Autor intendiert ist. Bei der Übersetzung eines Romans aus dem 19. Jahrhundert würde ich an solchen Stellen aus Gründen der Korrektheit vermutlich den Konjunktiv benutzen. Aber die Moderne arbeitet gern mit viel größerer Unmittelbarkeit und besitzt zahlreiche Techniken, um sie zu erzeugen, mithin zu erzwingen.
Wo haben Sie sich mehr poetische Freiheit herausgenommen, bei M&M, Daniil Charms, den Futuristen oder vielleicht bei, wie es in der neuen Übersetzung heißt, „Das hündische Herz“?
Ich glaube nicht an die poetische Freiheit in diesem Sinne. Poesie bedeutet auch immer Bindung. Was dem flüchtig Lesenden als Freiheit erscheint, ist oft das Resultat eines harten Kampfes. Eines Ringens um den treffenden Ausdruck. Nichts wäre einfacher, als den Text einfach Wort für Wort zu übersetzen. Doch genau das wäre vermutlich die größte Entstellung des Originals. Der Sinn fließt hinter und zwischen den Wörtern. Ihn herauszufinden und wiederzugeben, ist die Mühe des Übersetzers. Dieses Ringen verlief in meiner Arbeit oft auf ganz unterschiedliche Weise, unter jeweils neuen Prämissen. Manches wirkt freier, anderes strenger. Aber meistens trügt der Schein. Hinter jeder Lösung steckt ja doch ein Kalkül.
Die literaturhistorische Relevanz ist unbestritten. In welchen Punkten sehen Sie M&M heute als relevant?
Wir haben uns angewöhnt, alle Diktaturen und Ideologien stets wertend zu betrachten. Und merken oft nicht, daß diese Wertung selbst ideologisch-diktatorisch ist. Im Roman verhält es sich sehr viel komplexer. Die Kategorien von Gut und Böse laufen ineinander, wechseln die Seiten, sind auf seltsame Weise diffus. Das Buch wird zu voreilig als Satire bezeichnet, was uns die tröstende Möglichkeit gibt, uns selber als die Guten darin zu sehen, welche über die Bösen lachen. Doch vielleicht ist es ja genau umgekehrt? Vielleicht sind wir es, die verlacht werden?
Meister und Margarita
Michail Bulgakow
Galiani Verlag, Berlin 2012
ca. 600 Seiten
29,99 €
Alexander Nitzberg, Jahrgang 1969, lebt in Wien, übersetzte zuletzt beim Galiani Verlag „Das hündische Herz“ von Bulgakow. Für die Übersetzung von „Meister und Margarita“ war er auf der Leipziger Buchmesse 2013 nominiert. Zahlreich ausgezeichnet, bringt er Werke der russischen Moderne ins Deutsche, u.a. Daniil Charms, trägt vor und verfasst Gedichte, so „Farbenklavier“, erschienen 2012 im Suhrkamp Verlag.
Farbenklavier
Alexander Nitzberg
Gedichte
Suhrkamp, 2012
76 Seiten
€ 17,95
Noch bis 18. Dezember zeigt das Theater am Neumarkt in Zürich eine Bühnenfassung, betitelt „Hundeherz“, so wie es in der früheren Übersetzung hieß, doch geht das Stück von Nitzbergs Übersetzung aus.
Das hündische Herz
Michail Bulgakow
Verlag Galiani Berlin, 2013
ca. 160 Seiten
€ 16,99
Extra erwähnt und wärmstens ans Herz gelegt sei die Werkausgabe des russischen Dichters Daniil Charms, von Nitzberg gemeinsam mit Vladimir Glozer herausgegeben. Nitzberg übersetzte die Gedichte und Theaterstücke (Band 2 und 3), Beate Rausch die Prosastücke und Autobiografisches (Band 1 und 4). Es gibt diverse Grafiken, die Ausgabe ist gebunden, kommt mit Lesebändchen und in Fadenheftung. Ergänzt wird sie durch einen Band mit Erinnerungen von Charms' zweiter Ehefrau, Marina Durnowo. Vladimir Glozer zeichnete Gespräche auf, die er 1996 mit ihr führte. Übersetzt von Andreas Tretner.
Trinken Sie Essig, meine Herren
Daniil Charms
Werke, Band 1 - Prosa
Übersetzung von Beate Rausch
Verlag Galiani Berlin, 2011
272 Seiten
€ 24,95
Sieben Zehntel eines Kopfes
Daniil Charms
Werke, Band 2 - Gedichte
Übersetzung von Alexander Nitzberg
Verlag Galiani Berlin, 2011
320 Seiten
€ 24,95
Wir hauen die Natur entzwei
Daniil Charms
Werke, Band 3 - Theaterstücke
Übersetzung von Alexander Nitzberg
Verlag Galiani Berlin, 2011
352 Seiten
€ 24,95
Du siehst mich im Fenster
Daniil Charms
Werke, Band 4 - Autobiographisches
Übersetzung von Beate Rausch
Verlag Galiani Berlin, 2011
256 Seiten
€ 24,95
Mein Leben mit Daniil Charms
Marina Durnowo
Verlag Galiani Berlin, 2010
176 Seiten
€ 16,95