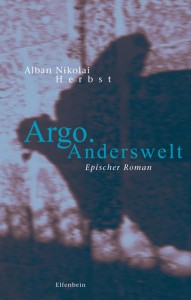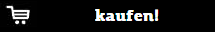Alban Nikolai Herbst über Phantastik und mehr. In einem Interview mit Ralf Diesel.
Gerade erschien im Elfenbeinverlag der letzte Band der Anderswelt-Trilogie von Alban Nikolai Herbst: Argo. Anderswelt. Damit ist dieses einzigartige Unterfangen, das 1998 begann, fertiggestellt. Herbst entblättert eine phantastische Welt, die nicht parallel zur realen läuft oder mit dieser zusammenstößt, beide verschränken sich. Ausgangsort ist das real existierende Berlin, mit einem real existierenden Alban Nikolai Herbst nebst seiner Autorenschaft und den Bars, die er tatsächlich aufsucht. Doch von dort gibt es Einfallstore in die Anderswelt, die sich von der realen vor allem darin unterscheidet, dass sie im wahrsten Sinne des Wortes entgrenzt ist. Schauplätze aus London, Paris, Buenos Aires usw. finden sich in der Anderswelt nebeneinander wieder, Herbst, der Autor, begegnet den von ihm erfunden Protagonisten. Das zweite Kapitel ist eine Interjektion zur Orientierung, ein Glossar zu den Figuren und Orten der Anderswelt. Durchaus hilfreich.
Herbsts durchkomponierte Sprache ist dabei ganz eigener Herkunft und im Ganzen bedeutend. Sprache birgt eine Sinnlichkeit, wird erst da sinnlich, wo sie der Vielschichtigkeit der Sinne gerecht wird. So ist Herbsts Schreiben sinnlich, musikalisch, bildhaft, vielschichtig. Eben Schreiben.
Ein auf allen Ebenen hoch angelegter, reicher Genuss.
Warum Phantastik heute? Ist es nicht als Genre überkommen?
Wieso sollte es? Der Realismus ist überkommen. Jedenfalls das, was unter ihm verstanden wird. Er ist ästhetisch eine historische Kategorie, die sich in unserer Gegenwart genau so wenig mehr halten kann, wie es nationalistische Vorstellungen können. Phantastik öffnet, Realismus setzt fest.
Kybernetischer Realismus – ist das die Verdinglichung des Menschen oder die Menschwerdung des Einzelnen? Funktionieren und nicht Funktionieren stehen im steten Widerstreit.
Insofern die Kybernetik immer Bewegung voraussetzt, kann ein Kybernetischer Realismus gar nicht verdinglichen, selbst wenn er wollte, also wenn seine Vertreter es wollten. Den Begriff habe übrigens ich selbst geprägt – er ergab sich aus den Erfahrungen mit meinen Romanen seit „Wolpertinger oder Das Blau“ von 1993. Was in der Phantastik oft noch ungefähr, statuarisch oder „rein“ atmosphärisch zu sein scheint, bekommt im kybernetischen Realismus eine spürbare, vor allem: bewußte Richtung. Das Phantastische entspricht, um meine Position an einem Modell zu verdeutlichen, dem Unbewußten, der Kybernetische Realismus dem, was aus dem Unbewußten und Verdrängten wieder herausgehoben worden ist („Wo Es ist, soll Ich werden“ [Freud]). Während wir dem Phantastischen mehr oder minder ausgeliefert sind, stehen wir im Kybernetischen Realismus selbst am Ruder oder können den Steuermann zumindest beobachten.
Andererseits bleibt das Mögliche in seinen Rechten, das durch den historischen Realismus zugunsten der Ware bestritten und als Ware festgenagelt und tauschbar gemacht wird; zu den Menschen verhält er sich letztlich nicht anders: Eben das ist die Kritik, die der kybernetische Realismus am historischen übt. Insofern spiegele ich Ihnen den ersten Teil Ihrer Frage sofort auf den historischen Realismus zurück. Daß dieser in der Gegenwartsliteratur so beliebt ist, hängt schlichtweg damit zusammen, daß er grob simplifiziert, und zwar prinzipiell. Er ist ein Filter, der alles ausscheidet, was nicht sein soll. Indessen der Kybernetische Realismus - als eine Weiterführung sowohl der Phantastik als auch des Magischen Realismus, die er eben auch ist – sich der Tiefen und Untiefen, über die zu segeln ist, immer ebenso versichert wie der Winde; und er versucht, nicht, sie zu begradigen, einzuengen, wegzuleugnen, sondern für den Menschen in Bewegung zu setzen. Gleichzeitig vergißt er nicht, daß es sich eben um den Versuch handelt. Was er also unternimmt, unternimmt er angesichts des Bewußtseins, daß es sehr wohl Tragik gibt: Verhängnisse im antiken Sinn.
Der Unterschied zum Magischen Realismus, worin besteht er für dich? Sind es hier mythologische, dort psychische Substanzen?
Der Kybernetische Realismus integriert den Historischen und den Magischen Realismus, sie sind Teilsummen von ihm, und zwar grade auch dort, wo sie einander ausschließen. Theologisch gesprochen, beschreibt er agnostisch Prozesse, ohne aber die Wirkmacht des Religiösen zu übersehen oder gar zu bekämpfen. Deshalb spielen in ihm mythische Ensembles eine ebenso große Rolle wie positivistische. Vergessen Sie nicht, daß er nicht nur den Forderungen der jungen Moderne verpflichtet ist, die aber in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts zu geradezu tabuhaften Normen erstarrten, sondern besonders auch aus der Postmoderne entstand, die diese Normen wieder zerschlagen hat, kunstglücklicherweise. Es konnte nicht angehen, daß nur noch dissonant erzählt werden durfte; aber ebensowenig kann es, auf der anderen Seite, angehen, das pure Entertainment zum Kunstgrund zu machen, also die „rein“ harmonische Komposition – ob nun in der Literatur, in der Musik oder sonstwo. Wir müssen lernen, über sämtliche Mittel zu verfügen: so souverän, wie es nur geht. Die Fülle von Welt auf Ausgedünntes herunterzuabstrahieren, nur, damit man das Gefühl der Übersichtlichkeit, also von Autonomie hat, ist ein falscher Weg. Ich sage das in Richtung derer, die etwas dann besonders gut finden, wenn es sogenannt einfach ist, sogenannt schlicht, etwa die Sprache. Welt ist nicht schlicht, sondern komplex. Gerade deshalb ist es nötig, daß wir zu steuern lernen, also kybernetisch zu denken, zu fühlen und zu handeln. Nicht auf ein Gesondertes konzentriert zu sein, ein Herausgenommenes, sondern simultan mit dem Vielen umgehen zu können, ist die zeitgenössische Forderung. Die Jungen sprechen von Multi-Tasking-Fähigkeit: Diese ist eine Grundlage jeglicher zeitgenössisch relevanten Dichtung. Wirklichkeit ist mehrdimensional. In Jan Kjærstads, des großen norwegischen Romanciers, neuem Roman (Ich bin die Walker Brüder, dtsch. von Bernhard Strobel, Septime Verlag Wien, 2013) steht der klasse Satz, gesprochen von einem Vierzehnjährigen: „...ich bin eine wandelnde Verteilerdose und meine Fantasie deckt ständig neue Verbindungen zwischen den sonderbarsten Phänomenen auf“. Und noch eine Bemerkung, die in eine ganz ähnliche Richtung zielt, findet sich da: „Es ist die Liebe, die schwer zu verstehen ist, nicht der Haß.“ (S.404 und S.307)
Das Ungefähre in deinen Geschichten ist umringt von Dingen, die präzise ausformuliert sind. Ist es beabsichtigt, das Unbekannte auszusparen, seiner nicht ansichtig zu werden? Oder geht es um ein prinzipielles Nicht-begreifen-Können?
Ob wir etwas prinzipiell nicht begreifen können, können wir doch gar nicht wissen. Schon insofern ist Ihre Frage kontraproduktiv. Und selbstverständlich ist sie monotheistisch-religiös, insofern sie dem Tabu dient, Gott anzufassen. Auch, wenn Kants Kategorien der Erkenntnis stimmen, was wahrscheinlich der Fall ist, haben wir längst Wege gefunden, wahre Aussagen jenseits aller Anschauung zu treffen. Dennoch gibt es einen Unterschied zwischen sinnlicher Evidenz und tatsächlicher wahrer Aussage, also der Deckungsgleichheit von Urteilssatz und Gegenstand. Wir erleben manches als unwirklich, das dennoch wirkt; das macht den Charakter des Unheimlichen aus. Machen Sie sich klar, daß es gar nicht so bedeutend ist, ob etwas tatsächlich existiert oder nicht. Wichtig ist, daß es gedacht und/oder gefühlt wird. Für Bachs h-moll-Messe muß es den Einzigen Gott weder geben noch je gegeben haben; es genügte, daß der Komponist an ihn glaubte. Diese Materialisation von etwas, das möglicherweise gar nicht existiert, existiert dann und: wirkt faktisch. So ist das mit sehr vielen Vorstellungen. Marcus Braun sagt, was gedacht werden könne, das werde geschehen.
 Das Ungefähre steht bei mir oft für das Mögliche, für etwas, das noch unentschieden ist, was es werden wird, aber dennoch schon da ist, spürbar. Sie können von Ahnungen sprechen, aber auch von Visionen, politischen oder künstlerischen. In der Möglichkeit steckt eine Freiheit, die das präzise Ausformulierte nicht haben kann. Deshalb spreche ich immer wieder von einer Möglichkeiten-Poetik, um die es besonders meinen Romanen getan sei. Daß in uns allen Möglichkeiten angelegt sind, von denen wir vielleicht gar kein Bewußtsein haben, ist genau das, was einen großen Teil unserer Freiheit ausmacht, wenn nicht sogar insgesamt sie. Gleichzeitig gibt es aber auch die konkreten Geschehen und Geschichten – das, wie etwas wurde. Insofern wir Bewußtsein haben, sind wir geschichtliche Wesen. Wäre Wirklichkeit auf ihre Möglichkeiten beschränkt, ließe uns das völlig verschwinden; es gäbe dann keine Identität, auch nicht kurzzeitig. Wir fühlen aber, und mit Recht, jede und jeder ihr und sein Ich. Also darf – und kann es auch gar nicht – ein Roman sich darüber nicht hinwegsetzen,- sofern er für Menschen geschrieben ist. Andere Romane, aber, würden mich gar nicht interessieren.
Das Ungefähre steht bei mir oft für das Mögliche, für etwas, das noch unentschieden ist, was es werden wird, aber dennoch schon da ist, spürbar. Sie können von Ahnungen sprechen, aber auch von Visionen, politischen oder künstlerischen. In der Möglichkeit steckt eine Freiheit, die das präzise Ausformulierte nicht haben kann. Deshalb spreche ich immer wieder von einer Möglichkeiten-Poetik, um die es besonders meinen Romanen getan sei. Daß in uns allen Möglichkeiten angelegt sind, von denen wir vielleicht gar kein Bewußtsein haben, ist genau das, was einen großen Teil unserer Freiheit ausmacht, wenn nicht sogar insgesamt sie. Gleichzeitig gibt es aber auch die konkreten Geschehen und Geschichten – das, wie etwas wurde. Insofern wir Bewußtsein haben, sind wir geschichtliche Wesen. Wäre Wirklichkeit auf ihre Möglichkeiten beschränkt, ließe uns das völlig verschwinden; es gäbe dann keine Identität, auch nicht kurzzeitig. Wir fühlen aber, und mit Recht, jede und jeder ihr und sein Ich. Also darf – und kann es auch gar nicht – ein Roman sich darüber nicht hinwegsetzen,- sofern er für Menschen geschrieben ist. Andere Romane, aber, würden mich gar nicht interessieren.
So geht in manchen meiner Erzählungen das, was wir nicht verstehen, ich vielleicht auch selbst nicht verstehe oder wovon wir nur anfangs nicht verstehen, Hand in Hand mit sagen wir „gesicherten“ Erzählsträngen, wie man sie aus der konventionellen Literatur gewöhnt ist. Kybernetische Erzählformen verzichten also nicht auf die klassische Geschichte, verzichten nicht auf den sogenannten Plot, aber sie erschöpfen sich auch nicht in ihm. Romane dieser Art sind keine versteckten Drehbücher für den Spielfilm, sondern was in ihnen geschieht, das ist wirklich nur in einem Roman möglich. In der Dichtung steht selbstverständlich die Sprache selbst im Zentrum der erzählerischen Matrix.
Spricht aus dem Unbekannten das nicht Gelebte aus der Vergangenheit, wo es in der früheren Phantastik das Abgelebte war, das aus der Vergangenheit sich meldet und Ansprüche stellt? Siehst du da einen Paradigmenwechsel innerhalb der Phantastik? Und wenn, worauf würdest du ihn zurückführen?
Ich denke nicht, daß sich in der bisherigen Phantastik allein das, wie Sie formulieren, „Abgelebte“ meldet; es meldete sich immer auch sowohl ein Nichtgelebtes wie Gelebtes, aber in jedem Fall etwas, das mit „realistischen“ Erklärungsmodellen nicht aufzuschlüsseln war. So gesehen bezeichnet das Phantastische – das ich unbedingt von der sog. Fantasy unterscheiden will, wiewohl es Überschneidungen gibt – die Verbildlichung kollektiv unbewußter Ängste und Hoffnungen; daß deren Gründe nicht bewußt sind, sagt ja eben nicht, daß sie nicht seien. Sofern also von einem Paradigmenwechsel überhaupt gesprochen werden kann – ich sehe eher eine organische Weiterentwicklung -, dann nur insofern, als es jetzt um die bewußte und/oder die bewußtwerdende Verfügung geht – um Aufhebung von Verdrängungen nicht durch eineindeutig logische Erklärung, sondern durch den Willen, sich auf das Unheimliche einzulassen, d.h. kulturelle Codierungen zu lernen und zu nutzen, die uns erst einmal fremd sind. Und zu begreifen und damit umzugehen, daß wir selbst – eines jeden/einer jeden von uns Ichs – nicht eineindeutig, sondern höchst ambivalente kulturelle Konstrukte sind.
In welchem kulturellen Kontext verortest Du selber Deine Geschichten?
Ich spreche bewußt von kybernetischen Realismus, d.h. ich erzähle von dem, was ist. Man muß nur den Gedanken zulassen, daß auch Möglichkeiten sind, als Möglichkeiten. Sie selbst schon wirken, egal, ob sie sich bereits realisiert haben oder nicht oder ob sie sich jemals realisieren werden. Es geht, um das noch einmal zu betonen, nicht um Fantasy, d.h. nicht um Eskapismus, sondern genau das Gegenteil wird avisiert. Und außerdem: Die klassische Phantastik tendierte zum politischen Konservatismus, war nicht selten sogar antiemanzipativ-reaktionär. Was unter anderem daran liegt, daß sie die Vorstellung einer stehenden, gleichsam ewigen Zeit, eines Kontinuums vertrat, bzw. nahelegte, aus dem es kein Entkommen gibt. Genau das ist im kybernetischen Realismus als einer Spielart der phantastischen Literatur anders.
Pluralität und Diversität des Ichs : Was hältst du von Fernando Pessoa? Sind deine Figuren - und darunter zähle ich jetzt auch dich – nicht alle ein heterogenes Ich, das mit einem Heteronym jeweils in Einzelauftritten agiert?
Mit dieser Frage war zu rechnen. Tatsächlich aber habe ich Pessoa nie gelesen. Das hat verschiedene Gründe, zu denen unter anderem gehört, daß ich im Hinblick auf Ich-Konstruktionen eine zu starke Nähe fürchte. Jedenfalls habe ich, trotz vieler Empfehlungen, bis heute einen riesigen Bogen um Pessoa gemacht. Sein Buch der Unruhe steht unangerührt in meiner Bücherwand. Sie können es auch so sehen: Ich will mir in meine Ästhetik nicht hineinreden lassen.
Was die Heteronymie anbelangt, ist dem zum einen zu entgegnen, daß zwar alle erzählten Ichs etwas von mir selbst haben und haben müssen, aber das erschöpft sie nicht, ihr Wesen nicht, sondern ist nur einer ihrer Aspekte unter sehr vielen mehr. Allein ihre nur-sprachliche Existenz macht sie zu ganz Anderen, als ich einer bin; und sie entwickeln sich auch anders als ich, was an der Logik des narrativen Settings liegt, in das sie eingebunden sind und die ihnen die Existenz überhaupt erst verleihen. Ich selbst hingegen bin auch außerhalb meiner Bücher und insofern vielleicht nicht völlig, aber doch eben sehr anders. Eigentlich ist es eine Banalität, das zu sagen. Noch der allerautobiografischste Text schafft nicht ein Urbild nach, gewissermaßen die Person zum zweiten Mal, sondern eine ganz andere, die auf die Texthaftigkeit ihrer Existenz, also auf unsere Imaginationskraft, angewiesen bleibt, die ihr zudem im Wechselspiel zwischen Leser:in und Text Züge der Auffassungsmöglichkeiten eben ihrer Leser:innen verleiht. Mimesis schafft ja nicht noch einmal, was ist, sie verdoppelt nicht einfach, sondern interpretiert es: übersetzt es in ein anderes Medium. Ceci n‘est-ce que pas un pipe.
Vollzieht das Individuum bei dir nicht eine sentimentale Immigration ins Selbst, um nicht in der gesellschaftlichen Suppe ausgekocht zu werden? So eine Art Nein ohne nein zu sagen...
Eine Art Nein, die Ja sagt. Eine Art Ja, die Nein sagt. Und beides zugleich. Ich habe wiederholt geschrieben, das Ziel aller großen Kunst bestehe darin, den Satz vom Ausgeschlossenen Dritten zu widerlegen. Sie hat eine Idee von Freiheit, die es in der faktischen Realität, die notwendig ist, nicht gibt. Deshalb kann von Immigration überhaupt nicht gesprochen werden, sondern im Kybernetischen Realismus begibt sich das Individuum in die (unbekannte) Welt; es ist Pionier. Wie gesagt, ich habe ihn nicht gelesen, aber mein Instinkt sagt mir, daß Pessoa genau das nicht mitgemacht hätte, daß er im Gegenteil in seinen verschiedenen Ich-Aspekten introvertiert war. Da liegt möglicherweise ein so gewaltiger Unterschied zu meinem eigenen Ansatz, daß man vor lauter Wald den ganzen Baum nicht mehr sieht.
Woraus speist sich die Lust der Protagonisten, Prozesse anzunehmen, sogar auf sie zuzusteuern, unmittelbar in eine Auseinandersetzung zu gehen – und eben nicht auszuweichen und das Weite zu suchen?
Na ja, das kann man so wirklich nicht sagen, daß alle Personen meiner Romane eine solche Lust empfünden; im Gegenteil, es sind nur wenige. Aber denen gilt mein besonderes Interesse, denen gilt auch meine erzählerische Sympathie. Es sind nicht selten Widerstandskämpfer, bisweilen auch Gauner, die sich hindurchlavieren – auf jeden Fall versuchen sie, nicht hilflos zu bleiben. Dennoch ist das Gros meiner Figuren geworfen, ohne manchmal auch nur zu merken, in welche Verhängnisse, Abhängigkeiten und Schicksale man sie eingespannt hat, sondern sie oder die meisten von ihnen versuchen, sich irgendwie zu arrangieren, als wäre das, was ihnen widerfährt, tatsächlich frei gewählt. Genau das aber entspricht ja der Sitiuation und Haltung der meisten realen, ich meine: „tatsächlichen“ Menschen, wie auch überhaupt die Erzählungen kaum je etwas erzählen, das nicht längst da wäre – nur daß ich es verfremde oder es – leider hab ich grad nicht parat, von wem der Ausdruck stammt – zur Kenntlichkeit entstelle. Doch auch bei den von mir geschätzten Personen, die sich den Fährnissen „stellen“ und sie zu beherrschen versuchen, ist zu fragen, was ihnen denn anderes eigentlich übrigbleibt? Wenn man etwas erkennt, kann man ja nicht wirklich zu sich sagen: Ich sehe das nicht, ich sehe das nicht. Sondern die Erkenntnis fordert die Haltung. Vergessen ist allenfalls eine unbewußte, nie aber eine bewußte Option. Was aber in der Tat stimmt, das ist, daß die Formen von Widerstand, denen meine Lieblingsfiguren anhängen, schließlich lustbetont werden. Die Personen lernen, ihre Lust aus dem Widerstand zu ziehen – etwas, das eine große Motivationskraft erzeugt. In etwas, das wir gerne tun, sind wir besser, als in dem was, was wir nur ungern tun. Lust ist in meinen Büchern überhaupt eine zentrale Kategorie.
Zum Manierismus, der dir unterstellt wird, und zur Mythologie: Ist die Selbstbezüglichkeit inszeniert, gewollt, geplant? Ist sie unausweichlich, sobald ein Ich ins Zentrum gerät? Weist die mythologische Erfahrung nur aufs Ich oder darüber hinaus, wo doch Mythologie stets über ein Ich hinausweist? Worauf verweist Mythologisches bei dir?
Ich glaube nicht, daß man Manierismus und Mythologie analogisieren kann, weder bei mir noch generell. Ein selbstbezügliches Buch muß durchaus nicht manieriert geschrieben sein, das geht auch vollkommen schlicht. Die Frage ist aber, was unter Manierismus überhaupt verstanden wird. Ich habe manchmal den Eindruck, daß dieses seltsamerweise fast immer als Vorwurf verwendete Wort auf Sprachverhalten angewendet wird, die sich nicht an den Allgemeinton halten, sei es, weil sie sehr genau sind, sei es, weil ihnen eine Schönheit des Tons vorschwebt, den sie erreichen wollen. In meinen Büchern hängt das oft mit der Rhythmisierung meiner Sätze zusammen. Ich denke die Betonung meiner Sätze mit, baue sie so, daß möglichst nur eine einzige Betonung möglich ist, nämlich, um einen ganz bestimmten Inhalt auszudrücken und auch bestimmte Empfindungen auszulösen. Betont man den Satz anders, dann klingt er seltsam, eben manieriert, betont man ihn richtig, wird er leichtfüßig, nahezu getanzt. Aber ich habe den Eindruck, daß viele Menschen, wenn sie lesen, einen Klang gar nicht mehr hören. Ihr Geist reduziert Texte auf Handlung, auf den sogenannten Plot, sehr oft auf eine „Botschaft“ usw. Daß es sich bei Dichtung auch um Musik handelt, auf diesen Gedanken kommen sie gar nicht. Tatsächlich ist jede Seite eines Romans aber auch eine Seite Partitur. Um es so zu sagen: Die meisten Leser können sich nicht nur aus einer Notenseite nicht vorstellen, wie die Musik klingt, sondern sie können oft nicht einmal die Noten lesen.
Und zur Mythologie: Sehen Sie, unsere Gegenwart ist derart komplex geworden und wir vertrauen so vielen Geräten, die wir zur gleichen Zeit in keiner Weise mehr durchschauen, daß unser gesamtes Verhältnis zur Wirklichkeit ein mythisches längst wieder ist. Das reflektiere ich nur, das spiegele ich nur in meinen Arbeiten. Gleichzeitig haben sich aber viele Mythologeme über Jahrhundert in uns Menschen erhalten, sind tief in unsere Kulturen eingeschrieben. Es kommt ja nicht von ungefähr, daß Computerviren oft die Namen von Dämonen, Drachen und sonstigen mythischen Ungeheuern tragen. Mythen sind Legenden, die aus dem Versuch entstanden, sich die Welt zu erklären – meist über so lange Zeiträume hinweg, daß sie ein Eigenleben bekamen und sich in den kulturellen Fantasien fast eigenbewegt weiterentwickelt haben. Bis zum heutigen Tag. Hinzu kommt das durch die Globalisierung verursachte Aufeinanderprallen höchst verschiedener historischer Zustände von Kultur. Denken Sie an die Renaissance der dogmatischen Religionen. Auch das sind, als geschichtliche verstanden, mythologische Vorgänge. Ein zeitgenössischer Roman, in dem sich davon keine zumindest Spuren finden, mag alles mögliche sein – realistisch aber ist er nicht.
In welcher Musik siehst du den innigsten Konnex?
Meinen Sie Gattungen? Ich kann mit dieser Frage nicht so arg viel anfangen, muß jetzt raten und deshalb in den Nebel hinein antworten. Ich bin komplexen Musiken sehr verbunden; das reicht von der Renaissance über den Barock in die Spätromantik bis in die Neue Musik. Es meint dabei auch den Jazz, Michael Mantler, Christoph Lauer usw. Je einfacher eine Musik ist, desto weniger erreicht sie mich. Das gilt für Madonna, Michael Jackson und die Beatles ganz genau so wie für Arvo Pärt. Ich ertrage es einfach nicht, wenn ich permanent mit Buttercreme vollgestopft werde.
Musik und Politik – Ligeti – wie ist dein Standpunkt dazu?
Wozu? Zu Ligeti? Muß man da einen Standpunkt haben? Es reicht doch völlig, hinzuhören und zuzulassen.
Für Musik und Politik gilt das Gleiche wie allgemein für Kunst und Politik. Beide sind immer aufeinander bezogen, ob nun in der bewußten Aktion oder nicht. Allerdings bin ich ausgesprochen skeptisch, was die Frage anbelangt, ob man mit Kunst die Politik verändern könne. Wenn das geht, dann nur sehr indirekt: indem die Leser, Hörer, Betrachter sensibilisiert werden - zum Beispiel für „fremde“ kulturelle Codierungen. Und das, in der Tat, erreicht sich am besten durch Empathie. Schon deshalb halte ich es für unumgänglich, daß sich die Künste – und eben auch die Literatur – nicht um die Erzeugung großer Gefühle herummogeln. Ironie mag der Erkenntnis dienen, schafft aber keine Herzensbildung, schon gar nicht Liebe.
Hin zu Bild und Raum. Nimmt man das Musikalische als treibende und zentrale Kraft, das Fließen des Wassers, so bilden sich doch Untiefen und es entstehen Gischt und Strudel – Bilder von Kraftakkumulationen. Wärest du damit einverstanden, die Bilder als das Ziel zu bezeichnen, zu dessen Erreichen die Musik das einzig geeignete Steuerungsinstrument ist? Ursprung die Musik, Ziel das Bild, Medium die Sprache?
Das ist mir zu schematisch und darum zu simpel. Bisweilen ist auch einfach „nur“ die Musik das Ziel, und es kann auch immer mal wieder sein, daß ein Bild als Steuerungselement eingesetzt wird. Überhaupt habe ich ein Problem damit, durch eindeutige Zuordnung zu trennen. Vielmehr kann ein Erzählmotiv verschiedene Aspekte haben, musikalische, bildliche, sinnhafte, und je nach Perspektive sieht man etwas anderes, wiewohl alles immer zu gleicher Zeit wirksam ist. Aber nicht jeder Aspekt muß immer vorhanden sein, manchmal sind es nur zwei simultane Aspekte, anders wo, bzw. zu anderer Zeit achtzehn, dann wieder nur drei usw. Es kann auch sein, daß die Aspekte in Bezug auf etwas verschiedene und verschieden viele sind. Es kann überdies sein, daß Aspekte auf Leser wirken, die der Autor selbst gar nicht bemerkt hat. Auch insofern gilt der Satz, daß ein Text mehr als sein Autor wisse – allerdings möchte ich das auf „wissen könne“ einschränken: Es muß nicht so sein, aber es besteht die Möglichkeit.
Weiter mit dem Individuum: Öffnen und Schließen von Räumen, Begrenzung und Entgrenzung sind zentral, hier seichter, dort härter angelegt. Welche Chancen räumst du dem Individuum ein, dynamisch und aktiv zu sein? Ist es an sich beschränkt oder wird es beschränkt? Kann es dynamisch und aktiv nur für sich und in sich sein?
Das hängt von den Vorgaben ab, mit dem jedes Individuum ausgestattet ist. Je größer seine Bildung, um so größer in aller Regel auch seine Handlungsfreiheít. Bildung spielt sogar, in Hinsicht auf freie Entscheidungen, eine größere Rolle als Geld. Doch man kann auch hier nicht generell antworten. Dynamische und aktive Haltungen sind ja oft auch eine Frage der persönlichen Mentalität, von Extro- oder Introvertiertheit, ja von rein physischen Konditionen, Belastbarkeit, Erschöpftheit usw. Und schließlich hängt es davon ab, was sich jemand von seinem Leben wünscht. Für wen Sicherheit an erster Stelle steht, wird sich nicht besonders auffällig machen dürfen. Es gibt Menschen, die sich glücklich fühlen, wenn sie schon mit dreißig wissen, wo hoch ihre Rente ab 65 sein wird und was sie dann in ihrem Leben getan haben werden. Und es gibt Menschen, denen diese Vorstellung der komplette Horror ist.
Kann jede Einzelerfahrung gleichsam kollektiv, von gesellschaftlichem Nutzen sein?
Das weiß ich nicht. Ob aber jede Einzelerfahrung zu einer kollektiven notwendig wird, das bezweifle ich.
Ist es zu weit gedacht oder legst Du einen existenziellen Faden, den die Protagonisten aufgreifen, um aus ihrem existenziellen Labyrinth herauszufinden, in das sie möglicherweise persönliches Wollen, möglicherweise gesellschaftliche Vorgaben, um nicht zu sagen Zwänge, hineinführten?
Das scheint mir definitiv der Fall zu sein, daß wir alle durch Zwänge in unsere Situationen hineingerieten, ob uns diese Situationen nun gefallen oder nicht. Aber daß ich einen Faden lege, an dem sie sich wie Theseus an Ariadnes aus dem Labyrinth wieder heraushangeln können, halte ich für eine falsche Lesart. Ich selbst weiß ja oft nicht, wo dieser Faden entlangläuft, bzw. ob es überhaupt einen gibt. Nicht selten bin ich davon sehr überrascht, wie meine Helden handeln; das schreibt sich plötzlich. Es kommt als Idee und steht dann da, und ich bin es dann, der den Faden sucht und finden muß. Es ist nicht ausgeschlossen, daß ich noch nach Erscheinen eines Buches ohne Fund geblieben bin, aber plötzlich meldet sich ein Leser und ruft aus: „Da liegt er doch! Sie müssen nur mal hinsehn!“
Die Protagonisten bemächtigen sich bei dir der Dinge und Ereignisse, die sich ihrer bemächtigen wollen. Kann die Gesellschaft ein Heben des Individuellen per se nicht leisten? Oder ist das nur in der Begegnung mit ihr möglich?
Erst einmal, was soll das sein, „die Gesellschaft“ als Subjekt? Das ist doch kein Ich, sondern eine Summe von Millionen Ichs. Auch summiert werden die kein „einziges“ Ich, auch kein Über-Ich. Sondern sie bleiben Partikel, bzw. sind als Masse nach den allersimpelsten Dynamiken lenkbar, bei denen man aber gewiß nicht von Bewußtsein sprechen kann. Weder Werbung noch Rhetorik sprechen das Bewußtsein an, sondern Zielen auf unbewußte Triebe. Was wir freilich haben, als Entität, deren Teilmenge wir sind, sind Gesellschaftsformen. Und mit denen müssen wir umgehen, und die, allenfalls, können „heben“. Aber sicher nicht speziell das Individuum. Im Gegenteil werden Gesellschaftsformen, bzw. -systeme bemüht sein, den individuellen Rahmen so schmal zu halten, daß er steuerbar bleibt. Da so etwas zur Erstarrung, schließlich Totalität neigt, ist die pubertäre und nachpubertäre Aufsässigkeit „der“ Jugend so lebenswichtig: Sie garantiert Entwicklung auch dort, wo sie selbst fehlgeht; ja das Fehlgehen ist ein Teil ihrer Kraft. Es bringt den notwendigen Irrtum in ein System, das seine Wahrheit immer schon verdinglicht hat und bestimmte Fragen, die es gefährden, mehr oder minder geschickt sanktioniert.
Doch generell ist Entwicklung immer nur in der Begegnung mit der Gesellschaft möglich, schon, weil wir gesellschaftliche Wesen sind. Ausnahmen sind allenfalls der Rückzug in die Wildnis, Eremitentum usw. Doch selbst das bleibt immer auf Gesellschaft notwendig bezogen.
Zur Ich-Konstruktion: Wann gäbe es eine tatsächliche Gefahr einer Depravation für das Ich?
Im Roman oder in der Wirklichkeit? In der Wirklichkeit ist die Gefahr permanent zugegen. Was aber nichts Neues ist. Wie gesagt: Gesellschaftlichkeit. Ob wir in Megastädten oder Dörfern leben, schafft nicht den Unterschied, allenfalls einen der Wahrnehmung und Direktheit.
Gibt es so etwas wie einen hedonistischen Sieg? Ist Phantastik eine Verschwendung, ein Überfluss im hedonistischen Sinne?
Das sollte sie sein. Ob sie das ist, weiß ich nicht. Doch der Überfluß ist reich, hebt die Gestaltungen und Gestaltungsmöglichkeiten und eben, daß etwas möglich sei. Der „hedonistische Sieg“ besteht darin, daß ich, wie oben gesagt, mit Lust widerstehe.
Wo die Realität gebeugt wird, kann sie dort auch gebrochen werden? Du beugst sie ja. Doch die Spannung liegt in der Frage, ob die (dargestellte) Wirklichkeit bricht. Die Spannung liegt weitaus mehr in dieser Frage, weniger darin, ob das Individuum selber bricht – dieses scheint zu wachsen, ja abnorm groß zu werden und die Realität zu überragen - das Individuum wuchert.
Wo wuchert es? Größer wird nur die Anzahl seiner Aspekte, was aber „nur“ daran liegt, daß weniger ungenau geschaut wird. Ich kann auch nicht sehen, daß ich die Realität beuge; allenfalls beuge ich die Übereinkunft, wie man sie darzustellen habe. Auch darin aber tue ich absolut nichts Neues, sondern stehe in einer langen Tradition, die von, und das ist schon mittendrin, Ovid über Ishiguro bis eben, in diesem Moment, zu mir führt – und parallel zu anderen, etwa Christian Kracht, Helmut Krausser, Ricarda Junge, Marcus Braun, Christopher Ecker, Judith Kuckart – um nur ein paar wenige der zeitgenössischen deutschen Autoren zu nennen.
Deine Äußerung, du schreibst, weil du das Ausgeschlossene Dritte bewältigen wolltest. Ist das nicht Kern der Postmoderne?
Nein. Die Postmoderne hat, meiner Sicht nach, vor allem ziemlich pfiffig und auch erfolgreich versucht, verdinglichte Normen aufzulösen, denen gegenüber sie sich wie die Romantik gegenüber der Klassik verhielt. Die Postmoderne hat in der Kunst den Kitsch rehabilitiert, was eben auch der sogenannten E-Literatur – ähnlich wie der Magische Realismus – wieder Leser zugeführt hat. Und sie hat den Pop in die E-Künste gehoben, mit nicht immer, meine ich, Grund. Aber insgesamt war sie eine riesige Befreiung für die Künste. Sie hat die Lust wiederbetont, die sinnliche körperliche wie die am Spiel des Geistes. Sie hat die Kunst davon erlöst, ein Exerzitium zu sein. Mit dem Ausgeschlossenen Dritten aber hat das wenig zu tun. Auf das hatte es vielmehr die Ästhetik davor abgesehen, denken Sie an Adornos Nichtidentisches und Blochs Utopisches-als-Mögliches.
In welchem Verhältnis stehen Identität und Autonomie für dich?
Etwas Identisches muß nicht autonom sein. Mir stellt sich sowieso die Frage, ob es so etwas wie Autonomie überhaupt gibt. Wohl aber kann Identität als das Gefühl von Autonomie auftreten, das Gefühl der Identität auf eben diesem gründen. Doch auch hier gilt: Um sich autonom oder nicht-autonom zu fühlen, muß es tatsächliche Autonomie gar nicht geben. Ihre Illusion reicht, um enorme Wirkungen auszulösen, die ohne diese Illusion gar nie entzündet würden.
Das gegenseitige Durchdringen von Welt, Gegenwelt und Ich exemplifiziert sich ebenso über individuelle wie über kollektive Erfahrungen – doch ist es nicht oder kaum vermittelbar, höchstens beobachtbar. Welchen Ausschlag hat für dich im Kommunikations- und Informationszeitalter das Scheitern von Kommunikation? Scheitert die Kommunikation an der Information?
Nein. Sie sprechen viel zu generell. Es gibt Mentalitäten, für die das der Fall sein mag; aber eben auch das ist eine Frage der jeweils persönlichen Konstitution. Das Informationszeitalter ermöglich ja auf der anderen Seite überhaupt erst Kommunikationen. Ich muß dazu nicht nur mich selbst ansehen, sondern beobachte vor allem meinen dreizehnjährigen Sohn: Die Freunde, die er heute fast europaweit hat, wären ihm ohne die Neuen Medien vorenthalten geblieben. Der Kommunikations-Pool wird größer und größer, als auch die Möglichkeiten, die sich realisieren.
Es mag nun sein, daß die enorme Auswahlmenge dessen, was wir erfahren, uns auf der einen Seite zu ersticken droht; aber ich halte das letztlich für eine Form von technologiefeindlicher, sagen wir -ängstlicher Hypochondrie. Sondern wie seit je wählen wir aus – je nach unseren Kriterien – und fischen aus dem Pool, was wir zu brauchen glauben und weitergeben möchten. Je jünger wir sind, desto einfacher, im allgemeinen, fällt uns das. Aber auch dies ist nichts Neues. Als die ersten Eisenbahnen fuhren, sind nicht wenige Erwachsene in Ohnmacht gefallen, weil ihnen 25 km/h zu rasend schnell war: Ihre Physis und die psychischen Verarbeitungsmodi hatten nicht Jugend genug gehabt, um sich auf die neuen Geschwindigkeiten einzustellen. Das ist heute ganz genauso. Wenn ich vier Tage brauche, um mein neues Handy zu verstehen, erledigt mein Junge das in anderthalb Stunden. Welt bleibt nicht stehen, sondern entwickelt sich weiter. Auch über uns hinweg. Mir gefällt das, weil es zeigt, daß das Leben immer weiterlebt.
Denkst du, wir leben in einer Umwelt, in der falsche Inhalte, nämlich rein faktische und nicht substanzielle transportiert werden? Und wenn ja, welche Konsequenzen zeitigt das, wie ist der Rückgriff auf substanzielle Erfahrungen möglich?
Was ist das denn, eine substantielle Erfahrung? Wer bestimmt, was eine sei? Darum geht es bei Ihrer Frage letzlich: um Ideologie. Und ich sage: Es wurden schon immer „falsche“ Inhalte transportiert, und immer schon wußte man nicht zu sagen, was denn die falschen seien. Es gab immer nur Meinungen, Glauben, Überzeugungen. Ich für meinen Teil glaube, und so lebe ich – und also schreibe ich so -, daß substantielle Erfahrungen dann möglich sind, wenn ich mich den Risiken aussetze und nicht versuche, mich permanent abzusichern. Das mit sozialer Verläßlichkeit zu verbinden, gegenüber den eigenen und anderen Kindern, den Geliebten und Freunden, gehört zu solchen Risiken dazu. Und auch darüber schreibe ich.
Argo. Anderswelt
Alban Nikolai Herbst
Elfenbein Verlag, Berlin 2013
1.000 Seiten
39,- €