Wir freuen uns sehr, dass Frank Berzbach Arbeit und Struktur von Wolfgang Herrndorf rezensiert hat und fühlen uns wirklich geehrt, Ihnen hier exklusiv seine Gedanken zu diesem Buch präsentieren zu dürfen.
ARBEIT UND STRUKTUR
Von Frank Berzbach
"Parallel zur Lektüre mancher Bücher möchte ich gern einen Blog schreiben. Für die knapp 450 Seiten von Wolfgang Herrndorfs zuerst digitalem und jetzt in Buchform erschienenem Tagebuch habe ich etwa zwei Wochen gebraucht. Und zwei Wochen hätte ich jeden Tag darüber schreiben können. Herrndorfs Aufzeichnungen beginnen mit der Diagnose eines Gehirntumors im März 2010 und enden mit seinem Freitod im August 2013. Ich gebe zu, dass mich am Lesen die Identifikation packt, ich kaufe selten Bücher, um mich abstrakten Textsystemen zu widmen und ich glaube auch, etwas altmodisch, dass Autoren und Menschen existieren. Herrndorf dokumentiert seinen Sterbensprozess, das ist mehr als ein Verweissystem. Es ist die Erkundung einer Grenzsituation. Gerade das Tagebuch ist eine Gattung, die einen unmittelbaren Einblick in die alltäglichen Kämpfe der Verfasser gibt; wir können durch es in andere Zeiten eintauchen (Samuel Pepys), wir können es am Bett stehen haben (Franz Kafka oder Thomas Mann), Sylvia Plaths „Glasglocke“ berühren, mit Klemperer die Nazi-Zeit verstehen oder eben in den Krebstod folgen, wie bei Christoph Schlingensief oder jetzt Wolfang Herrndorf. Es ist durch die Drastik der Lebenssituation jedenfalls eins der Bücher, die man lesen wollen muss und der Urlaub ist vielleicht nicht gerade die beste Zeit dafür.
Ich beiße mich sofort an Passagen fest, an denen ich mir sicher bin: ich lese nicht weiter! Ein ähnliches Gefühl habe ich manchmal im Kino, wenn ich mich Lars von Trier oder Michael Haneke ausliefere. Herrndorf schreibt, nachdem er „Melancholia“ gesehen hat: „... zehn von zehn Punkten. Und noch einen Zusatzpunkt fürs Happy End: groß und grün uns strahlend. So ist das, genau so. Noch nie so erlebte Übereinstimmung zwischen filmischer und subjektiver Realität. Urteil deswegen möglicherweise getrübt.“ „Melancholia“ ist der wohl beste Film über Depressionen überhaupt, aber im Text von Herrndorf spielt die Psychologie überhaupt gar keine Rolle, sie ist auffällig abwesend und diese Lücke schafft Freiräume für die eignen Projektionen. Lesen ist ein aktiver Vorgang. „Mit das Unangenehmste an der Krankheit: dass man sich nicht krank fühlt. Wenn ich schlapp bin oder leichte Kopfschmerzen habe, ist es besser.“ Das Wissen spielt in der existenziellen Situation eine große Rolle, er googelt Studie auf Studie, aber seine Lebenserwartung bleibt gering, er schreibt an gegen seine verstreichende Lebenszeit. Wir verfolgen das Entstehen und Lektorieren von „Tschick“, das ihn am Ende seines Lebens reich machen wird. Und kaum ist das Geld da, hat es keine Bedeutung mehr; was will man mit Geld, wenn es keine Zukunft mehr gibt? Die Diagnose wirft aus der Bahn, einer der vielen Ärzte, sie sind durchnummeriert, empfiehlt ihm „Arbeit und Struktur“. Beides trägt ihn, beides macht ihn produktiv. Statt ewig an einzelnen Sätzen zu schrauben entstehen nun zwei Romane. Herrndorf arbeitet wie verrückt. Zugleich dokumentiert er einen atheistischen, hoffnungslosen, extrem realitätsbezogenen Blick auf die Welt und sein Leben: er liest nur noch, was ihm gefällt, liebt das Kino, geht Schwimmen und Fußballspielen, wenn er nicht im Kernspintomographen liegt. Ein Leben zwischen der Lärmbelästigung des unerbittlichen Nachbarn, dem Essen in der naheliegenden Mensa, der Zeit mit den engsten Freunden, seiner qualvollen Odyssee von Hirn-OPs, Chemotherapien, Bestrahlungen und Strahlungsschäden, zugelassenen und nicht zugelassenen Medikamenten, die Nebenwirkungen haben, die schlimmer als jede Krankheit zu sein scheinen. Er wird von einem Auto angefahren und strazt auf den Teer, wieder Krankenhaus, aber zur Abwechslung einmal nicht die Neurologie. Die Fahrerin des Wagens zeigt ihn an. Es gibt keinen Ton der Klage in diesem Buch – es ist bis zum Ende kaum zu fassen. Klage doch endlich einmal, du hast doch allen Grund! Nein, tut er nicht.
Aber auch ohne Hoffnung lässt er sich das Heft nicht aus der Hand nehmen. „Ich habe mich damit abgefunden, dass ich mich erschieße. Ich könnte mich nicht damit abfinden, vom Tumor zerlegt zu werden, aber ich kann mich damit abfinden, mich zu erschießen. Das ist der ganze Trick.“. Er installiert parallel zu dieser Entscheidung eine Pistole in seinem Kopf: „Diesmal reicht eine einfache Willensentscheidung nicht aus, und ich muss eine sehr plastisch vorgestellte Walter-PKK in meinem Kopf installieren, um jeden unangenehm aufkommenden Gedanken zu erschießen: Peng, peng. Zwei Kugeln, und ich denke an etwas anderes. (...) Mit immer größerer Zuverlässigkeit ballert es den Todesgedanken spurlos weg.“ Man ist froh um diesen Trick, um allerdings später zu erfahren, dass die Methode es schafft „eine halbe Stunde oder länger“ nicht an den Tod zu denken. Schwer machen es ihm vor allem die, die es gut meinen, aber die ihn vor allem als Todkranken sehen. Er ist die ganzen drei Sterbensjahre damit beschäftigt, unerwünschte Heiler, mitfühlende alte Freunde, sentimentale Briefschreiber zu vertreiben, aber sie lassen ihn nicht in Ruhe. Der edle Wunsch zu helfen enthält etwas herablassendes, wenn keine Hilfe mehr hilft. Eine alte „Freundin“ findet seine neue Adresse heraus, klingelt gegen seinen Wunsch unangemeldet, ignoriert alle seine Bitten zu endlich zu gehen und sitzt schließlich wartend unten im Auto und schreibt SMS – ich bekomme Mordlust auf nicht wenigen Seiten des Buches, warum kann man ihn nicht einfach in Ruhe lassen? Weil es die Ohnmacht noch verstärkt. Aber um wen geht es, um ihn oder um einen selbst? Das Personal, dass Herrndorf umgibt – vor allem die Besatzung der Zentralen Intelligenz Agentur – sind im alltäglichen Umgang alles andere als zimperlich. Kathrin Passig, die viele seiner Text lektoriert, findet immer wieder „alles Scheiße“ und die Unerbittlichkeit, ihre krassen Witze auch mit dem Tod, gehen Herrndorf durchaus nah. Aber sie erzeugen kein Leiden, das sich in der Krankheit oder Mitleid begründet. Warum sollte ein Text eines Todkranken besser sein als der eines anderen Menschen?
Plötzlich komme ich selbst auf die Idee in mein Tagebuch zu schauen, unter dem Datum, das ich gerade bei Herrndorf gelesen habe. Ich klage eine ganze Seite über mein fürchterliches Leben, eigentlich über alles – und mir wird schlecht angesichts der Tatsache, welchen eingebildeten Leiden ich mich widmen kann, während am gleichen Tag Wolfgang Herrndorf in Berlin vor Freude „auf die Donuts heult“, weil er nach der gerade neueste Diagnose seine Lebenszeit nicht ganz so schnell abzulaufen scheint, was bedeutet, vielleicht doch noch vier Monate? Herrndorf stand, während ich klage, jeden Tag früher auf, kurz nach vier, um vom Balkon seiner neuen Wohnung das Morgenrot zu sehen. Es könnte nämlich der letzte Morgen für ihn sein.
Herrndorf war kein Bildungsbürgerkind, das zwischen dem Flügel im Salon und verglastem Bücherschrank mit den (ungelesenen) Klassikergesamtausgaben aufwuchs. Er hat sich die Welt selbst erlesen. Eine Freude, ihm zu folgen: Nabokov, Stendhal, Thomas Mann, Dostojewski gehören zu seinen Leitsternen, aber auch hier immer wieder Reiberei und sporadisches Entsetzen. Ein ganzer Schwung an Autoren wird kommentiert, persönlich und radikal, das Leiden an Martin Walsers Interviews, der Blick auf Uwe Tellkamp (im Hinblick auf Thomas Mann), Jeffrey Eugenides; sein Alptraum mit Juli Zeh verglichen zu werden, sein Bekenntnis zum „Fänger im Roggen“ oder früher Hesse-Lektüre, sein Unverständnis gegenwärtiger Literaturkritik oder der „verrückt gewordene“ Martin Mosebach. Herrndorfs Aufzeichnungen laufen auf die Entscheidung zu, dass er keine Bücher mehr geschenkt haben oder kaufen will. „Ich lerne nichts Neues mehr. Weil ich nicht will. Es ist, wie mir Bücher zu schenken: Erinnert mich an den Tod. Neues braucht man für später, Bücher liest man in der Zukunft. Das Wort hat für mich keine Bedeutung. Ich kann den heutigen Abend in Gedanken berühren, dahinter ist nichts. (...) Die Zukunft ist abgeschafft, ich plane nichts, ich hoffe nichts, ich freue mich auf nichts außer den heutigen Tag. Den größten Teil der Zeit habe ich das Gefühl tot zu sein.“ Aber eigentlich ist es noch schlimmer: er kämpft gegen Störungen der Wahrnehmung, gegen Sprachstörung und Sprachverlust, verliert über epileptischen und Panik-Anfällen die Orientierung, findet seinen Weg nicht. Er versucht seine Hausschuhe selbst anzuziehen und schafft es erst nicht. Er kann den linken vom rechten Schuh nicht mehr unterscheiden und überlegt, ein L und ein R darauf zu schreiben.
Herrndorf lebt weiter, so gut er kann. Er wird weder gläubig, noch abergläubisch, er hat keine Religion und nicht einmal eine Ersatzreligion. Das macht das Buch einzigartig, er sah vorher keinen Sinn und das ändert sich mit der Diagnose nicht. Atheismus entscheidet sich auf den letzten Metern, schreibt er, aber er bleibt wie er ist. Psychologie, Ideologie und Religion sind ihm fremd – gleich ohne alle drei schafft das leider kaum ein gesunder Mensch. Die Zeit verkürzt sich, der Kampf um Selbstverständliches nimmt zu, die Angst nimmt zu, er beobachtet und dokumentiert diesen Vorgang. Wir blicken auf körperlichen und geistigen Verfall, bei laufender Textproduktion. „Linke Hand findet ihren Platz auf der Tastatur nicht. Pappschablone auf den Rechner geklebt, um dem Handballen Halt zu geben, vergeblich. Dann Hand am Tisch festgeklebt, ohne das es hilft. Linker Fuß rutscht vom Fahrradpedal. Ausflug an Tegeler See. C. verbietet Rausschwimmen. Gewitter.“ Wie macht man weiter? „Ich schlafe mit der Waffe in der Faust, ein sicherer Halt, als habe jemand einen Griff an die Realität geschraubt. Das Gewicht, das feine Holz, das brünierte Metall. Mit dem MacBook zusammen der schönste Gegenstand, den ich in meinem Leben besessen habe.“
Herrndorf befällt oft die Angst, dass eine Verschlechterung seines Zustandes ihn unfähig macht, sich selbst zu töten. Diese Angst ist viel größer als die vor dem Tod selbst, die sich im Laufe der Zeit für ihn immer mehr verliert. Und egal wie fruchtbar die Einträge werden, wie lakonisch oder direkt, das Gefühl, dass er sich tatsächlich durch kein Leiden das Heft aus der Hand hat nehmen lassen, springt auf den Leser über wie die unweigerlichen Ab- und Aufwärtsvergleiche mit dem Autor, der Lektüre und Bewertung alltäglicher Dinge. Das ist ein Grund dieses Buch zu lesen: die Oberhand behalten, egal unter welchen Umständen. Nicht verrückt werden, nicht flüchten. Das Buch hat mich gequält und mehr berührt als viele vorher. Vielleicht wüsste ich gar keins, das mich diesen Gefühlen ausgesetzt hat. Es ist eine existenzielle Bereicherung. „Bilanz eines Jahres: Hirn-OP, zweimal Klapse, Strahlen, Temodal, 1,75 Romane, erster großer Urlaub, viele Freunde, viel geschwommen, kaum gelesen. Ein Jahr in der Hölle, aber auch ein tolles Jahr. Im Schnitt kaum glücklicher oder unglücklicher als vor der Diagnose, nur die Ausschläge noch beiden Seiten größer. Insgesamt vielleicht sogar in bisschen glücklicher als früher, weil ich so lebe, wie ich immer hätte leben sollen. Und es nie getan habe, außer vielleicht als Kind.“ Das Buch von Herrndorf enthält solche Sätze, eine Attacke auf den alltäglichen Befindlichkeitsschrott, der uns und anderen den Tag verdirbt. Das Buch ist eine Aufforderung klarsichtig und selbstbestimmt zu Leben, ohne anderen auf die Nerven zu gehen."
Dr. Frank Berzbach, geb. 1971, ist Hochschuldozent in Köln und Buchautor. Nach "Kreativität aushalten" verdanken wir ihm auch eines unserer absoluten Lieblingsbücher 2013: "Die Kunst ein kreatives Leben zu führen", beide erschienen im Verlag Hermann Schmidt Mainz.
Wer noch mehr von ihm lesen will: dosierte kurzzeitliebe

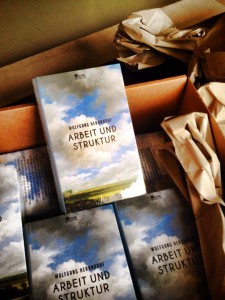


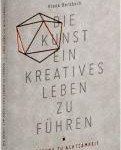
Gelesen: "Arbeit und Struktur" von Wolfgang Herrndorf : Mama notes
2. Februar 2014
[…] Ocelot: Frank Berzbach über Wolfgang Herrmanns Arbeit und Struktur […]