Günter Kunert: Der ungebetene Gast
GAGARIN
Als er durch des Himmels Bläue aufgefahren,
Schien es, er bewege sich nicht länger fort,
Und er hänge fest in dieser schwarzen Weite,
Und die Erde drehe sich vor seinem Fenster dort.
Eine unfaßbare Kugel nannte er nun Heimat,
Und wie nie vorher kam sie ihm plötzlich nah,
Da er, fern von ihr in den Unendlichkeiten,
Stumm und reglos auf sie niedersah.
Und er liebe sie, die sich ihm zeigte,
Weil sie doch der Menschen Mutter war,
Immer noch die Söhne nährend und behausend,
Aber auch durch sie in tödlicher Gefahr.
Während seiner Rückkehr zum Planeten
Ward ihm klar: Die Erde ist nur eins.
Die darauf sind, müssen miteinander leben,
Oder von ihr wird es heißen: Leben keins.
Auf der Schwelle des Hauses
Für die literarische Situation in der DDR ist es nicht ungewöhnlich, daß die Bücher gewisser Autoren mit oft erheblichen, durch eine engstirnige Zensur bedingten Verzögerungen auf den Markt kommen. Zu diesen „verzögerten“ Büchern gehört der neue Gedichtband des in Berlin-Treptow lebenden Günter Kunert: Der ungebetene Gast; Aufbau Verlag, Berlin/Weimar; 96 S., 7,50 DM, der dann innerhalb einer Woche vergriffen war. Kunert, erst kürzlich mit Manfred Bieler und Wolf Biermann in das PEN-Zentrum Ost aufgenommen, war längere Zeit hindurch den Angriffen der SED-Funktionäre ausgesetzt. Der ungebetene Gast ist seine erste größere Publikation seit 1961 in der DDR. Der Aufbau Verlag bereitet für dieses Jahr eine Sammlung von zweiundfünfzig Liebesgedichten Kunerts vor.
Günter Kunert, 1929 in Berlin geboren, ist auch bei uns kein Unbekannter mehr. 1963 erschien im Hanser Verlag München eine Auswahl aus den vier bis 1961 in Ostberlin publizierten Gedichtbänden (Erinnerung an einen Planeten), 1964 folgte dann im gleichen Verlag eine erste Prosasammlung: Tagträume, die Kunert als bedeutsamen und eigenwilligen Erzähler auswies. Zur Zeit arbeitet er an einem Roman Im Namen der Hüte, der die Nachkriegsjahre in Berlin, insbesondere das Groteske und Derivierte der damaligen Situation, ins Auge faßt.
Sein neuer Gedichtband, der neunundsechzig Gedichte vereinigt, liefert nachdrücklich den Beweis, daß Kunert zu den begabtesten Poeten deutscher Gegenwart gezählt werden muß.
War in seinen lyrischen Anfängen das Vorbild Brechts zuweilen noch recht unvermittelt zu spüren, so läßt sich an Hand der nun vorliegenden Arbeiten feststellen, daß Kunert zu der ihm eigenen, unverwechselbaren Sprache gefunden hat. Sie ist härter und genauer geworden. Er vermeidet das allzulange Ausholen und Unterwegssein auf eine pointierende und moralisierende Schlußsequenz hin. Aussage tritt neben Aussage, Optik neben Optik, gleichgewichtig, mit nichts anderem belastet als dem, was sie selbst ist. Kein Wort mehr, keines weniger. Nüchtern wirkt das, blockhaft. Und gerade diese Blockhaftigkeit, diese fast mathematisch anmutende Genauigkeit erzeugt feine untergründige Spannung innerhalb des ganzen Gebildes, das da Gedicht heißt. So etwa in „Ich bringe eine Botschaft“:
Auf einem Vulkan läßt sich leben, besagt
Eine Inschrift im zerstörten Pompeji.
Und die Bürger der vom Meere geschluckten
Ortschaft Vineta
Bauten für ihr Geld Kirchen, deren Glocken
Noch heute mancher zu hören vermeint…
Kunerts Sprache ist von leidenschaftlicher Strenge, präziser Sachlichkeit und kühler Sensibilität, nicht ohne Melancholie und ausgerüstet mit durchaus kräftigen Antennen für Ironie und Selbstironie:
Innerhalb meines abendlichen Gehirns
Schlürft ein Schatten umher
Auf abgelaufenen Füßen,
Eine kleine undeutliche Laterne in
Der Hand und immer im Kreise.
Erkennte ich ihn, wüßte ich eher
Wer ich bin und wer nicht.
Kunert stellt mit seltener Eindringlichkeit die Frage nach dem Verbleib des Menschen. Hier ist ein Dichter unterwegs, unermüdlich jene menschlichen Bewußtseinslagen anpeilend, die der Hoffnung auf Überleben, auf positive Veränderung des Hier und Heute begründeten Anlaß zu geben vermögen. „Auf der Schwelle des Hauses“ sitzend, besorgt, jene „Lichtflecken“ aufzufinden, die es gestatten, „zwischen zwei Herzschlägen (zu) glauben: Jetzt ist Frieden“. Seine Gedichte sind Negative, „schwarze Lehrgedichte“, die dazu zwingen, eine Gegenlehre zu ziehen, ohne daß Kunert der Verdeutlichung halber noch den moralischen Zeigefinger erheben müßte:
Betrübt höre ich einen Namen aufrufen:
Nicht den meinigen.
Aufatmend
Höre ich einen Namen aufrufen:
Nicht den meinigen.
Um den Menschen und um seine Möglichkeiten, innerhalb anonymer Massengesellschaftssysteme und „einer Welt, die ihre Ideale an die Wände nagelt“, einer Welt, die noch gekennzeichnet ist durch die Spuren großer Menschenverfolgungen, wo zu lernen war „das Abc des Verreckens und Übrigbleibens“ einen Rest von Menschlichkeit zu bewahren, geht es Kunert in allen hier versammelten Gedichten:
WAS IST DENN IN DIR
Und was soll geliebt sein?
Was deine Brüste vortreibt,
Die Hüften kurvt, was
Wölbung und Bauchung und Regung
Und zuckt und da ist?
Was rosenrot, schneeweiß, was schwarz?
Armkraft, Lachmuskel, Salzträne?
Was denn, wenn nicht
Das aller Natur Allerfernste, gestempelt
Mit dem verachteten, veralteten, verlogenen
Abwaschbaren Wort Mensch.
Gregor Laschen, Die Zeit, 13.5.1966
Brecht-Schüler
Günter Kunert begann, wie so viele unserer jungen Lyriker, mit Gedichten, die deutlich den Einfluß Bertolt Brechts verrieten. Als formalen Einfluß aber scheint dem eigenwilligen und so ganz persönlich geprägten Lyrikstil Brechts die Tendenz innezuwohnen, daß er Epigonen erzeugt; er ist seinem Wesen nach einmalig und unwiederholbar. So sind viele der lyrischen Brecht-Nachfahren denn auch im Epigonalen steckengeblieben. Auch Kunert war dieser Gefahr zuweilen erlegen, hier aber, in dem neuen Gedichtband Der ungebetene Gast, ist er zur Befreiung von der bloßen Nachahmung Brechts gelangt, zu schöpferischer Weiterverarbeitung der großen Anregung.
Zwar sind auch hier noch einige Gedichte deutlich-allzudeutlich brechtianisch, aber andere sind auf dem Umweg über sprachliche Sprödigkeit zu eigenständigem Ausdruck gelangt. Ihr komplizierter Duktus will ebenso komplizierte philosophische Ueberlegungen, zuweilen auch nicht recht zu Ende geführte, in einprägsame Formeln zwingen. Tief durchdacht wird die Faszination des Weltraumflugs, Hoffnung kämpft mit Pessimismus, eine grüblerische Haltung findet zu einem unbeirrbaren Glauben an Humanität und Menschheitszukunft. Kunert ist ein problematischer Dichter, das heißt hier: ein mit Problemen beschäftigter.
H. U., Neue Zeit, 28.4.1966
Weitere Beiträge zu diesem Buch:
Sabine Brandt: Der ungebetene Dichter
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 9.11.1965
Armin Zeißler: Lyrik der Veränderung
Neue Deutsche Literatur, Heft 1, 1968
Hans-Peter Anderle: Der ungebetene Gast
Publik, 14.3.1969
Zum 80. Geburtstag des Autors:
Cornelia Geissler: Die Welt ertragen
Berliner Zeitung, 6.3.2009
Fred Viebahn: Ein unbequemer Dichter wird heute 80
ExilPEN, 6.3.2009
Reinhard Klimmt: Günter Kunert
ExilPEN, 6.4.2009
Hannes Hansen: Ein heiterer Melancholiker
Kieler Nachrichten, 5.3.2009
Renatus Deckert: „Ich bin immer noch naiv. Gott sei Dank!“
Der Tagesspiegel, 6.3.2009
Hubert Witt: Schreiben als Paradoxie
Ostragehege, Heft 53, 2009
Zum 85. Geburtstag des Autors:
Peter Mohr: Die Worte verführten mich
lokalkompass.de, 3.3.2014
Schreiben als Selbstvergewisserung – Dichter Günter Kunert wird 85
Tiroler Tageszeitung, 4.3.2014
Wolf Scheller: Die Poesie des Melancholikers
Jüdische Allgemeine, 6.3.2014
Zum 90. Geburtstag des Autors:
Reinhard Tschapke: Der fröhlichste deutsche Pessimist
Nordwest Zeitung, 2.3.2019
Günter Kunert im Interview: „Die Ideale sind schlafen gegangen“
Thüringer Allgemeine, 4.3.2019
Günter Kunert im Interview: „Die Westler waren doch alle nur naiv“
Göttinger Tageblatt, 5.3.2019
Katrin Hillgruber: Ironie in der Zone
Der Tagesspiegel, 5.3.2019
Benedikt Stubendorff: Günter Kunert – 90 Jahre und kein bisschen leise
NDR.de, 6.3.2019
Matthias Hoenig: „So schlecht ist das gar nicht“
Die Welt, 6.3.2019
Tilman Krause: „Ich bin ein entheimateter Mensch“
Die Welt, 6.3.2019
Günter Kunert – Schreiben als Gymnastik
mdr.de, 6.3.2019
Peter Mohr: Heimat in der Kunst
titel-kulturmagazin.net, 6.3.2019
Knud Cordsen: Der „kreuzfidele Pessimist“ Günter Kunert wird 90
br.de, 6.3.2019
Studio LCB mit Günter Kunert am 1.4.1993
Lesung: Günter Kunert
Moderation: Hajo Steinert
Gesprächspartner: Ulrich Horstmann, Walther Petri
Beim 1. Internationalen Literaturfestival in Berlin, am Samstag, den 16. Juni 2001, lesen im Festsaal der Sophiensäle in Berlin-Mitte die Lyriker Rita Dove (USA), Günter Kunert (Deutschland) und Inger Christensen (Dänemark), gefolgt von einer Podiumsdiskussion und Fragen aus dem Publikum (moderiert von Iso Camartin).
Fakten und Vermutungen zum Autor + DAS&D + Archiv +
KLG + IMDb
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum +
Autorenarchiv Susanne Schleyer + Galerie Foto Gezett
shi 詩 yan 言 kou 口
Nachrufe auf Günter Kunert: NDR 1 + 2 ✝ FAZ ✝ Welt ✝ AA ✝ Zeit ✝ FR ✝
NZZ ✝ Tagesspiegel ✝ SZ 1 + 2 ✝ MDR ✝ nd 1 + 2 ✝
Günter Kunert bei www.erlesen.tv.


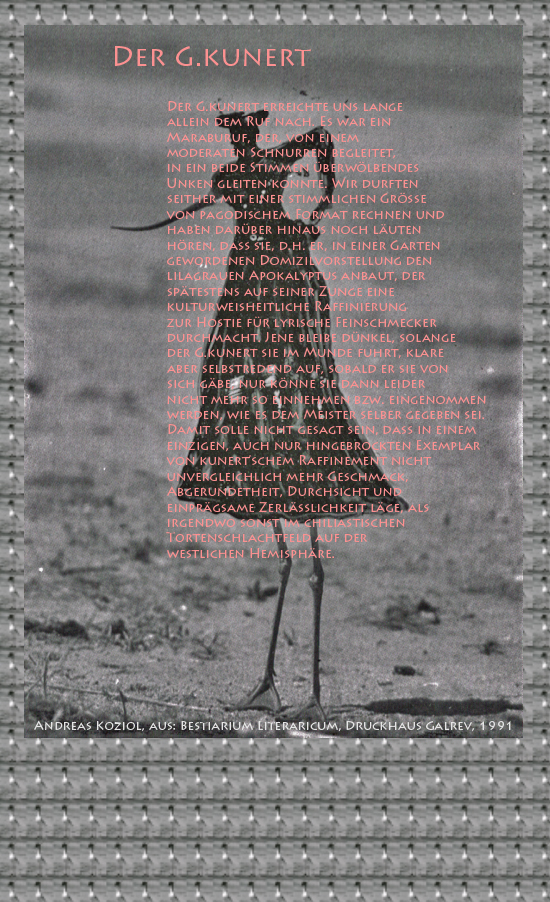
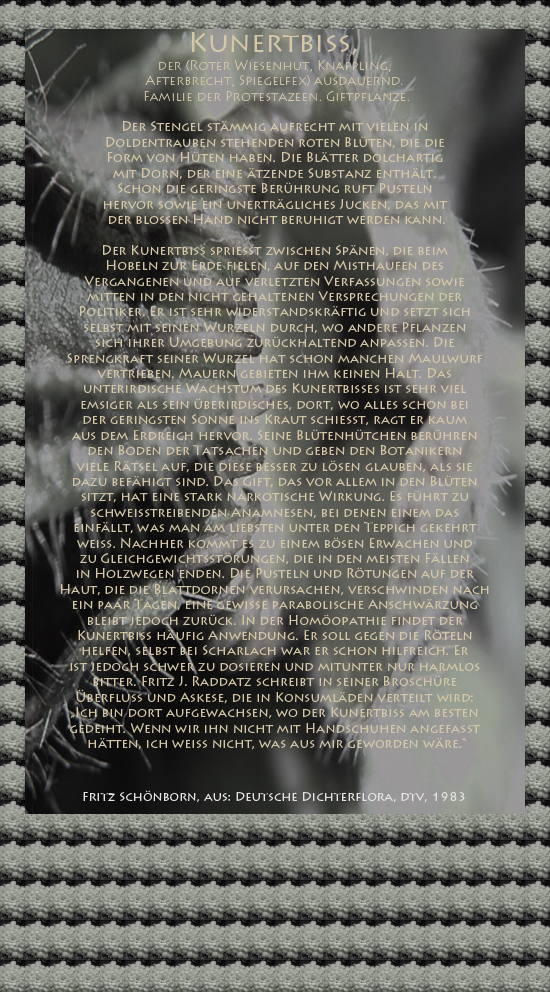
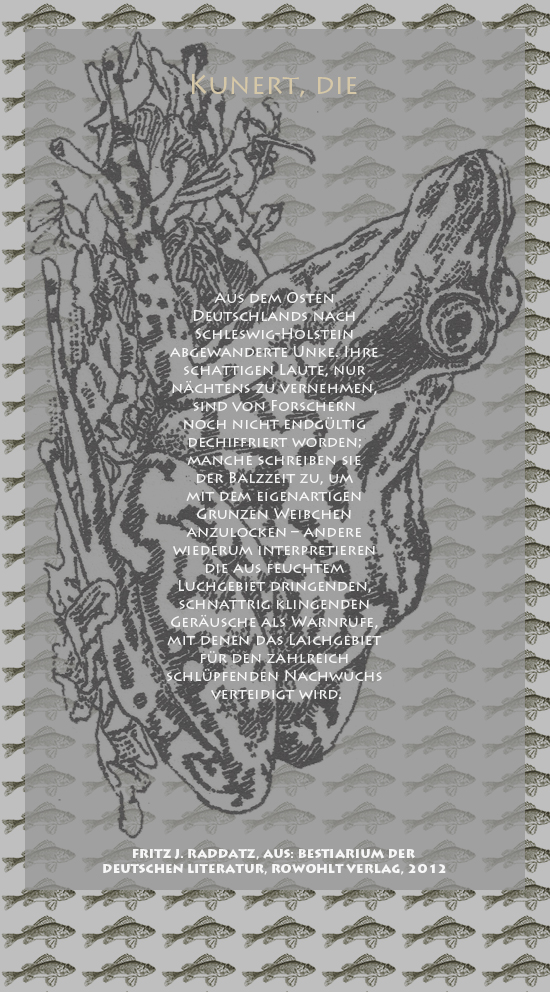
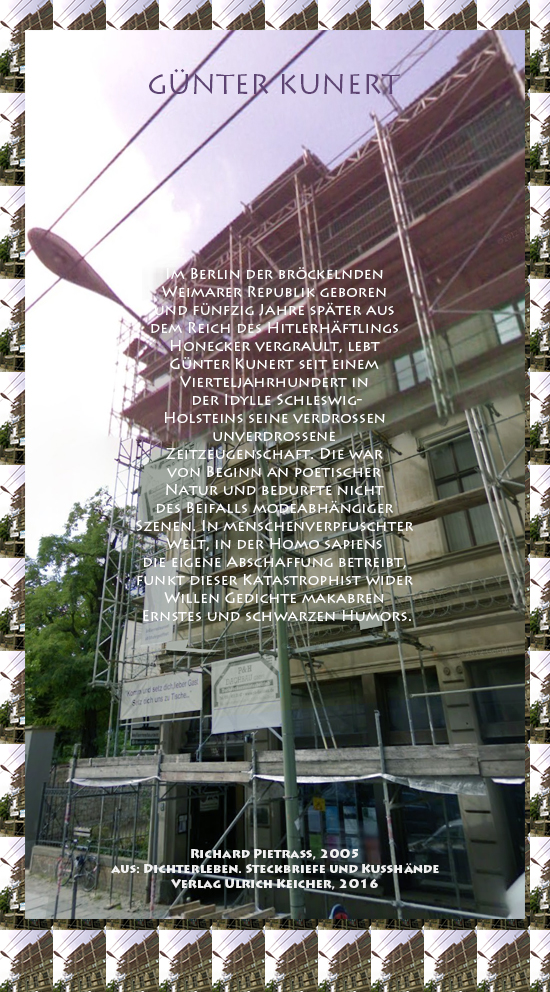








Schreibe einen Kommentar