H.C. Artmann: Das poetische Werk – Der Meister der Himmelsrichtungen
ACHT-PUNKTE-PROKLAMATION DES POETISCHEN ACTES
Es gibt einen satz, der unangreifbar ist, nämlich der, daß man dichter sein kann, ohne auch irgendjemals ein Wort geschrieben oder gesprochen zu haben.
Vorbedingung ist aber der mehr oder minder gefühlte wunsch, poetisch handeln zu wollen. Die alogische geste selbst kann, derart ausgeführt, zu einem act von ausgezeichneter schönheit, ja zum gedicht erhoben werden. Schönheit allerdings ist ein begriff, welcher sich hier in einem sehr geweiteten spielraum bewegen darf.
1.
Der poetische act ist jene dichtung, die jede wiedergabe aus zweiter hand ablehnt, das heißt, jede vermittlung durch sprache, musik oder schrift.
2.
Der poetische act ist dichtung um der reinen dichtung willen. Er ist reine dichtung und frei von aller ambition nach anerkennung, lob oder kritik.
3.
Ein poetischer act wird vielleicht nur durch zufall der öffentlichkeit überliefert werden. Das jedoch ist in hundert fällen ein einziges mal. Er darf aus rücksicht auf seine schönheit und lauterkeit erst gar nicht in der absicht geschehen, publik zu werden, denn er ist ein act des herzens und der heidnischen bescheidenheit.
4.
Der poetische act wird starkbewußt extemporiert und ist alles andere als eine bloße poetische situation, die keineswegs des dichters bedürfte. In eine solche könnte jeder trottel geraten, ohne es aber jemals gewahr zu werden.
5.
Der poetische act ist die pose in ihrer edelsten form, frei von jeder eitelkeit und voll heiterer demut.
6.
Zu den verehrungswürdigsten meistern des poetischen actes zählen wir in erster linie den satanisch-elegischen C.D. Nero und vor allem unseren herrn, den philosophisch-menschlichen Don Quijote.
7.
Der poetische act ist materiell vollkommen wertlos und birgt deshalb von vornherein nie den bazillus der prostitution. Seine lautere vollbringung ist schlechthin edel.
8.
Der vollzogene poetische act, in unserer erinnerung aufgezeichnet, ist einer der wenigen reichtümer, die wir tatsächlich unentreißbar mit uns tragen können.
Editorische Notiz der Verleger
Die Idee zu einer mehrbändigen, aufgegliederten Ausgabe des damals schon auffällig vielschichtigen poetischen Œuvres von H.C. Artmann in der „Kleinen Reihe“ des Rainer Verlages – naheliegend erschien es damals – entstand 1967. Sie wurde – wie die meisten „Ideen“ von Verlegern – aufgrund dieser und jener Entwicklung (des Autors, seiner ständigen Wohnwechsel, des kleinen Verlages und seiner Probleme) ad acta gelegt, eigentlich aber nie aus dem Gedächtnis entlassen.
1969 erschien die von Gerald Bisinger mit Liebe und Fleiß betreute Sammlung Ein lilienweißer Brief aus Lincolnshire im Suhrkamp Verlag. 1978 auch in Taschenbuchform, die bis dahin vollständigste Zusammenstellung der Gedichte, welche bis heute Gültigkeit und Wirksamkeit erlangt hat.
Viele Jahre später, im Herbst 1991 also – was im Durcheinander der Frankfurter Buchmesse nicht möglich – nämlich bei einem Besuch der Renners bei Rainers im ungarischen Fünfkirchen, gerät diese „Idee“ wieder ins Blickfeld: ein mehrbändiges Werk, verteilt auf zwei Schultern.
Salzburg, Wohnort des H.C., liegt zwischen Fünfkirchen und München, zwischen Rainer und Renner. H.C. gibt also wenige Tage später sein Placet, bekundet Wohlwollen, avisiert gar seine Mitwirkung. Auch Klaus Reichert in Frankfurt am Main – nobilder und aufrechter Herausgeber vieler Werke H.C.s – wird sofort gewonnen.
1992 – Klaus Reichert hat seine nicht mühelose Arbeit angefangen, fortgeführt und mit H.C. abgestimmt – die, von den Verlegern übernommen, die Bandzahl der Gesamtausgabe auf zehn Stück (ursprünglich acht) ausgeweitet bzw. begrenzt. Die redaktionelle Arbeit des Herausgebers und des Autors ist vorläufig abgeschlossen.
Im Sommer 1993 beginnen Pretzell und Renner unter Nutzung der typographischen Vielfalt einer 1992 erworbenen leistungsfähigen Photosatz-Maschine die Ausführung der ersten Bände.
Frühjahr 1994 – Beendigung der Satzarbeiten. Die Drucklegung kann beginnen…
Klaus G. Renner und Rainer Pretzell, Nachwort
Beiträge zur Gesamtausgabe: Das poetische Werk
Fitzgerald Kusz: Kuppler und Zuhälter der Worte
Die Weltwoche, 18.8.1994
Andreas Breitenstein: Die Vergrößerung des Sternenhimmels
Neue Zürcher Zeitung, 14.10.1994
Thomas Rothschild: Die Schönheit liegt in der Abwesenheit von Nützlichkeit
Badische Zeitung, 15.10.1994
Franz Schuh: Weltmeister jedweder Magie
Die Zeit, 2.12.1994
Albrecht Kloepfer: Hänschen soll Goethe werden
Der Tagesspiegel, 25./26.12.1994
Karl Riha: Wer dichten kann, ist dichtersmann
Frankfurter Rundschau, 6.1.1995
Christina Weiss: worte treiben unzucht miteinander
Die Woche, 3.2.1995
Dorothea Baumer: Großer Verwandler
Süddeutsche Zeitung, 27./28.5.1995
Armin M.M. Huttenlocher: Narr am Hofe des Geistes
Der Freitag, 25.8.1995
Jochen Jung: Das Losungswort
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 16.12.1995
Laudatio auf H.C. Artmann
Nun hat sie also auch H.C. Artmann erreicht – die Inthronisierung auf dem Olymp der großen Geister seines Landes, obwohl er doch wahrlich sein Leben lang alles getan hat, den Anruch des Olympiers zu vermeiden und den Anspruch, er könne gar einmal als Repräsentant dieser Kultur gelten – was mit dieser hohen Auszeichnung ja offenbar gemeint ist −, permanent und gezielt zu unterlaufen. Aber diesmal haben diejenigen, die ihm die Ehrung zuerkannten, nun ihm ein Schnippchen geschlagen, das heißt, sie haben von ihm gelernt, von seiner Fähigkeit, immer das gänzlich Unerwartete zu tun, denn wer hätte erwartet, daß der gänzlich Unintegrierbare dennoch sozusagen heimgeholt wird?
Artmann als Repräsentant österreichischer Kultur – läßt sich ein Reim darauf machen? Ist er nicht angetreten, zusammen mit den Freunden zunächst des Wiener Art Clubs, dann der Wiener Gruppe, im aggressiven Widerspruch zur damals herrschenden, immer noch herrschenden Kultur und ihrer Repräsentanten? Ist er dafür nicht ausgegrenzt worden, verhöhnt, bestraft durch Nichtpubliziertwerden? Hat er sein Land – nach dem ersten Ruhm, den ihm die Dialektgedichte einbrachten und der vermutlich auf einem Mißverständnis beruhte – hat er sein Land nicht verlassen und anderswo gelebt, in Schweden und Deutschland, in Frankreich und Italien, in Irland und der Schweiz? Die Länder wechselnd wie die stets modischen Anzüge? Nirgendwo zu Hause und überall, wenn er mit seinem Köfferchen und der Reiseschreibmaschine vor der Tür stand, „Ich wollte mal wieder vorbeischaun“ sagte und dann drei Wochen blieb, bis es ihn weiterzog zu anderen Freunden, die ihm Heimat waren, und in andere Landschaften? Hat ihn nicht sein eigenes Land überhaupt erst auf dem Umweg über das Ausland akzeptiert, nachdem er in Deutschland Verleger gefunden hatte und dort berühmt geworden war – was freilich für fast alle seiner österreichischen Kollegen galt?
Dennoch – wenn wir davon absehen, daß die deutschsprachigen Länder im Unterschied zu Italien und Frankreich seit jeher in einer Art Dauerkriegszustand mit ihren innovativen Dichtern und Denkern, Komponisten und bildenden Künstlern gelebt haben – ich sehe niemanden, der typischer für die österreichische Kultur ist als H.C. Artmann, geradezu ihr Inbegriff und Kulminationspunkt, die vielfältigen, oft weit auseinander liegenden Stränge und Möglichkeiten ihrer Geschichte, die offen greifbaren und die verdeckten, verknüpfend und weiterdenkend, weiterformend, zu einem Kosmos, einem Riesenreich, in dem die Sonne nicht untergeht. Dahinter steht freilich eine Idee Österreichs, die weniger mit den derzeitigen Bundesländern zu tun hat als mit der Vielsprachigkeit und Multimentalität Habsburgs. Artmann hat dessen räumliche Dimensionen in die Vielstimmigkeit der Zeitmaße seiner Verse, der wechselnden Rhythmen seiner Prosa, seines Theaters übertragen. Was so entstand, war der einzigartige Versuch, eine politisch verlorene Welt in der Sprache aufzubewahren, in der Sprache als dem einzig unverlierbaren Besitz. Einzigartig war der Versuch deshalb, weil hier nicht in erzählerischer Breite einer untergegangenen Welt ein Denkmal gesetzt wurde, sondern weil Polyphonie und Polyglossie zum Motor dieser Dichtung selber wurden, und zwar nicht im Sinne von Zitat und Montage, die zum Signum der poetischen Verfahrensweisen der Moderne wurden, vielmehr in einem ständigen Übersetzungsprozeß, einem Assimilationsvorgang sondergleichen, der das Fremde als das eigene erkennbar werden läßt.
Dabei finden sich im Werk Artmanns niemals Selbstdarstellung und Selbstbespiegelung, keine Konfessionen. Alles Deutsch-Tiefsinnige, Deutsch-Raunende, Deutsch-Selbstquälerische ist ihm fremd. Wörter wie Leid, Schmerz, Verzweiflung scheint es in seinem Wortschatz, diesem größten Thesaurus der neueren deutschsprachigen Poesie, nicht zu geben. Doch vielleicht weist gerade das Fehlen solcher Wörter in die Richtung, wo solches Schreiben herstammt: es waren ja immer die großen Melancholiker, die sich nicht in die Karten schauen ließen und den eigenen Abgründen die hochgebauten Türme ihrer oft so schwerelos und luftig gewirkten Sprachspielwelten entgegensetzten. Gerade das sprichwörtlich Halsbrecherische einer mit Wörtern spielenden Existenz setzt eine Artistik, setzt einen Balanceakt voraus, die umso gelungener sind, je weniger man ihnen anmerkt, daß ein Tritt daneben in die Tiefe gegangen wäre, meinetwegen auch in den verräterischen Tiefsinn, ins Bekenntnishafte also, was diese Form des Dichtens, eben als Überlebensstrategie, liquidiert hätte.
Aber lassen Sie mich, bevor ich selbst tiefsinnig werde, zurückkehren zu dem, was ich den Assimilationsvorgang als Signum des Artmannschen Werks genannt habe. Er ist von Anfang an Motor seines Schreibens und läuft gleichzeitig in verschiedene Richtungen. Am offensichtlichsten ist es natürlich in seinen Übersetzungen, die einen integralen Bestandteil des Werks bilden. Es begann, wenn ich mich recht erinnere, in den späten 40er Jahren mit García Lorca und Gomez de la Serna. Das waren Entdeckungen – niemand im deutschen Sprachgebiet hatte von diesen Autoren gehört, niemand wollte von ihnen hören, da man vorgab, sich erst einmal mit sich selbst beschäftigen zu müssen und Artmann bezog damit zugleich seinen Standort in den Landschaften der europäischen Moderne, nicht im schottendichten Gehäuse irgendeiner Nationalliteratur. Man soll in diesem Zusammenhang auch ruhig daran erinnern, daß die Wiener Gruppe die einzige Unternehmung nach dem Krieg war, die die abgerissene Verbindung zur Tradition der Moderne wieder herstellte – also zum Expressionismus, Dadaismus, Surrealismus – und von da aus zu ihren für den literarischen Biedermann so schockierenden Experimenten gelangte. Artmann hat durch seine Übersetzungen zweierlei geleistet: er hat neue literarische Türen geöffnet, die zu Wunderkammern führten, und er hat immer zugleich die Möglichkeiten des eigenen Schreibens erweitert. Vielleicht ist es nicht richtig, hier im strengen Sinn von Übersetzungen zu sprechen, denn was Artmann macht, ist im Grunde ein Weiterdichten – er leiht gewissermaßen Lorca seine Stimme, und die Zigeunerweisen, die er singt, sind nur noch von ferne andalusische, es sind deutsche, aber in nie zuvor gehörten Tönen, die auch Ungarisches hereinholen und sozusagen hochliterarisieren. Oder auch, in anderen Fällen, herunter.
Das beste Beispiel hierfür sind seine genialen Villon-Übertragungen. François Villon, man erinnere sich, der Dichter der Pariser Unterwelt des Spätmittelalters, hatte in einem Argot geschrieben, den alle Übersetzungen – aus Prüderie, aus Hilflosigkeit – wegretouchiert hatten, so daß Lesebuchstücke für Töchter höherer Stände dabei heraus gekommen waren. Artmann nun hatte den genialen Einfall, den Argot Villons in die Sprache der Wiener Gallerie zu übersetzen und hat damit zum erstenmal ein Äquivalent für den großen Franzosen gefunden: Zuhälterei und Verbrechen, Schmutz und Elend, Liebesjammer und Saufkumpanei – sie werden auf einmal hörbar, als habe ein begnadeter Clochard der Wiener Vorstädte sie besungen: es ist die Kehrseite der Wiener Gemütlichkeit, die da zu hören ist, und es ist zugleich authentischer Villon.
Ein wieder anderes Beispiel wäre der Schelmenroman des Spaniers Quevedo, aus dem 16. Jahrhundert, den er in die Sprache seines Zeitgenossen Fischart übertrug, also in eine Art vorbarockes Idiom, das heißt, Artmann hat Texte nicht nur herübergeholt, in einen präsenten kulturellen Zusammenhang, so als wären sie heute geschrieben, er hat es auch verstanden, uns zu ihnen hinzubewegen, zu ihnen zu entrücken. Das hängt vielleicht mit seinem eigentümlichen Geschichtsverständnis zusammen, dem nichts Vergangenes vergangen ist. Er, der ganz im Heute lebt und ihm bis in seine flüchtigsten Trivialformen folgt, lebt zugleich in den Stilen der Vergangenheit, als seien sie aktuell und eben erst erfunden. So gesehen verändert sich auch der Blick auf die Gegenwart: sie zeigt sich einzig in ihren Stilformen, die so nah und gleichzeitig so fern sind – wie durch die beiden Seiten eines Perspektivs gesehen – wie die der Vergangenheit: Möglichkeiten einer kurzfristigen Identifikation, wie bei einem Schauspieler, der nach getaner Arbeit seine Königskrone oder seinen Bettelsack wieder an den Haken hängt.
Es ist bisher nur von der hohen Literatur die Rede gewesen, zu der schließlich auch Villon gehört. Doch ist dies nur die eine Seite der Artmannschen Kunst – die Verfügung über die Mittel und Verfahrensweisen der europäischen Literaturen. Die andere Seite möchte ich die Assimilation sämtlicher Ausdrucksformen nennen, in denen Menschen ihr Bedürfnis nach Fiktionen artikuliert haben. Der Mensch ist ein Wesen, das in und von Fiktionen lebt, sonst könnte er nicht leben. Wer nicht träumt, stirbt. Unser Sinn für die Wirklichkeit ist immer bestimmt durch Vorstellungen, die wir uns von ihr machen und durch die wir sie überschreiten, korrigieren, veredeln, verkitschen oder verdunkeln. Nur der allergeringste Teil dieses Fiktionalisierungsbedürfnisses wird von der hohen oder erlesenen Kunst gestillt. Der weitaus größte Teil spricht sich aus in dem, was verächtlich als Massenkultur bezeichnet wird. Lange bevor die offizielle Germanistik sich herabgelassen hat, literarische Trivialformen der Analyse für würdig zu befinden, hat Artmann ihre Möglichkeiten erkannt und benutzt. Schauerromane, Detektivheftchen und Comics, die Welt des Jahrmarkts und des Kintopps, des Schlagers und der Fernsehserien, Kinderreime und Moritaten – sie sind ihm vertraut wie die Dichter der silbernen Latinität. Er hat die mythenbildende Kraft eines Dracula oder Frankenstein, eines Hanswurst oder einer Micky Mouse erkannt, gegen die längst kein antiker Götterhimmel mehr aufgefahren werden kann. Jede Zeit schafft sich ihre eigenen Mythen – das wußten Vergil und Dante, Shakespeare und Goethe. Nur heute, mit unserer gewalttätigen Trennung in eine U- und eine E- Kultur, ist dieses Wissen verlorengegangen. Indem Artmann Trivialformen benutzt, rehabilitiert er im Grunde nur, was jahrhundertelang gängige Praxis war. Er benutzt sie, das heißt, er schöpft aus dem unversiegbaren Brunnen der kollektiven Phantasie, er taucht nicht in ihm unter. Er verwandelt, was er da heraufzieht, in die unergründlichen Formen seiner Dichtung, zeigt, wie aus Trivialkunst große Kunst werden kann, die zugleich den Schwung des Vertrauten sich bewahrt hat, wie immer verrückt, metaphorisiert, auch dämonisiert sie sein mag. Als Vorläufer, das mag Sie überraschen, fällt mir dazu nur Gustav Mahler ein: Der Tod in Gestalt eines Ländlers, das Schauerliche als das Altbekannte und Geläufige. Man kann sagen, daß auch das eine Seite des Wienerischen ist, wie sie literarisch wohl erstmals in Artmanns Gedichten med ana schwoazzn dintn ans Licht getreten ist.
H. C. Artmann – der Wiener und Habsburger, der Europäer und Kosmopolit, in allen Zeiten lebend und in keiner, sondern nur in der je eigenen Zeit eines Gedichts, eines Prosastücks, der alles assimilierende und der doch selbst ganz unassimilierbare, der Dichter der Leichtigkeit und des Abgründigen, verspielt und todtraurig – ich denke, Österreich ehrt sich selbst, indem es H.C. Artmann ehrt.
Klaus Reichert anläßlich der Verleihung des Ordens Litteris et artibus 1991 in Wien, Erstdruck in Manuskripte Nr. 114, Graz, 1991.
Ich betrachte die folgenden texte…
Ich betrachte die folgenden texte als bloße inhaltsverzeichnisse für den leser, als literarisierte inhaltsverzeichnisse freilich; als anhaltspunkte und als ideen für noch nicht existierende, erst in der vorstellung sich vollziehende gegebenheiten. Ich versuche mich also praktisch in ausgriffen auf die zukunft. Ein inhaltsverzeichnis weist auf etwas hin, das erst zu realisieren wäre: es ist ein vorentwurf, und ein solcher befaßt sich mit der zukunft.
Mit diesen texten soll ein weg, eine methode gefunden werden, um von der engen und allgegenwärtigen vergangenheit, wie sie da in der literatur als abgehalfterter Ahasver herumgeistert, wegzukommen. Hiermit soll der sehnsucht nach einer besseren vergangenheit entgegengetreten werden; wehmütiges sicherinnern ist fruchtlos, ein abgestorbner kirschbaum, der sich nie mehr beblättern wird. Wohl bin ich romantiker – aber war nicht jede romantik von etwas erfüllt, das uns hin und wieder gegen ende des winters gleich einer noch unrealen frühlingsbrise überfällt?
Auch die konventionelle science-fiction ist meist nichts anderes als in die zukunft projizierte vergangenheit (kenntlich allein schon am imperfektstil), obendrein dominiert der vergangenheitscharakter jedenfalls eindeutig in ihr.
Warum inhaltsverzeichnis? Warum so viel unausgeführtes? Warum nur angedeutetes? Warum nur versprechungen? – Warum denn nicht? Eine eindeutige antwort soll nicht gegeben werden, weil sprache festlegt; jeder leser mag jedoch für sich herausfinden, was diese texte ihm persönlich an möglichkeiten anbieten.
Auf die frage, welche von diesen möglichkeiten mir selbst am meisten am herzen liegen, kann ich nur antworten: jene, die in die westliche, in die atlantische richtung weisen, jene abenteuer, die ich bei der lektüre der fragmentarischen altirischen dichtung er-lebte, durch-lebte und noch heute weiter-lebe.
H.C. Artmann, aus: Unter der Bedeckung eines Hutes, Residenz Verlag, 1974
Laudatio auf H.C. Artmann
Ein die Dimensionen, in denen wir ordnend zu denken gewohnt sind, so eklatant sprengendes Werk wie das des Dichters H.C. Artmann, widersetzt sich der Reduzierung auf eine einzige handliche Formel. Dennoch verlangt unser Unverstand bohrend danach, gerade die komplexesten Phänomene auf einen einfachen Nenner zu bringen. Um es in diesem Fall zu erreichen, und zwar ohne die Täuschung, das überdimensionale Werk in einer Nußschale untergebracht zu haben, bietet sich der ehrliche Trick an, an die Stelle des einfachsten Nenners den Namen des Dichters zu setzen, Artmann als die Formel für Artmann. Das bedeutet anzuerkennen, daß mit ihm in der Literatur ein neues Element aufgetaucht ist, unangebahnt durch historische Entwicklung und im Kombinationsspiel der gegenwärtigen Literatur nicht placierbar. Es bedeutet für den Augenblick den Verzicht auf jede pauschale Motivation der zu zollenden Bewunderung.
Die Zuordnung zur Wiener Gruppe – für ein Bild Artmanns von geringerer Konsequenz als für das Gruppenbild – zeigt Artmann, während einiger entscheidender Jahre, lediglich innerhalb der Gruppe fixiert, als deren Zentrum und Lehrmeister; nicht jedoch in irgendeinem Konnex außerhalb, wie es etwa bei Rühm und Achleitner durch Einbeziehung in das Feld der konkreten Poesie geschehen ist.
Unbegreiflich bleibt es, wie man bei aller spontanen und anhaltenden Begeisterung für die Dialektgedichte des damals 37jährigen Dichters mit dessen schattenhaft wahrgenommener Figur sogleich sich zufrieden geben und alsbald sich anschicken konnte, sie nach der eigenen unzureichenden Vorstellung auszumalen und abzugrenzen. Das gänzliche Fehlen auch einfach der Neugier, wer denn dieser Autor tatsächlich sei und was er über das soeben Bekanntgewordene hinaus zu bieten habe, hielt um Jahre das Erscheinen seiner in Hochsprache verfaßten Arbeiten hintan, bereits damals ein unvergleichlich reiches, inspiriertes und inspirierendes Werk, an dem sich die Kreativität seiner Freunde entzündete.
Noch 1966, also acht Jahre nach dem Erscheinen von Artmanns erstem, so erfolgreichem Buch, mußte ein unermüdlicher Verfechter des Artmannschen Werkes in der Bundesrepublik feststellen, es dringe „dieser seltsame Mann“ in die damalige westdeutsche Situation „nur zögernd ein“, was er in der Weigerung Artmanns begründet sah, „die Pflichtübungen der literarischen Gesellschaft zu absolvieren“. Es gab damals, aus einem Schweizer Verlag, bereits das imaginäre Tagebuch Das suchen nach dem gestrigen tag oder schnee auf einem heißen brotwecken, gewiß ein Schlüsselwerk zur Persönlichkeit des Dichters, mit dem inzwischen berühmt gewordenen Selbstporträt als Vorrede, das mit den Worten beginnt, „Meine heimat ist Österreich, mein vaterland Europa, mein wohnort Malmö meine hautfarbe weiß, meine augen blau, mein mut verschieden meine laune launisch, meine räusche richtig, meine ausdauer stark, meine anliegen sprunghaft, meine sehnsüchte wie die windrose…“, und es „gab auch soeben aus demselben Verlag eine kleine, eher willkürlich anmutende Auswahl seiner Gedichte mit dem Titel verbarium und dem ratlosen Nachwort eines jungen Schweizer Autors. Das reichte nicht aus, und es bedurfte erst der beiden je 500 Seiten starken Bände des Jahres 1969, ein weißer brief aus lincolnshire. gedichte aus 21 jahren und die fahrt zur insel nantucket (die gesammelten Theaterstücke aus den Jahren 1952 bis 66), denen die als literarische Sensation aufgenommene, von Rühm herausgegebene Retrospektive Die Wiener Gruppe 1967 wegbereitend voranging und 1970 der wichtige, da bisher verstreute sowie als verloren geltende Schriften eischließends Querschnitt The Best of H.C. Artmann folgte – es bedurfte dieses massiven, zeitlich gedrängten Ausstoßes an Publikationen, um Artmanns Werk in seiner Größe und Tragweite erkennbar zu machen und Artmanns Ruhm ein für allemal zu begründen. Die genannten vier Titel zusammen mit Friederike Mayröckers Lyrik, Tod durch Musen, und Konrad Bayers Gesamtwerk, Der sechste Sinn beide 1966, schlossen den bis dahin von der Kritik und dem Publikum kaum wahrgenommenen Leerraum zwischen der fest etablierten Ingeborg Bachmann und dem heftig in die Szene drängenden Peter Handke. Erst jetzt gab es das Kontinuum, bis 1945 zurück, einer großen neuen österreichischen Literatur, die mit elementarer Gewalt in den gesamt-deutschsprachigen Zusammenhang einbrechen und dort alle Kategorien zum Wanken bringen konnte. Es ging, darüber möge man sich auch nach Artmanns großen Erfolgen nicht hinwegtäuschen, nicht mit offenen Armen zu, die ihn oder sonstwen ans große Verlegerherz gedrückt hätten, sondern es brauchte langwierige und zähe Kleinarbeit, der Autoren wie ihrer Mitstreiter, um auf dem Weg durch die allein von Idealismus genährten Kleinst-Zeitschriften und Miniaturpressen bis zur endlichen Eroberung der Großverlage fortzuschreiten. Und vor allem ein unerschütterliches Vertrauen war notwendig, in den Wert der eigenen Arbeit und den Wert der Poesie. Dieses Vertrauen, in Dichtung als einen absoluten Wert und in den Wert des eigenen Bemühens darum, haben nicht wenige, deren Name in der Literatur heute etwas gilt, von H.C. Artmann empfangen, durch das Beispiel seiner Standhaftigkeit und Unbeirrbarkeit, durch das Vorbild seiner Poesie, und nicht zuletzt durch seinen beharrlichen Zuspruch.
Die Beweglichkeit des Punktes Artmann auf der literarischen Karte, sein dauerndes Entgleiten ebenso wie seine Fähigkeit zu plötzlichem Auftauchen an mehreren Stellen zugleich, dieses enervierende Erlebnis für den Kartographen von Literatur, hätte ihn vermutlich alsbald in eine, wenn auch glänzende, Isolation treiben lassen, besäße er nicht so ausgeprägt die Anlage, sich durch überaus haltbare Fixierungen anderer Art ein Gegengewicht zu schaffen, nämlich durch Freundschaften von großer Beständigkeit. Diese sind in ihrem privaten Aspekt vielgestaltig und nicht summierbar, treten aber an markanten Stellen entschlossen aus dem Rahmen des Privaten. Das wird bezeugt durch die außerordentlichen Ergebnisse der Wiener Gruppe, und ebenfalls durch die Art, wie ein wesentlicher Teil von Artmanns Werk einzig publiziert werden konnte, nämlich in von engen persönlichen Freunden mit Akribie zusammengestellten und kommentierten Sammelbänden, denen wiederum die Sorgfalt von Manuskripte hütenden Freunden vorausging. Diesem Einsatz der Freunde verdanken wir die genannten, das bisherige Werk möglichst lückenlos präsentierenden Großbände, worüber das 1970 erschienene Buch Das im Walde verlorene Totem mit den Prosadichtungen der Jahre 49 bis 53 nicht vergessen werden darf. Hinzu kommen, in der nicht minder wichtigen Funktion von Herolden seiner Poesie, weitere persönliche Freunde, wie alle ausgestattet mit unbedingtem Vertrauen zu ihm als Dichter. Ihren Namen an den Artmanns gebunden zu haben, ist ihnen Ehre und erleichtert die Vergänglichkeit.
So kann Artmann, alias Jack Hawkensworth, in seinem neuesten Buch, dem phantasmagorischen Selbstporträt Die Jagd nach Dr. U. oder Ein einsamer Spiegel, in dem sich der Tag reflektiert, in Erweiterung seiner berühmten Selbstdefinition aus dem „suchen nach dem gestrigen tag“ mit gutem Grund erklären: „Mein vaterland liegt jeweils dort, wo ich gute freunde habe, demnach besitze ich also eine ziemliche menge sogenannter vaterländer – welche fahne soll ich abwerfen?“ – nämlich aus der Gondel seines Luftschiffes über dem Nordpol.
Von den sein Werk bestimmenden Zügen des Dichters läßt sich mit der geringsten Gefahr einer Verkennung die an Joyce und Pound gemahnende Vielsprachigkeit nennen, die in sein Kreatives derart einfunktioniert ist, daß seine Übersetzungen stets zugleich eigenständige poetische Leistungen darstellen die Einbeziehung fremden Idioms ins eigene Werk (und zwar sowohl von – vorzugsweise fernliegendem – Fremdsprachigem, als auch von Frühformen des Deutschen) ohne Einbuße an Eigensprachigkeit erfolgt. Anders gesagt: was an Sprache, ungeachtet woher, Artmann verwendet, wird unverwechselbar Artmann.
Dies zeigt sich besonders deutlich an seinen kühn innovativen Texten aus der Kooperationsphase innerhalb der Wiener Gruppe, die sich bei heutiger Betrachtung, nach nunmehr zwei Jahrzehnten, nahtlos ins übrige Werk einfügen, ohne Notwendigkeit des Verweisens auf die Bedingungen ihres Entstehens. Daß das gleiche im chronologischen Ablauf von Rühms Werk für diese Phase gilt, zeigt nicht nur Rühms Stärke, sondern läßt Rückschlüsse auf Artmanns Respektierung der Andersartigkeit eines großen Talents und damit auf seine Rolle innerhalb der Wiener Gruppe zu. (Erinnernd darf man ergänzen, daß Rühm die Gestik etwa der schäferischen Schwärmerei in Freundschaft zum Meister vorzüglich beherrschte, ohne sie deshalb ins eigene Werk einzubeziehen.) Artmanns Biographie zeigt ihn schon in frühesten Jahren die Fundamente seines Wirkens errichtend etwa indem er sich bereits vierzehnjährig dem Walisischen und Schwedischen zuwandte, zwei für ihn später sehr ergiebigen Sprachquellen.
Um nochmals an den Flug im Luftschiff anzuknüpfen: die Weisheit Artmanns ließ ihn nie auf den irdischen Kontakt verzichten – zu diesem Zweck bediente er sich der verschiedensten Muster aus der Volksdichtung und der Populärliteratur.
Auf seinen Reisen, vorzugsweise in die westliche Welt, schloß er sich an den pulsierenden Kreislauf der von ihm studierten und assimilierten Sprachen und Literaturen an, frischte sein Herz auf und schickte die Sprache, woher immer sie kam, zu ihrer weiteren poetischen Erziehung ins fremdländische Leben.
An die unüberbietbare Auszeichnung, die sein Werk ihm verleiht, schließen sich Zeichen der Anerkennung seines Wirkens für die Öffentlichkeit in Gegenwart und Zukunft: der Große Österreichische Staatspreis; die Aufnahme in die Akademie der Künste, Berlin; jetzt der Preis der Stadt Wien für Literatur. Es kann also nicht als Verletzung privaten Bodens mißdeutet werden, das Datum der heutigen Würdigung als zwölf Tage vor seinem neuesten Geburtstag liegend zu markieren, um mit dem Ruf zu schließen: Lang lebe Artmann!
Ernst Jandl, Literatur und Kritik, Heft 12, 1977
„Spielt Artmann! Spielt Lyrik!“ (Teil 1)
„Spielt Artmann! Spielt Lyrik!“ (Teil 2)
Fakten und Vermutungen zum Herausgeber
Fakten und Vermutungen zum Autor + Reportage +
Archiv + Sammlung Knupfer + IMDb + KLG + ÖM
Interview 1 + 2 + Georg-Büchner-Preis
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum +
Autorenarchiv Susanne Schleyer + Brigitte Friedrich Autorenfotos
shi 詩 yan 言 kou 口
Nachrufe auf H.C. Artmann: FAZ ✝︎ Standart ✝︎ KSA
70. Geburtstag + 10. Todestag
Ausschnitte aus dem Dokumentarfilm Die Jagd nach H.C. Artmann von Bernhard Koch, gedreht 1995.
H.C. Artmann 1980 in dem berühmten HUMANIC Werbespot „Papierene Stiefel“.


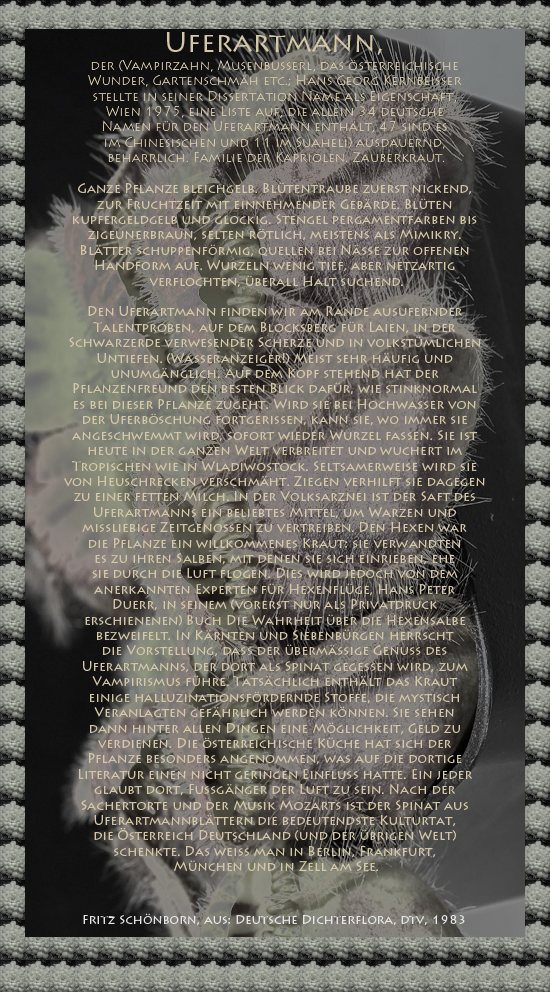








Schreibe einen Kommentar