Mahmud Darwisch: Belagerungszustand
Das Leben.
Das Leben in seiner Gänze,
Das Leben in seiner Unvollständigkeit
Empfängt benachbarte Sterne,
Die zeitlos sind…
Und wandernde Wolken,
Die ortlos sind.
Und das Leben hier
Stellt sich die Frage:
Wie kann man ihnen das Leben wiedergeben?
Belagerungszustand
ist eines der wichtigsten Bücher des palästinensischen Lyrikers Mahmud Darwisch. Die Gedichte, geschrieben unter dem Eindruck der israelischen Invasion, beginnen mit konfrontierenden Versen und enden mit einem Besingen des ersehnten Friedens zwischen Palästinensern und Israel.
In einer knappen, dokumentarischen Sprache reflektiert Darwisch das tägliche Leben unter der Belagerung, die Suche nach verlorener Menschlichkeit, und er hinterfragt den Mythos des „Märtyrers“.
Der Band umfasst Liebesgedichte ebenso wie politische Lyrik und imaginiert – wie ein Psychogramm – den Alltag unter der Besatzung, die kleinen Wunden und großen Sehnsüchte, quälende Ängste und robuste Hoffnungen.
Verlag Hans Schiler, Klappentext, 2006
Die Trümmer des künftigen Troja
HALAT HISAR nannte Mahmoud Darwish seinen 2002 in arabischer Sprache veröffentlichten Gedichtband, der 2005 zweisprachig unter Belagerungszustand im Hans Schiler Verlag, Berlin erschien.
Es ist eines seiner wichtigsten Bücher und erschien zur Zeit der zweiten Intifada, des zweiten Aufstandes der Palästinenser gegen die israelische Besatzung. Sie begann im September 2000 und zog Palästina und Israel in blutige Gemetzel, von denen sich viele der hineingerissenen Menschen bis heute noch nicht erholt haben.
Es war die Zeit
der Selbstmordattentate durch Palästinenser, vorwiegend in der Gegend um Hadera,
des Lynchens israelischer Soldaten in der Westbank, die sich verfahren hatten,
der Exekutionen führender Palästinenser durch die israelische Armee,
des Panzerrollens im Gazastreifen und der Westbank und
der Diskussion um den Mauerbau, um das Westjordanland endgültig abzuriegeln.
Es war die Zeit,
in der der Hass die Luft verseuchte und die Menschen auf beiden Seiten in tiefe Angst und Trauer stürzte,
in der auch zahlreiche jüdische Israelis auswanderten.
Belagerungszustand beginnt mit konfrontierenden Versen unter dem Eindruck der israelischen Invasion und endet mit einem Gesang über den ersehnten Frieden.
Mahmoud reflektiert hier das alltägliche palästinensische Leben unter der Belagerung, er sucht Menschlichkeit bei den Israelis und hinterfragt den Märtyrermythos der palästinensischen Selbstmordattentäter.
Der Gedichtband umfasst sowohl politische Lyrik wie auch Liebesgedichte:
Hier, an den Hängen der Hügel, im Angesicht der sinkenden Sonne
und des Schlundes der Zeit
nah den schattenberaubten Gärten
tun wir, was Gefangene tun,
tun wir, was Menschen tun ohne Arbeit:
wir nähren die Hoffnung.
Kein homerisches Echo hier von irgend etwas.
Die Mythen pochen an unsere Türen, wenn wir sie brauchen
kein homerisches Echo von irgend etwas…
Hier ist ein General, der gräbt nach einem schlafenden Staat
unter den Trümmern eines künftigen Troja
Soldaten messen den Abstand zwischen dem Sein
und dem Nichts
mit dem Zielrohr eines Panzers
Wir messen den Abstand zwischen unseren Körpern
und der Granate mit dem sechsten Sinn
ICH ODER ER
so beginnt der Krieg.
Doch er endet mit einer beschämenden Begegnung
ICH UND ER.
Die Seele steige ab,
um auf ihren seidenen Füßen zu gehen
an meiner Seite, Hand in Hand, wie zwei alte Freunde,
die sich das alte Brot
und den Kelch des alten Weines teilen,
auf dass wir diesen Weg gemeinsam gehen
bevor unsere Tage sich in zwei Richtungen scheiden:
Ich gehe ins Jenseits, sie aber hockt,
die Arme um ihre Beine geschlungen,
auf einem hohen Felsen
Die Belagerung macht mich von einem Sänger
zu einer sechsten Geigensaite
Mahmud Darwisch, die poetische Stimme des palästinensischen Volkes, war einer der herausragenden zeitgenössischen Dichter in der arabischen Welt. Zu den internationalen Auszeichnungen, die er für seine Arbeiten erhielt, zählen u.a. der Lenin-Friedenspreis (1983), der Lannan Cultural Freedom Award (2001), der Erich-Maria-Remarque-Friedenspreis der Stadt Osnabrück (2003 zusammen mit dem jüdisch-israelischen Schriftsteller und Psychologen Dan Bar-On) sowie der Goldene Kranz (2007).
Mahmud Darwisch wurde 1941 in Barwa in der Nähe von Akko (damaliges Britisch-Palästina) geboren. Er starb am 09. August 2008 nach seiner dritten Herzoperation in Houston, USA.
Als Siebenjähriger musste Darwisch mit seiner Familie während des israelischen Unabhängigkeitskrieges unter israelischem Gewehrfeuer in den Libanon flüchten. Heimlich kehrte er nach Gründung des Staates Israel in sein Geburtsland zurück. Als Jugendlicher wurde er mehrfach inhaftiert und unter Hausarrest gestellt. 1971 ging Mahmoud Darwish ins Exil ( Moskau, Kairo, Beirut, Tunis, Paris, Amman) und lebte schließlich seit 1996 wieder teilweise in Ramallah (Westjordanland), wo er 2008 bestattet wurde. So blieb ihm zumindest der Blick auf den Gazakrieg Dezember 2008 – Januar 2009 erspart.
Marion Sens „ms“, amazon.de, 24.5.2009
Vexierbilder
− Mahmud Darwish zwischen hebräischem und arabischem Literaturkanon. −
Am 9. August 2008 starb mit Mahmud Darwish einer der bedeutendsten Dichter der modernen arabischen Literatur. Sein Tod wurde angesichts seiner lebenslang gespielten Rolle als „Sprecher seiner Gesellschaft“, des palästinensischen Kollektivs, und gleichzeitig als die meistgehörte poetische Stimme der arabischen Welt, im gesamten arabischen Sprachraum als schmerzlicher Verlust wahrgenommen, der in zahllosen Gedenkreden, Nachrufen und weltweiten Poesierezitationen betrauert wurde. Während aber seiner literarischen Bedeutung für die arabische Literatur und überhaupt die Weltliteratur ebenso wie seiner politisch-ideologischen Rolle volle Aufmerksamkeit zuteil wurde, kam Darwishs besondere hermeneutische Leistung nur am Rande zur Sprache. Es blieb unausgesprochen, daß der Dichter, der von seiner arabischen Kulturgemeinschaft früh als die „Stimme Palästinas“ reklamiert worden war, und der sich bis in die Neunzigerjahre hinein wichtigen politischen Aufgaben nicht hatte entziehen können, die „andere“ Kulturgemeinschaft, in deren Mitte er aufgewachsen war, die israelische, nie aus dem Blick verlor und sie vor allem in seinen Gedichten ebenso wie die arabische immer wieder „ansprach“. Das geschieht zumeist nicht direkt, sondern hermeneutisch vermittelt über Intertexte aus dem jüdischen Literaturkanon, zunächst und vor allem die Hebräische Bibel, später die Dichtung von Paul Celan, zuletzt auch die Philosophie Walter Benjamins. Diese von Darwish verfolgte Ansprache zweier Leserschaften, der arabischen und der jüdisch-hebräischen, ist nicht auf den ersten Blick einsichtig; sie ist für alle diejenigen Kritiker schwer zu erkennen, die mit der Hebräischen Bibel und der hebräischen und exiljüdischen Literatur nicht vertraut sind; für die meisten Israelis wiederum bleibt sie hinter dem arabischen Sprachgewand der Gedichte verborgen. Obwohl diese Gedichte auch ohne ihre hebräischen oder jüdischen Intertexte als Meisterwerke erkennbar sind, bezeugt doch Darwishs Festhalten an seinem zweiten, israelischen bzw. jüdischen Auditorium, eine einzigartige intellektuelle Offenheit, die sich diametral von dem antagonistischen Umgang mit dem jeweils anderen in der tagespolitischen Auseinandersetzung abhebt. Die Herausforderung, die Texte des Dichters als Vexierbilder, d.h. mit zwei verschiedenen Stoßrichtungen zu lesen, verspricht nicht nur, bisher unzureichend wahrgenommene politisch-ethische Dimensionen seines Werks offenzulegen. Sie zwingt zugleich dazu, von uns als „eigene“ reklamierte vertraute Texte, die in seine Dichtung eingegangen sind, neu zu lesen, sie als „Palimpseste“ zu erkennen, die durch seine Einschreibung eine neue Sinnschicht amalgamiert haben, oder – musikalisch gesprochen – polyphon geworden sind.
Ich, Wir und Du
„Durch viele Formen geschritten – durch Ich und Wir und Du“ -. Wenn dieser Vers auch nicht von Mahmud Darwish stammt, sondern von Gottfried Benn, so trifft er doch mit der Problematisierung des dichterischen Selbst geradezu den Nerv der Dichtung von Mahmud Darwish, der im folgenden – nicht als exotisch-arabischer, sondern als ein in unserer Tradition selbst präsenter Dichter – vorgestellt werden soll. Jetzt, nach seinem vorzeitigen Tod am 9. August 2008, wo zahlreiche Internet-Seiten nicht nur Nachrufe, sondern auch Originalaufnahmen seiner Rezitationen und Texte besonders beliebter Gedichte von neuem zugänglich machen, fällt auf, wie eindringlich die beiden Ichs des Dichters, sein Rollen-Ich als Sprecher seines Kollektivs und noch mehr sein prophetisches Dichter-Ich als Partner, Befreier, Hoffnungsanker dieses Kollektivs, im Gedächtnis der Nachlebenden geblieben sind. In der Tat gründet sich Darwishs noch in Haifa begonnene Dichterkarriere auf ein Gedicht, „Ashiq min Filastin“, „Ein Liebender aus Palästina“, das – 1966 von dem 25jährigen Poeten geschrieben – als Zeugnis eines lebenslangen Bundes des Autors mit seiner Nationalgemeinschaft verstanden wurde ein Bundestext, mit dem er sich nicht nur das Recht auf ein Verbleiben im Staat Israel verwirkte, sondern der ihn auch noch später, als er sich als persönliches, politik-fernes Ich zu äußern begann, in andauernde Rechtfertigungsnot zwang.
Dieser Zwiespalt zwischen politischer und künstlerischer Rolle gilt noch nicht für seine Beiruter Zeit – Darwish mußte 1970, 29jährig – durch zunehmende Repressalien gezwungen – Israel verlassen. Auf Umwegen kam er nach Beirut, wo es nun, nach dem Erwachen des palästinensischen Widerstands, galt, dem sich in der Öffentlichkeit manifestierenden „Wir“ der Revolutionäre eine artikulierte Stimme zu verleihen. Auch dies vollzog sich nicht konfliktlos, denn dieses „Wir“ – verkörpert in einer ganzen Generation von jungen Palästinensern, Söhnen entrechteter, in ärmlichen Lagern vergessener Familien ohne Anspruch auf persönliche Würde, die jetzt als Aktivisten einer Befreiungsbewegung hervortraten – dieses Wir war heftig umstritten. Die Ideale der Kämpfer mußten vor dem Zugriff nationalistischer Propaganda bewahrt werden, ihr Blut durfte nicht in Tinte und Druckerschwärze verschwimmen. Denn Beirut war damals, so berichtet Darwish später,
eine wahre Posterherstellungsfabrik. Gewiss die erste Stadt der Welt, die die Produktion von Postern auf das Niveau von Tageszeitungen erhob (…): Gesichter an den Wänden, Märtyrer, die frisch aus dem Leben und den Druckpressen herauskamen, der Tod, als Reproduktion seiner selbst. Ein Märtyrer ersetzt das Gesicht des anderen, nimmt seinen Platz an der Wand ein, bis ihn wieder ein anderer ersetzt oder der Regen ihn abwäscht
Für den Dichter also ein Seiltanz zwischen dem Anspruch auf sprachliche Veränderung der Welt, auf Gestaltung eines neuen Bewusstseins, und einem bereits im Gange befindlichen Mißbrauch der Sprache und ihrer Symbolik in der Massenpropaganda. Ein Gedicht aus dieser „Wir-Dichtung,“ das allerdings nicht den Beiruter Aktivisten, sondern den erst Jahre später auftretenden Intifada-Kämpfern in der Westbank gilt, ist heute im Internet besonders präsent, obwohl Darwish selbst es aus seinen Sammlungen verbannt hatte, weil es – im Zorn geschrieben – eine Fülle von Tabubrüchen begeht. Kein anderes Gedicht hat je so viele hebräische Übersetzungen und Kommentare provoziert bis hin zur Erwähnung in der Knesset wie „Abiruna fi kalamin abir“, „Ihr, die ihr vorüberzieht unter vergänglichen Worten“, das eine provokant-verzerrende Evokation des im Zionismus als Nationalmythos reklamierten Exodus bereits im Titel trägt („vorüberziehen“ statt „ausziehen“), das vor allem aber hebräische Sprachregelungen durch ihre arabische Übersetzung verfremdet und so israelische Sensibilitäten empfindlich verletzt. Das Gedicht ist ein Vexierbild: auf arabisch gelesen sehr zornig, aber eigentlich harmlos – durch die Linse des Hebräischen mit seiner biblischen Symbolik betrachtet aber eine ungeheuerliche Bloßstellung.
Nicht nur hat Darwish dieses Gedicht später zurückgezogen, er hat sich überhaupt von der Ich- und Wir-Rede im Dienste kollektiver Identitäts-Bewahrung gelöst.
Der Wandel seiner Dichtung hin zur Rede über sein persönliches Ich vollzieht sich in seiner Pariser Zeit (1982–1996), wo das Du des „anderen“, auch des jüdischen anderen, zum integralen Teil des dichterischen Ich wird. In der letzten Dekade seines Wirkens – wieder im Nahen Osten – geht er noch einen Schritt weiter und macht sein fragmentiertes Ich, Wir und Du selbst zum Thema, zum Diskurs seiner Dichtung.
Was hat das alles aber mit dem angekündigten Thema der in einander verschränkten Literatur-Canones zu tun? Die behauptete Beziehung wird klar, wenn wir Darwishs Ich-, Wir- und Du-Rede mit einzelnen biblischen Büchern verbinden, sie als Einträge in jüdische Referenztexte verstehen. Als Gespräch mit den Trägern der biblischen Tradition gelesen sind Darwishs Texte polyphon, oder anders ausgedrückt: sie oszillieren, werden zum Vexierbild, das eine arabische, aber auch eine „hebräische“ Lektüre erlaubt, „li-l-haqiqa wajhan“ – „die Realität hat zwei Gesichter“, wie Darwish es in einem späten Gedicht selbst genannt hat.
Der Dichter und seine Welt
Darwish Mahmud, geboren 1942 in dem galiläischen Dorf Birwa, das 1948 dem Erdboden gleich gemacht wurde, aufgewachsen als Sohn einer illegal aus dem Libanon zurückgekehrten Familie, trat früh als Dichter hervor. Dichtertum ist in der arabischen Welt – bis heute – nicht so sehr Schriftstellerei, als künstlerische Darstellung, performance; es beweist sich weniger in der Publikation von Gedichten im Druck, als im öffentlichen Vortrag. Doch auch diese Publikationsform ist nicht zensurfrei. Darwish eroberte mit seinen Vorträgen rasch eine arabische Hörerschaft, fiel aber gleichzeitig den israelischen Behörden auf und mußte öfters Hausarreste und Inhaftierungen in Kauf nehmen. Dabei waren seine Gedichte eher elegisch als aggressiv, der Nationalismus der Nasser-Ära stand ihm fern – zwei ganz andere Prägungen trieben ihn um. Zunächst die fremde, neue Kultur: Noch in viel späteren Interviews erwähnt er mit Bewunderung eine junge Hebräischlehrerein, die ihn in einzelne Bücher der Hebräischen Bibel einführte, Texte, die als Legitimationstexte für den neuen Staat Pflichtlektüre waren – offenbar aber ohne dabei ihre Faszination einzubüßen. Darwish hat sich im Hebräischen immer zuhause gefühlt, er hat sich über diese Sprache nicht nur die Weltliteratur erschlossen, sondern sich auch in die Literatur aus der Zeit vor und nach der Staatsgründung intensiv eingelesen. – Auf der anderen Seite das lastende Schweigen seiner eigenen Gesellschaft, die für ihre Katastrophe von 1948, den Verlust der Mehrheit ihrer Bevölkerung, keine Erinnerungsräume besaß, weder Denkmäler oder Museen noch liturgische Feiern – nur die Dichtung. Nur diese Dichtung, lokale Volksdichtung und die auf 1400jähriger Tradition beruhende Kunstdichtung, konnte die Gravitationskraft entwickeln, die erforderlich war, um die Entwurzelten an das ihnen nicht mehr gehörende Land zurückzubinden. Bis zu seinem Exil 1970 führte Darwish die prekäre Existenz eines arabischen Dichters und israelisch-arabischen Intellektuellen in einer Person.
Das frühe Langgedicht „Ashiq min Filastin“, mit dem Darwish 25jährig über Nacht zu dem Dichter Palästinas wurde, kreist um eine Grenzerfahrung: der Dichter wird sich beim Anblick seiner Heimat – offenbar vom Berg Karmel auf die Küstenebene hinunterschauend – unvermittelt seiner geradezu erotischen Liebesbeziehung zu Palästina bewußt. Er hat diese Erfahrung auch in Prosa, in dem später (1973) veröffentlichten Tagebuch der alltäglichen Traurigkeit (1978) festgehalten:
Unvermittelt erinnerst du dich, daß Palästina dein Land ist. Der verlorene Name führt dich in verlorene Zeiten, und am Strand des Mittelmeers liegt das Land wie eine schlafende Frau, die plötzlich erwacht, als du sie bei ihrem schönen Namen rufst. Sie haben dir verboten, die alten Lieder zu singen, die Gedichte deiner Jugend zu rezitieren, die Geschichten der Rebellen und Dichter zu erzählen, die dieses alte Palästina besungen haben. Der alte Name kehrt zurück aus der Leere, du öffnest ihre Karte so, als öffnetest du die Knöpfe des Kleides deiner ersten Liebe zum ersten Mal.
Poesie und Lieder – die Geschichte der Araber Palästinas – die hier unterdrückt werden, müssen totgeschwiegen werden, weil das Land nun mit einer anderen Sprache, einem anderen Gedächtnis und einer anderen Geschichte verbunden ist, weil ihm ein Text eingeschrieben ist, der als primordialer, von der Weltgemeinschaft universal anerkannter Text alle später gekommenen Texte außer Kraft setzt. Darwish ist sich bewußt, daß Dichtung eine Antwort sein muß auf die bereits existente Schrift, die in das Land eingeschrieben ist, um die schicksalhaft vorbestimmte Präsenz der anderen zu legitimieren: die Hebräische Bibel:
Man muß sich klar darüber sein, daß Palästina bereits geschrieben worden ist. Der Andere hat dies auf seine Weise getan, auf dem Wege der Erzählung einer Geburt, die niemand auch nur im Traum bestreiten wird. Einer Erzählung der Schöpfungsgeschichte, die zu einer Art Quelle des Wissens der Menschheit geworden ist: der Bibel. Was konnten wir anderes tun, als unsererseits eine mythische Erzählung schreiben? Das Problem der palästinensischen Poesie ist, daß sie ihren Weg begonnen hat, ohne sich auf feste Anhaltspunkte stützen zu können, ohne Historiker, ohne Geographen, ohne Anthropologen. Das machte es unumgänglich, durch einen Mythos hindurchzugehen, um beim Bekannten anzukommen.
Mit anderen Worten: Die master narrative der schicksalhaft verhängten palästinensischen „Abwesenheit“ war „um-zuschreiben“.
Der Dichter und sein Palästina: Eine Genesis-Geschichte
Die palästinensische Öffentlichkeit verknüpft diese von Darwish geleistete „Um-schreibung“ mit dem Anspruch auf die Person des Dichters als ihres Sprechers. In der Tat kann das Gedicht „Ashiq min Filastin“ („Ein Liebender aus Palästina“) als eine Art Bündnis-Dokument zwischen Dichter und Gesellschaft gelesen werden. Es beginnt mit den Versen „Deine Augen sind Dornen in meinem Herzen“ („Uyunuki shawkatun fi l-qalbi“) – und evoziert so Erfahrungen, die tief in die arabische literarische Tradition zurückreichen. Der Blick der Geliebten, der die persona des Dichters so schmerzlich trifft, ist nämlich jener Blick, der dem nahöstlichen Hörer aus dem ghazal, dem Liebesgedicht, seit jeher vertraut ist, sei es durch das udhritische Liebesgedicht von der hoffnungslosen Liebe, das noch Heinrich Heine beeindruckte, sei es das mystische Liebesgedicht von der Liebe des Sufi zu seinem Gott. Der Blick des geliebten Anderen, der den Liebenden verletzt, fordert ihm absolute Hingabe ab. („Deine Augen verletzen mich… ich aber bete sie an.“) Der Adressat des ghazal, ursprünglich die unnahbare geliebte Frau, später der unerreichbare göttliche Geliebte, wird in der postkolonialen Ära neu besetzt durch ein ebenfalls unerreichbares Anderes: das Bild der verlorenen oder besetzten Heimat. Im Fall Palästinas muß der Dichter, um diese Geliebte überhaupt anrufen zu können, sie zuerst in die Realität zurückholen, ihr ihren Namen zurückgeben. Denn 1966 war der Name „Palästina“ noch ein politisches Tabu, nachdem er mit der Gründung des Staates Israel abgeschafft und mit der Annexion der Westbank durch Jordanien dort ebenfalls verpönt war. Es gab nichts mehr, das Palästina hieß.
Es ist keine Übertreibung zu behaupten, daß das Gedicht „Ein Liebender aus Palästina“ Palästina aus Worten neu erschafft. Dazu greift Darwish auf ein alt bewährtes poetisches Modell für die Bewältigung von Verlustschmerz zurück: die Standardform der altarabischen qasida, ein Langgedicht mit der Aufeinanderfolge von drei Sektionen, die jeweils in einem eigenen Tenor gehalten sind. Die qasida beginnt mit einem elegischen Eingangsteil, dem nasib, das oft den Verlust einer Geliebten, fast immer aber die Auslöschung der einstigen Wohnstätten, atlal, beklagt und mit diesem Raumverlust einer nirgends sonst so überwältigend erfahrenen Melancholie Ausdruck gibt. Die altarabische „Klage über die verwüsteten Wohnstätten“ blieb bis in die Moderne der Schlüsseltopos der nahöstlichen Dichtung und hat noch Garcia Lorca den Vorwurf zu einem seiner Trauergedichte geliefert. Auf die Elegie folgt die heroischepische Beschreibung einer Reise, rahil, auf der der Dichter sein Selbstvertrauen zurückgewinnt. Er kehrt sich vom Ort der Verlusterinnerung ab und begibt sich, gestärkt durch den am ehesten Ausdauer und Beständigkeit verbürgenden Begleiter, sein Reitkamel, auf den Heimweg zu seinem Stamm. Das Gedicht kulminiert in einem pathetisch-appellatorischen Schlußteil, oft einer Preisung oder einem Selbstpreis, die die heroischen Tugenden der tribalen Gesellschaft feiern. Darwish wird diese komplexe Gedankenfigur in seinem späten Gedicht, „Yakhtaruni l-iqa“, „Der Rhythmus erwählt mich“, aus dem Jahr 2004 buchstäblich aushebeln und die 1400 Jahre alte elegische Feststellung der Unkenntlichkeit der ausgelöschten Wohnstätten, des Raumes, in die moderne kritische Feststellung der Unerkennbarkeit des Betrachters, des dichterischen Ich, übersetzen: „Du bist nicht Du, und die Wohnstätten sind nicht die Wohnstätten“. Vor allem aber wird er dem Reisemotiv seinen altarabischen Tenor heroischer Selbstbehauptung nehmen und ihm durch die Umdeutung in einen „Exodus ohne Ende“ eine neue tragische Dimension verleihen. Aber das geschieht erst 2004, in einem der späten Gedichte.
Doch schon Darwishs 40 Jahre älteres Gedicht von 1966 ist revolutionär: Die kurze im ghazal-Stil gehaltene Anrufung der Geliebten stiftet eine für die qasida nicht denkbare intime emotionale Bindung:
Deine Augen sind Dornen im Herzen
Sie verwunden mich, doch ich bete sie an
Und bewahre sie vor dem Wind.
Ich berge sie vor Nacht und Schmerzen,
So daß ihre Wunde Leuchten entzündet
Und ihr Morgen mein Heute mir kostbarer macht als meine Seele.
Auch hat die Orientierungslosigkeit des vor den Ruinen stehenden altarabischen Dichters jetzt kollektive Dimension: die Auslöschung der Wohnstätten hat ein Verstummen nicht nur des Dichters, sondern seiner Welt zu Folge.
Deine Worte waren ein Lied.
Ich versuchte es zu singen,
Doch das Elend umzingelte die Frühlingslippen,
Deine Worte – wie Schwalben – flogen auf von meinem Haus
Der Sehnsucht nach und wanderten aus von der Tür unseres Heims
Und der herbstlichen Schwelle
In Darwishs folgendem Reiselied, dem zweiten Teil der qasida, das schließlich zu jener bereits aus dem Prosa-Text bekannten Vision der wiedererkannten Heimat führt, geht der Sprecher nicht mehr physisch, sondern mit seinem Blick auf die Reise, verfolgt die Geliebte zu verschiedenen Szenarien des Elends: zum Hafen, dem Ort unfreiwilliger Auswanderung, zu Dorfruinen, zu Lagerräumen ärmlicher Bauernhäuser, zu billigen Nachtclubs und Flüchtlingslagern:
Ich sah dich gestern im Hafen…
Eine Reisende, ohne Anverwandte, ohne Wegzehr…
Ich sah dich auf dornüberwucherten Bergen,
eine Hirtin ohne Schafe,
verfolgt durch die Ruinen…
Die lange Folge von Visionen der Heimat in Bedürftigkeit und Demütigung nimmt eine plötzliche Wendung, als ihm die Geliebte in einer deutlich erotischen Ausstrahlung erscheint, als schlafende Schönheit – eine palästinensische Aphrodite:
Ich sah dich, ganz bedeckt von Meeressalz und Sand,
Deine Schönheit war von Erde, von Kindern und Jasmin.
Diese Endvision weckt den Sprecher aus seiner Melancholie und läßt ihn einen Eid absoluter Hingabe an die Heimat schwören. Der genau im Zentrum des Gedichts stehende Schwur verspricht in einer komplexen Metapher die Vollendung der poetischen Schöpfung der Geliebten, dargestellt als Produktion einer Textilie, eines Schleiers für sie, der aus Teilen seines Körpers gefertigt ist und so eine Art Selbst-Opfer darstellt:
So schwöre ich:
Ich werde dir einen Schleier weben aus meinen Wimpern für deine Augen
Und einen Namen, der – gewäßert mit meinem Herzen-
Die Bäume grüne Zweige treiben läßt.
Ich werde einen Namen auf den Schleier schreiben,
Teurer als Märtyrerblut und Küsse:
Palästinensisch ist sie und wird sie bleiben.
Der Sprecher tritt damit in die Rolle des biblischen Namensgebers, Adam, ein, des Ersten Menschen, der den Auftrag erhielt, die neu geschaffenen Wesen zu benennen. Wie Adam gibt auch er einen Teil seines Körpers hin, um die Erschaffung seiner Gefährtin vollkommen zu machen. Die Eva des Gedichts ist eine mythische Figur, Palästina – von nun an die Partnerin des Dichters, die ihm ihren Namen, ihre Realität, verdankt. Eine dichterische Schöpfung, die sich nicht nur biblisch, sondern auch koranisch legitimiert, indem sie im Schlußvers der Strophe „Palästinensisch ist sie und wird sie bleiben“ unüberhörbar den koranischen Schöpfungsimperativ „kun fa-yakun“ („Sei – und es ist“, Sure 3, Vers 117) evoziert, und mit dieser biblisch-koranischen Intertextualität den Anspruch auf ein palästinensisches Transkript der Genesis-Geschichte untermauert.
Nun, da die Geliebte Existenz und Namen erhalten hat, wird dieser Name zum Losungswort im Kampf des Dichters um persönliche und kollektive WÜrde. Der von der Qasidenform her als Schluß zu erwartende Selbstpreis kulminiert in einer furchtlosen Selbstbehauptung des Dichters, der voll auf die Macht des Wortes und die Waffe des Gedichts vertraut. Schwert und Schreibfeder sind – 1966 – noch vereint.
Exodus als Auszug in die Freiheit
Vier Jahre später verläßt Darwish Haifa und schließt sich der arabischen intellektuellen Elite in Beirut an, wo sich auch der inzwischen aufgeflammte palästinensische Widerstand konzentriert. Die nun in der Öffentlichkeit und den Medien omnipräsente Figur des fida’i wurde zu der neuen Heldenfigur, auf die sich alle Hoffnung richtete. Der fida’i, wörtlich: „der opferbereite Kämpfer“, bzw. der gefallene Kämpfer (shahid, Märtyrer), gewinnt bei Darwish eine gegenüber früherer Heldendichtung neue Dimension: er erscheint nicht nur als heroischer Kämpfer, sondern gleichsam als Erlöser aus der Gefangenschaft, der durch den symbolischen Akt des Selbstopfers sein Volk in die Freiheit führt, ohne selbst daran teilzuhaben – wie der biblische Mose, der die Israeliten im Exodus zurück ins Gelobte Land führt, selbst aber stirbt, ohne das Land zu betreten.
Dabei bleibt der fida’i natürlich arabisch, er besetzt eine alte poetologische Rolle neu: Darwish überträgt ihm die vorher vom Dichter selbst beanspruchte Rolle des wahren, leidenschaftlichen Liebenden der ghazal-Dichtung, des `ashiq, und macht ihm zum einzig legitimen Partner der Heimat, mehr noch, zu ihrem Bräutigam, ’aris, der durch das Erleiden eines gewaltsamen Todes eine mythische Märtyrer-Hochzeit, ’urs al-shahid, mit ihr vollzieht.
Auf den ersten Blick eine Mythenstiftung in nationalem arabischen Interesse – und doch auch ein Nachvollzug des großen biblischen Vorbilds, des Exodus. Denn mit seinem Selbstopfer kann der Märtyrer für einen Moment die Geschichte wenden, den Ausgang des Exodus gewissermaßen vorwegnehmen: Im Tod „kehrt er zurück“ in die Heimat: „Deine Brautnacht verbrachtest du auf den roten Dächern Haifas“, heißt es in einem Märtyrer-Gedicht von 1977. Der Tod des Kämpfers ist dabei nicht nur für ihn selbst, sondern auch für die von der Dichtung geschaffene Märtyrergemeinschaft, ein Schritt auf dem Weg ins Gelobte Land. Und noch mehr: wie der Exodus schon innerbiblisch das Gebot zu seiner eigenen Kommemoration, zum Gedächtnis, zikkaron, enthält, das im jüdischen Pessach-Ritus auch alljährlich re-inszeniert wird, so wird auch in der palästinensischen Rezeption der Tod des Kämpfers in einem von der Dichtung geprägten Ritual, einer imaginierten Hochzeit des Helden mit dem Land, zelebriert – hier wie dort ein Ritual, das kollektive Erinnerung neu belebt. Die Erkenntnis der Zentralität der jüdischen Erinnerung, zikkaron, für die Kohärenz der Gesellschaft und ihre Übersetzung in arabische Erinnerung, mit dem verwandten dhakira bezeichnet, provoziert einen neuen, arabischen Erinnerungs-Diskurs. In dieser Diskurs-Stiftung liegt eine der vielleicht bedeutendsten intellektuellen Leistungen Darwishs, dessen Dichtung – wenn man den Gedanken einmal weiter verfolgen will- auf palästinensischer Seite für all das einsteht, was Holocaust-Gedenkfeiern und Holocaust-Museen auf jüdischer Seite leisten.
Die von Darwish gestaltete palästinensische Mnemotechnik, die die tödliche Wunde des Kämpfers, nicht etwa seinen individuellen Namen, zum Erinnerungszeichen erhebt, wirft Fragen auf: Läßt sich Erinnerung an Verlorenes nicht viel sicherer als durch die ans Masochistische grenzende ständige Reaktivierung des Leidens durch Konkretes bannen: durch zeitliche und örtliche Fixierung des Verlusts, durch Benennung des Verlorenen und eventuell seine bleibende, vielleicht sogar monumentale Einprägung in eine zu beschreibende Oberfläche? Das eben ist die Praxis der anderen Gesellschaft im Land, deren Erinnerung, gepflegt in einer nie unterbrochenen, durch Schrift geprägten Tradition, ihnen durch die Geschichte die Verbindung zu ihrem mythischen Ursprungsland aufrechtzuerhalten half. Es ist diese auf eine feierliche Nennung von individuellen Toten und konkreten Verlustereignissen zu ihrer Einordnung in die Leidensgeschichte des Volkes rekurrierende Formensprache der Erinnerung, die auch moderne Zeremonien nationaler Trauer in Israel beherrscht. Eine solche Pflege der Erinnerung liegt der majoritär ländlichen, von Schriftkultur lange Zeit wenig berührten arabischen Bevölkerung Palästinas gänzlich fern. Der sunnitische Islam hat keine der jüdischen vergleichbare liturgische Formensprache für die Bewahrung von Leidenserinnerung entwickelt; für die Bewahrung kollektiver Erinnerung in Zeiten ihrer Bedrohung hatte man die Formensprache außerhalb der offiziellen Religion zu suchen. Man fand sie in der mündlichen Tradition heroischen Kämpfertums und in den seit jeher geübten sozialen Ritualen der dörflichen Gesellschaft, die dem Zusammenhalt der Sippen gültigen Ausdruck verliehen: in den Hochzeitsriten. In Darwishs dichterischer Übersetzung verbinden sich beide zu einem neuen Mythos: der Vereinigung des Kämpfers mit dem Land, der – vergleichbar einem die Genealogie fortführenden Bräutigam – mit dem Akt der freiwilligen Aufopferung des eigenen Lebens eine gesellschaftserhaltende heroische Erinnerung Über den Einschnitt der nationalen Katastrophe hinweg stiftet. Der Schrift- und Namen-orientierten jüdischen Erinnerung wird damit ein rituell kodiertes Zeichen entgegengesetzt: die blutende Wunde, die über das betroffene Individuum hinaus auf den kollektiven Körper der durch den Unrechtszustand „verwundeten“ palästinensischen Gesellschaft verweist. Das Verdikt masochistischer Selbstzerstörung geht hier fehl, denn die bereits in der islamischen Mystik getroffene Deutung von Märtyrertum als einer Form der Selbstermächtigung verleiht dem Opfergang des Kämpfers die triumphale Aura eines Weges hinaus in die Freiheit, eines für den Moment erreichten Exodus.
Ein weit verbreitetes Gedicht – auf einen im Exil zu Tode gekommenen Kämpfer von 1972 – mit dem Titel „’A’id ila Yafa“, „Zurückgekehrt nach Jaffa“, stellt den Tod des Kämpfers als eine Hochzeit mit der Konnotation eines religiösen Erlösungswerks dar: Beides, der zentrale Ritus palästinensischer Erinnerungskultur und die Urszene kollektiver jüdischer Erinnerungsstiftung, Exodus, werden zusammen re-inszeniert. Mit seinem „Fortziehen“ khuruj – das arabische Wort dient auch zur Bezeichnung des biblischen Buches Exodus – tritt der Kämpfer in die Fußstapfen Moses:
Er zieht jetzt fort von uns
Und wird einnehmen Jaffa
Und wird sie erkennen Stein für Stein
Hier gleicht ihm niemand
Nur die Lieder tun es ihm nach.
Sie preisen seine grüne Wiederkehr.
Die messianische Konnotation wird weiter deutlich, wenn dem Helden die Kraft zur Umkehrung der Realität zugesprochen wird:
Jetzt bietet er dar das Bild seiner wahren Gestalt,
Da der Lebensbaum sprießt aus dem Galgen hervor.
Jetzt bietet er dar sein wahres Geschick,
Da die Brände sich breiten auf dem Weiß der Lilie.
Jetzt zieht er fort von uns
Und wird einnehmen Jaffa.
Doch der „palästinensische Exodus“ ist – wie Darwish nicht verhehlen kann – gefährdet. Denn der Held hat – nicht anders als Mose – mit einem Volk zu tun, daß der Rigorosität seines Anspruchs nicht standhält, ein Volk, das Idolatrie betreibt, indem es „der wahren Gestalt“ und „dem wahren Geschick“ des Kämpfers ein Idol, einen verlogenen Umgang mit der kollektiven Erinnerung entgegensetzt. Die Gegenstrophe zu dem Gedichtanfang kontrastiert das eingangs evozierte „wahre Bild“ mit dem „falschen Bild“, dem Idol:
Wir sind so fern von ihm,
Da Jaffa nichts ist als vereinzelte Koffer,
Am Flugplatz vergessen,
Wir sind so fern von ihm
Da unsere Bilder nichts sind als Erinnerungsfotos
In den Taschen von Frauen,
Und wir auf den Seiten der Zeitungen
Darbieten täglich unsere Geschicke,
Nur zu gewinnen die Locke des Windes und Küsse aus Feuer.
Wir sind so fern von ihm,
Wir treiben ihn an, in den Tod sich zu stürzen
Und schreiben geschliffene Worte des Nachrufs auf ihn
Und moderne Gedichte.
Und gehn abzuwerfen die Traurigkeit draußen im Straßencafe.
Wir sind so fern von ihm,
Auf seinem Begräbnis umarmen wir selbst seinen Mörder
Und stehlen uns von seiner Wunde die Binde, zu putzen
Die Orden für Ausdauer und langes Warten.
Blut und Tinte fließen in einem verhängnisvollen Zirkel zusammen: der Dichter selbst schreibt – für den Druck vorgesehene – „moderne Gedichte“ über das Blut des Märtyrers, dessen Tod so zu einem Teil des politisch-journalistischen Tagesgeschäfts wird. Die Gefährdung des Ideals durch Surrogate, Idole – auch das ist eine biblische Erfahrung. Die Gedichte der folgenden zehn Jahre, bis 1982, sind ein Seiltanz zwischen der Treue zum selbst mit-geschaffenen Mythos und den tagespolitischen Zwängen.
Exodus ohne Gelobtes Land
Das Bild des Exodus als emblematische Repräsentation des palästinensischen Aufbruchs blieb auch gültig, als mit dem Scheitern der revolutionären Bewegung und der Vertreibung der Palästinenser aus Beirut 1982 in das abgelegene Tunis die Figur des Kämpfers von der Bühne abtrat, als sich der „Auszug in die Freiheit“ als ein „nie endender Weg“, ein „permanent gewordener Exodus“ abzeichnete, bei dem jegliche „Landnahme“ aus dem Horizont geschwunden war.
Damit kehrt sich der vorher triumphal eingesetzte Subtext in sein Gegenteil: Unter dem resignativen Aspekt der nie endenden Wanderschaft, wird der Exodus zum Bild für die unvollendete Nationwerdung der Palästinenser. In dem Gedicht von 1986 „Wir lieben das Leben“ geht Darwish so weit, das Leben selbst, das einfache Überleben, zum Gelobten Land, oder islamisch gewendet, zur Kaaba zu erklären. Darwish nutzt hier eine jedem arabischen Hörer geläufige Referenz auf die dem Gläubigen obliegende Wallfahrt zur Kaaba, er zitiert im Refrain die koranische Formel zur Einschränkung des Wallfahrtsgebots (Sure 3:97), nämlich auf „diejenigen, die fähig sind, hinzugelangen“ (Gott hat den Menschen die Pilgerfahrt zum Gotteshaus auferlegt, denjenigen, die fähig sind, hinzugelangen). Darwishs Refrain lautet:
Ja, wir lieben das Leben, wenn wir nur fähig sind hinzugelangen.
Das Gedicht verfolgt die Wanderschaft der Palästinenser unter Umkehrung der aus der Bibel bekannten lebenspendenden göttlichen Gunstbeweise, Manna und Wachteln, an ihre Stelle treten drastische Erfahrungen vergeblicher Bemühung um Selbsterhaltung:
Wir säen, wo immer wir lagern, schnell wachsende Pflanzen
Und ernten, wo immer wir ernten, nur Tote, Gefallne.
Wir geben der Flöte ein das Lied immer fernerer Fernen
und malen in den Sand des Wegs unsere zitternde Sehnsucht.
Ja, wir lieben das Leben, wenn wir nur fähig sind hinzugelangen.
Noch drastischer wird der triumphale Exodus subvertiert in dem aus derselben Zeit stammenden Gedicht: „Die Erde engt uns ein“, das endet:
Wohin gehn wir nach Überschreitung der letzten Grenze?
Wohin fliegen die Vögel nach Erreichung des letzten Himmels?
Wo schlafen die Pflanzen nach dem Schwinden des letzten Lufthauchs?
Wir werden unsere Namen schreiben mit rot gefärbtem Rauch.
Abschneiden werden wir die Hand dem Lied – soll unser Fleisch es zuende bringen.
Hier werden wir sterben, hier im letzten Durchgang.
Hier oder hier wird pflanzen seinen Ölbaum unser Blut.
Die Wanderung, die zu keiner Landnahme führt, die sogar Exterritorialität mit dem völligen Verschwinden des Raumes auf die Spitze treibt, mag als ein palästinensisches Zerrbild des – den anderen bereits geglückten – Exodus in das verheißene Land erscheinen. Es ist dennoch mit seiner biblischen Schlußmetapher, dem Friedenszeichen des Ölbaums, ein unüberhörbarer Appell an diese anderen, die palästinensische Unglücksgeschichte als dunkle Seite der eigenen Erfolgsgeschichte in ihrer Tragik wahrzunehmen.
Darwish im Gespräch mit Aragon und Celan
Darwish hat aber nicht nur Geschichte, sondern auch die Geschichte seiner eigenen Schöpfungsakte reflektiert – auch den im Pariser Exil vollzogenen unübersehbaren Bruch in dieser Geschichte. Er tut das, indem er seine Subtexte, seine literarischen Referenzen, ans Licht holt: Zur Erklärung seiner Hinwendung zu einem neuen biblischen Buch, dem lyrischerotischen Hohen Lied, legt er zunächst sein wechselhaftes Verhältnis zum „arabischen Hohen Lied“, dem Mythos von Majnun Layla, offen.
Die Geschichte von dem sich in unstillbarer Sehnsucht nach seiner Geliebten Layla verzehrenden Dichter Qays, wegen seiner Obsession auch Majnun Layla, d.h. „der von Layla Besessene“ genannt, ist omnipräsent in den nahöstlichen Literaturen – es hat vor allem die bedeutendste arabische Poesie-Gattung der Vormoderne, das ghazal-Liebesgedicht entscheidend geprägt. Majnuns Sehnsucht nach dem Wiedervereintwerden mit seinem Ideal ist im modernen ghazal ins Politische gewendet worden, das Liebesgedicht ist seit den fünfziger Jahren nicht nur in der arabischen, sondern auch in der weiteren islamisch geprägten Welt eine Hommage des Dichters an seine mythisierte verlorene Heimat.
1999 hat Darwish seinen eigenen Anteil an dieser poetologischen Entwicklung einer rigorosen Revision unterzogen. Im Rückblick auf seine „poetische Jugend“ nennt er seine frühere Identität als ’Ashiq min Filastin, als „Liebender aus Palästina“, eine temporäre poetische Rolle, die er in einer noch unausgereiften Phase gespielt habe, in einer gleichsam ekstatischen Situation, aus der heraus er erst durch eine Schock-Erfahrung wieder zur Nüchternheit gefunden habe. Das „autobiographische Gedicht“, „Eine Maske von Majnun Layla“, zeigt ihn zunächst in der Rolle des altarabischen Dichters Qays, dem von Layla Besessenen, Majnun Layla, läßt ihn dann aber – offenbar von Celans Dichtung angestoßenentscheidende Rollenwechsel durchmachen:
Eine Maske von Majnun Layla
Ich fand eine Maske, und es gefiel mir,
Ein anderer zu werden. Ich war
Jünger als Dreißig, überzeugt, die Grenzen
Der Existenz bestünden aus Worten. Ich war
Krank nach Layla wie jeder junge Mann,
In dessen Blut ein Körnchen Salz ist. Selbst wo sie
Nicht wirklich da war, lag das Bild
Ihrer Seele in allen Dingen. Sie bringt mich
Der Umlaufbahn der Sterne nah. Sie entfremdet mich
Meinem Leben auf der Erde…
Der Fluß heilte mich, als ich mich
In ihn warf, um mich zu töten,
Und einer, der vorüberkam, mich rettete.
Ich fragte: Weshalb hast du mir die Atemluft zurückgegeben
Und meinen Tod gedehnt? Er sagte: Damit du dich
Besser kennenlernst… wer bist du?
Ich sagte: ich bin Laylas Qays, und wer bist du?
Ich bin ihr Ehemann.
Wir gingen zusammen durch die Gassen Granadas
Und entsannen uns unserer Tage am Golf.
(Übersetzt von Stefan Weidner)
Seine Obsession für das Ideal, sein Weltverlust, hätte den Dichter zur Selbstauslöschung treiben können, wie Paul Celan, den großen jüdischen Exildichter, der 1970 in der Seine Selbstmord beging. Es ist die Person Celans, in die Darwish hier für einen Moment biographisch eintritt, um aus demselben Fluß existentiell verändert ins Leben zurückzukehren: nicht mehr jedoch als der arabische Majnun, sondern in der Rolle einer westlichen literarischen Verkörperung. Es ist die Rolle von Louis Aragons altem abgeklärten Dichter Medjnoun, der nach dem Fall von Andalusien meditierend durch die Gassen Granadas steift, den Ort arabischen Exils par excellence. Aragons Medjnoun ersehnt Layla, die bei ihm Eisa heißt, nicht mehr als Wiederherstellung einer verlorenen Wirklichkeit, sondern erwartet sie als geschichtliche Utopie einer universalen idealen Zukunft. Indem Darwishs persona Majnun in diese abgeklärte Rolle eintritt, kann er seinen früheren Rivalen als Gefährten, ja als Teil seines Ich erkennen und mit ihm gemeinsam Formen des Exils ins Gedächtnis rufen, nicht nur den Prototyp arabischen Exils, den Verlust Andalusiens, dessen Enddatum 1492, der Fall Granadas, zugleich jüdische Exilierung in Erinnerung ruft. Beide zusammen gedenken auch des Exils des Pioniers der Modernen Dichtung überhaupt, Badr Shakir al-Sayyab, dessen berühmtes, den persischen Golf beschwörendes Gedicht „Unshudat al-matar“ („Die Regenhymne“) hier evoziert wird.
Der einstige Majnun Layla gibt damit seine nostalgische Haltung auf und stellt sich in die Reihe moderner, westlicher und arabischer Exildichter, Paul Celan, Louis Aragon und Badr Shakir al-Sayyab, bei denen Exil nicht territoriale Exklusion, sondern existentielle Entfremdung ist, eine conditio humana, die so weit gehen kann, daß die Figur des Dichters selbst infrage gestellt wird. Wohl kein zweiter Vers Darwishs formuliert – in der Sicht von Stefan Milich – „so radikal wie der letzte von ,Qays’ gesprochene die völlige Aufgabe der modernen Subjekthaltung, der essentialistisch und monolitisch verstandenen Identität, und setzt an seine Stelle ein Selbstbewußtsein, das nicht mehr Dichter, sondern nur noch Dichtung sein will“.
Ich bin Laylas Qays,
Fremd meinem Namen und meiner Zeit (…)
Ich bin der erste Verlierer, ich bin der letzte Träumer, der Sklave der Ferne.
Ich bin ein Geschöpf, das nicht gewesen. Ich bin ein Gedanke
Für ein Gedicht
Von Layla zu Shulamith: ein jüdisch-arabisches Hohes Lied
Die Liebesklage um die palästinensische Layla, die poetische Wiedererschaffung der Figur „Palästina“, liegt nun, 1999, über dreißig Jahre zurück. Mit dem Zurückweichen der mythischen Layla tritt die Erinnerung der ersten wirklichen Geliebten wieder klarer hervor. Mahmud Darwish nennt die israelische junge Frau, mit der er noch in Haifa ein Liebesverhältnis hatte, „Rita“, manchmal auch „Shulamit“. Sie ist die zentrale Figur mehrerer vor 1970 entstandener Gedichte, die die Liebe des israelisch-arabischen Paares als „unmöglich zu leben“ beschreiben. Sie taucht wieder auf in seinem Kriegsmemoir Ein Gedächtnis für das Vergessen, wo er in der apokalyptischen Situation der Bombardierung Beiruts 1982 in seinen Tagträumen Telefongespräche mit ihr führt. Die ausführlichste Version der Liebesgeschichte mit Rita ist das Langgedicht „Ritas langer Winter“ von 1992 – bei näherem Hinsehen nichts anderes als eine Art Übersetzung des biblischen Hohen Liedes in die Realität des palästinensisch-israelischen Liebespaares, dem wie das biblische Paar die Erfüllung verwehrt wird, nicht von altorientalischen Wächtern der Stadt, sondern von einer mächtigen modernen Ideologie. Spannung besteht nicht wie im Hohen Lied zwischen weiblichem Begehren und patriarchalischen Zwängen, sondern zwischen der Liebe des Paares und politischen Widrigkeiten. Die Sprache ist ähnlich reich wie der Vorbildtext an eindrucksvollen Körpermetaphern aus dem Bereich von Fauna und Flora. Ritas Brüste sind Vögel, sie selbst ist eine Gazelle. Der Liebende ist wie die Geliebte Teil der lokalen Natur: er fühlt die Nadeln der Zypresse unter seiner Haut, beiden ist es, als schwärmten Bienen in ihren Adern, sie verbreitet den Duft von Jasmin; sie streut Anemonen über ihn, so daß er unter den Schwertern ihrer Brüder hindurchgehen kann, sie überlistet die Wächter der Stadt. Wie im Hohen Lied erlebt auch im Gedicht der Liebende, daß die Geliebte auf der Schwelle zur Erfüllung entschwindet. Aber die aus dem Hohen Lied bekannten Wächter bedrängen nicht sie, sondern ihn, indem sie ihm seinen Raum verstellen und ihn von der Geliebten trennen. – Doch kann sich der Dichter aus der realen in eine textuelle Welt flüchten. Er selbst weiß, daß er kanonische Texte „umschreibt“, hebräische wie arabische: Er hat „Teil am Buch Genesis, […] Teil am Buch Hiob, […] Teil an den Anemonen der Wadis in den Gedichten der früharabischen Liebenden, Teil an der Weisheit der Liebenden, die verlangt, daß der Liebende das Antlitz der Geliebten liebe, auch wenn er von ihr getötet wird“. – Ein Epilog enthüllt das Auseinanderbrechen der Beziehung – ihre Pistole liegt auf der Niederschrift seines Gedichts – und seinen erzwungenen Gang ins Exil.
Es bedurfte aber noch der – in dem Maskengedicht dokumentierten – Begegnung mit Paul Celan, um Rita aus der nostalgischen Erinnerung in das dichterische Ich selbst hineinzuholen. Erst in dem sieben Jahre späteren – um einen Celan-Vers herum geschriebenen – Gedicht von 1999 „Eine Wolke aus Sodom“ wird Rita zu dem, was sie für die weitere Dichtung Darwishs bleiben wird. In seinen eigenen Worten: „eine intensivpräsente Abwesenheit“.
EINE WOLKE AUS SODOM
Nach deiner Nacht, der letzten Winternacht
Verließen die Wachen die Straße am Meer.
Kein Schatten folgt mir, seit deine Nacht
In der Sonne meines Lieds vertrocknete. Wer sagt mir jetzt:
Verabschiede dich vom Gestern und träume
Mit der ganzen Freiheit deines Unbewußten.
Meine Freiheit sitzt nun auf meinen Knien
Wie eine zahme Katze (…).
Was macht meine Freiheit nach deiner Nacht, der letzten Winternacht?
„Eine Wolke zog von Sodom nach Babel“,
Vor hundert Jahren, doch ihr Dichter Paul
Celan brachte sich um, heute, in der Seine. Du wirst mich
Kein zweites Mal zum Fluß mitnehmen. Kein Wächter
Wird mich fragen, wie ich heute heiße. (…)
Wer bin ich? Wer bin ich, nach deiner Nacht, der letzten Winternacht?
(Übersetzt von Stefan Weidner)
Obwohl das Szenario des Hohen Liedes aus „Ritas langer Winter“ von der weiblichen Figur verlassen scheint, ist Rita präsent, sie ist – mit Elias Khoury gesprochen – in das nun in ein Du-Ich gespaltene dichterische Selbst eingegangen. Die Trennung der Liebenden kann nicht mehr wie vorher einfach durch den Rückzug des Dichters ins Unbewußte, in seine dichterische Kreativität, aufgehoben werden. Mit dem Eintritt des Dichters in das endgültige Exil und dem Eintritt des Fremden, das vorher in der „fremden Geliebten“ verkörpert war, in seine eigene Identität, muß er sich jetzt selbst jene Fragen stellen, die früher von den Wächtern und Soldaten an ihn gerichtet wurden. „Wer bin ich nach deiner Nacht, der letzten Winternacht ?“
Die im Gedichttitel „Eine Wolke aus Sodom“ ausgesprochene Evokation des infernalen Sodom aus dem frühen Rita-Gedicht „Eine schöne Frau aus Sodom“ von 1970 führt zurück zu der Situation, wo Darwish im Begriff war, sein Inferno Sodom in Richtung Exil, Babylon, zu verlassen. Doch sind Sodom und Babylon – wie Stephan Milich zuerst erkannt hat – inzwischen mit der Erfahrung des Exildichters par excellence, Paul Celan, besetzt, dessen Vers aus dem Gedicht „Mohn und Gedächtnis“ aus dem Jahr 1952 („Von Aug’ zu Aug’ zieht die Wolke / wie Sodom nach Babel“)? Darwish neu formuliert. Jüdische Exilerfahrung wird als arabische reklamiert. – Um dies zu legitimieren, greift Darwish zu einem Kunstgriff, er überspringt in seiner Reflektion der Stationen seiner dichterischen Kreativität – historisch gesprochen – die lange Phase seiner mythenschaffenden Dichtung im Beiruter Exil, als er nur „temporär exiliert“ war und noch auf eine Rückkehr hoffte. Er datiert sein – erst später erreichtes – Exilbewußtsein als existentielle Kondition gewissermaßen zeitlich zurück, um die Wahrnehmung seiner Existenz in einem „Land aus Worten“ mit derjenigen Paul Celans synchronisieren zu können, der sich 1970, dem Jahr, in dem Darwish ins Exil ging, das Leben nahm. Darwish geht – so könnte man die kühne Referenz deuten – den Exilweg Celans auf weite Strecken mit, doch führt ihn dieser Weg an entscheidender Stelle zum Bruch nicht mit der Welt, sondern mit seiner arabisch dominierten Textwelt. Sein Gedicht „Wer bin ich ohne Exil?“ aus der gleichen Sammlung Sarir al-ghariba, „Das Bett der Fremden“, 1999, macht den Gedanken der Celanschen Erbfolge fast explizit:
Ein Fremder am Ufer des Flußes, wie der Fluß… Das Wasser
Bindet mich an deinen Namen. Nichts bringt mich aus meiner Ferne zurück
Zu meiner Palme. Kein Frieden, kein Krieg. Nichts…
(Übersetzt von Stefan Weidner)
Darwish wird mit der europäischen Exildichtung, etwa Aragons, aber besonders mit dem Werk Celans, ein zweites Leben zuteil. Der palästinensische Dichter Darwish wird zum „Nachdichter“ des jüdischen – wie Celan hat er eine nicht mehr territoriale, eine Exil-Heimat in der Sprache, „ein Land aus Worten“, baladun min kalam, erschaffen.
Zum Schluß
Mahmud Darwish ist – über viele Stationen, von denen wir einige passieren konnten – von einem mythenschaffenden politischen Dichter, dem Schöpfer einer Genesis-Geschichte und eines Exodus-Dramas für seine Heimat Palästina, zum Entdecker eines weiträumigen ästhetischen Altneulands geworden: zum Wiederentdecker der Bibel als des großen regionalen Subtextes, der ein tieferes, nämlich allegorisches Verständnis von Geschichte ermöglicht. Die Bibel erweist sich für ihn als ein Archiv von Präfigurationen, von „Typen“ zeitgenössischer Ereignisse und Erfahrungen. Oder umgekehrt: als Brennglas, durch das hindurch die Gegenwart erst in ihrer doppelten Sinndimension erfahren werden kann: lil-haqiqa wajhan: „die Realität hat zwei Gesichter“. So wird die jüdische Erfahrung des Exodus von den Palästinensern in ihrem Befreiungskampf zuerst nachgelebt, dann nach dem Verlust ihrer Ziele nachgelitten – aber erst der biblische Referenztext, der die ontologische Notwendigkeit des Exodus für die Volkswerdung attestiert, macht die volle Tragweite des palästinensischen – letztendlich arretierten – Exodus voll erkennbar und in ihrer Tragik, als Vexierbild des geglückten Exodus der anderen, diesen anderen kommunizierbar. Und erst das Hohe Lied eröffnet die Reflektion über das poetische Ich in seiner untrennbaren Verbindung zum Du des anderen als einer „intensiv-präsenten Abwesenheit“. Lange ersehnte und nostalgisch erinnerte Territorialität hat bei Darwish einer Celanschen „Landkarte der Abwesenheit“ Platz gemacht: Celans Texte werden durch Darwishs Einschreibung von jüdischen Exilgedichten zu jüdisch-palästinensichen Palimpsesten. So auch Celans Gedicht aus dem Jahr 1954:
Nun aber schrumpft der Ort, wo du stehst:
Dünner wirst du, unkenntlicher, feiner!
Feiner: ein Faden, an dem er herabwill, der Stern:
um unten zu schwimmen,
unten, wo er sich schimmern sieht,
in der Dünung wandernder Wortes
Darwish antwortet Celan in seinem Gedicht „Am letzten Abend auf dieser Erde“, aus dem Jahr 1992, in dem er arabisches und jüdisches Exil gleichermaßen in einem Land aus Worten aufhebt:
Am Ende werden wir uns fragen, war Andalusien
Hier oder dort? Auf der Erde […] oder im Gedicht?
Angelika Neuwirth, Akzente. Zeitschrift für Literatur, Heft 5, Oktober 2009
Fakten und Vermutungen zum Übersetzer
Fakten und Vermutungen zum Autor + IMDb
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Galerie Foto Gezett
shi 詩 yan 言 kou 口
Nachrufe auf Mahmoud Darwish: Quantara ✝ FAZ ✝ Der Spiegel ✝
die taz ✝ The Economist
Mahmoud Darwish – Algerie 1983 ( Eloge de l’ombre).

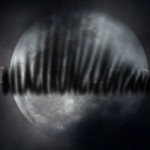








Schreibe einen Kommentar