Michael Hamburger: Poesiealbum 329
REMYTHOGRAPHIE V
Was ist alt, was neu? Erfindend schreibe ichs nochmal,
Suchend und findend wiederhole ichs.
Wandernd über Reste von Heide an der See,
Die todbringend nennen, die das Wasser verschmähn,
Das durch Vergessen an eine andere Küste reicht,
Könnt ich vergessensvoll eine versteckte Kreuzotter
aaaaaaufscheuchen
Dann, im regulierten Wald, auf ordentlichem Weg
Eine, die sich da stille sonnt, stocksteif
Wie eine Schlange um des Lebens willen
Und, dazu, bedroht zuschnappen muß.
Im selben Dämmer oder zurück im Mittagsglanz
Könnte irgendwo ein verwandeltes mutiertes Monster
Meiner menschlichen Orientierung verlustig
In ein Labyrinth geraten, ohne Pfad und Ausgang,
Im Zickzack, im Kreis und „ohne Heimweg“
Panisch reagieren –
Welch Grozny auch der Geist der Zeit erbricht –
Am schrecklichsten, wenn nur ein bloßer Geist,
Dessen Schlauheit, dessen Unglauben Skepsis plagt.
Und dort, am Rand der See, und unverletzt
Könnt es im Trockenen hilflos ertrinken.
Stimmen zum Autor
Die Gedichte Michael Hamburgers gehören zur europäischen Weltliteratur. Das „Ungewisse“ ist Hamburgers wahre Stärke; gut wird er dann, wenn er sein Tasten und Suchen in einen „mäandernden Satz“ packt.
Benedikt Erenz
Mit seinem Tod nimmt die englische Sprache Abschied von einem ihrer begabtesten und einflußreichsten Dichter des 20. Jahrhunderts.
Iain Galbraith
Nicht auszudenken, welch ein deutscher Dichter Michael Hamburger geworden wäre… Er schuf einen singulären Ton aus dem Besten zweier Kulturen.
Thomas Poiss
Gegen den abfälligen Begriff des Naturlyrikers hat sich Hamburger schon immer gewehrt. Er schöpft, wenn er seine Gedichte schreibt, nicht aus einer verklärten Weltsicht, sondern aus genauen Beobachtungen und Erfahrungen. Die ausgeprägte Sprachskepsis Hamburgers merkt man seinen Gedichten an. Die Worte werden um die Dinge gelegt, um sie wie eine schützende Hülle zu transportieren.
Cornelia Jentzsch
Hamburger ist der feinsinnige, spürsame Beobachter von Wandel und Veränderungen, die sich mal schleichend, mal mit abrupter Wucht vollziehen. Seine hohe Kunst besteht darin, das Alltägliche und Altbekannte neu und anders zu sehen und den Dingen im unmittelbaren Gesichtskreis abgestuftere Tönungen zu verleihen. Seine Gedichte wirken vor allem durch ihre stille, beharrliche Kraft, sie sind zugleich frisch und altersweise, tiefernst und von heiterer Lust, nachdenklich und alle Abstraktionen meidend.
Jürgen Brôcan
Poesiealbum 329
Michael Hamburger, geboren in Spreeathen, mit neun Jahren ins Wasser der Themse geworfen, erlernte schnell die Landessprache und erlangte – eingebunden in Schule, Armee, sowie Universität – eine britische Identität und konnte so zum englischen Dichter werden. Seine deutschen Wurzeln waren noch stark genug, um auch als Übersetzer und Kulturvermittler zu wirken – ein Glücksfall für die beiderseitige Literatur.
MärkischerVerlag Wilhelmshorst, Klappentext, 2017
Michael Hamburger
Obwohl in Spreeathen geboren, wurde Hamburger kein Berliner. Seine hitlerfliehende Familie rettete mit der Emigration nach England auch sein Kinderleben. Der Oxfordstudent diente in der Britischen Armee und lehrte an englischen und amerikanischen Universitäten. Parallel dazu wurde er ein bedeutender Dichter und Übersetzer deutschsprachiger Dichtung, der seinerseits namhafte Autoren zu Freunden und Dolmetschern seiner naturbehausten Erinnerungsdichtung zählt.
Richard Pietraß, in Eugen Roth: Poesiealbum 328, MärkischerVerlag Wilhelmshorst, 2017
Am Boden beflügelt
Sein Garten, seine Apfelbäume im britischen Suffolk waren Legende. Da lebte ein hochgelehrter Mensch – Berliner, Jude, frühzeitig deutscher Exilant, dann britischer Soldat gegen Hitler – am Schnittpunkt von natürlicher Wildnis und pflegerischem Amt. Da genoss ein Feinsinniger das Unkraut wie die Urbarmachung. Da lobte ein Poet der unmittelbaren und geheiligten Praxis den Wuchs und die Wartung, liebte die Lichtgeilheit sämtlicher Triebe und deren Zähmung durch Pflanzung, Zucht und Ernte. Nichts ist schöner als Natur, nichts ist anstrengender als Natur, nichts ist grausamer als Natur: Das Mickrige wird beseitigt. Und zwar vom Gärtner oder von den üppig sich ausbreitenden Lichträubern aus Laub – die in der Wildnis die Mehrheit bilden. Wer Natur als Gleichnis bemüht, sollte also vorsichtig sein.
Diesem großartigen Dichter Michael Hamburger (1924–2007) ist nun ein Poesiealbum gewidmet. Sein Werk, im Deutschen beheimatet bei Hanser und Folio, ist umkreisend und bedenkend, seine Gedichte erzählen – an der Grenze zur Prosa. Sie verzittern sich leidenschaftlich leise in Wurzelnähe zur Philosophie. Und in Lufthöhe zur Illusion – davon, was möglich wäre:
Dass wir nicht abermals behaupten,
Was zu wissen wir vorgeben
Was zu benötigen wir vorgeben
Was wir vorgeben zu sein,
Die wir die Sprungfedern der Freude
Mit Verschwendung schmieren und Gier
In diesen Versen kommen Taube, Biene, Azurjungfer, Schwalbenschwanz, Nachtfalter, Tagfalter, Grüngestrichelter Brombeerfalter, Wintergeißblatt vor. Das sind nahezu prosaische Namen – und zugleich sind es Schlüsselworte, um zwei Räume, einen bekannten und einen unbekannten, zusammenzuschließen. Hamburger will wissen – und stößt auf die Unergründlichkeit. Er stößt also auf das, was Menschen, die tagtäglich mit Welterklärung beschäftigt sind, sichtlich überfordert. Ja, Erklärung, Aufklärung sind zu einem Reflexverhalten geworden, dem die Glaubwürdigkeit abhanden kam, auch wenn aus den Verlautbarungen von Kommentatoren, Ideologen, Analytikern noch immer, hie und da, Viertelwahrheiten entweichen. Eher: verpuffen. Hamburgers Gedichte – etwa über die Sicherheit, das Sterben, Metropolis, Hölderlin, Treblinka und die S-Bahn – beschwören das Dunkle und das Schwierige. Mit einer inständigen Hoffnung:
dass die Vernunft nicht noch zerstörerischer wird als die losgelassene Unvernunft.
Hamburger erscheint in diesen Versen als Dichter, der sich hoch hinaus sehnt, aber den Himmel würde er sich freilich nie leerträumen – er weiß um dessen nutzbringende Funktion für den Obstbau. Sei es Regen, sei es Sonne, sei es Schatten. Doch kaum ist er ein Bodenständiger, gewieft in Ordnung, Kategorien und Arbeitsteilung, geht ein neuer Traum an den Start:
Mög’ es Beflügelte geben, zu
Verbinden Erde, Wasser und Luft
Hans-Dieter Schütt, neues deutschland, 25.7.2017
Unterm Spiegel zerrinnt der See
Wer nach Friedrichshagen fährt, ganz im Osten Berlins, und das Haus in der Ahornallee 26 besucht, in dem das Zimmer von Johannes Bobrowski noch immer seinen einstigen Bewohner zu erwarten scheint und darüber zum Museum geworden ist, braucht zu Fuß kaum zehn Minuten bis zur Spree und zum Müggelsee, an dessen Ufer J. B. mit seinen Gästen spazieren ging. Manchen mag die Weite des Sees überrascht haben, vielleicht auch die bewaldete Erhebung des gegenüberliegenden Ufers – von den Berlinern selbstbewußt Müggelberge genannt –, deren Anblick die Stadt, die sich von rechts bis an den Augenwinkel herandrängt, vergessen macht. „Wenn einer käme, dies zu beschreiben in zwei Sätzen, der wär ein Dichter“, behauptete J. B., als forderte er seine Besucher zu einem Spiel heraus.
Zweimal war Michael Hamburger in Friedrichshagen zu Gast, das erste Mal am 3. November 1963, dann wieder, gemeinsam mit seiner Frau, am 23. Mai 1965, ein Viertel Jahr vor J. B.s Tod.
Am 21. März 64, einen Tag vor seinem 40. Geburtstag, schreibt M. H.:
Die Arbeit musste ich abbrechen – es ging einfach nicht – doch schrieb ich statt dessen mein erstes Gedicht auf Deutsch – wenn es ein Gedicht ist, ich weiss es nicht. Eigentlich gehört es zu diesem Brief. Darum schreibe ich es ab.
BEGEGNUNG
„Hier bin ich geboren –
auf der anderen Seite der Stadt,
in der gemordeten Zeit,
kann hier nicht, dort nicht wohnen,
unterwegs, ich suche den Ort.“
„Hier wohne ich –
am Ufer, schaue nach Osten
in die gemordete Zeit,
wo der weite See sich verliert,
dahinter, komme ich her.“
Und doch, hier stehn wir zusammen,
das Wasser ruht, unsere Blicke
treffen es, ruhen sich aus,
auf keiner Seite der Stadt,
in wieder lebender Zeit.
Vor dem Erstdruck mit der Widmung „für J. B.“ änderte M. H. die letzte Zeile zu: „in einer lebenden Zeit.“ J. B. nennt es „ganz ein Michael-Gedicht“, „wie Sie dastehn, sprechen, wie wir Sie vor Augen haben, wenn wir, oft, von Ihnen reden.“
M. H., 1924 in Berlin, in der Lietzenburger Straße, wenige Schritte vom Kurfürstendamm entfernt, geboren, emigrierte 1933 mit seiner Familie nach Großbritannien. Die Großmutter blieb und wurde ermordet. Der eigentliche Ort seiner Kindheit aber waren Haus und Garten der Großeltern in Kladow, ganz im Westen Berlins, am Ufer der Havel und des Wannsees. In seiner Autobiographie Verlorener Einsatz beschreibt M. H. die Begegnung mit einem gleichaltrigen Mädchen.
Wir haben uns wohl beim Schwimmen im See getroffen. Oberhalb vom Gemüsegarten meines Großvaters bauten wir uns an einer abgelegenen Stelle auf dem waldigen Hügel ein Versteck und verbrachten dort endlose Stunden inniger Zweisamkeit, die wir als Ehe betrachteten. Die gewaltsame Trennung von diesem Mädchen bedeutete mir mehr als alle anderen Verluste. Sie blieb in Deutschland, und ich habe nie wieder etwas von ihr gehört.
Die beiden großen Seen Berlins, nahezu gleichweit von Berlin-Mitte entfernt, scheinen sich spiegelbildlich aufeinander zu beziehen, so wie auch die Biographien der beiden Dichter eine gewisse Spiegelverkehrtheit aufweisen. J. B., 1917 in Tilsit (heute Sowjetsk) geboren, verbrachte seine Schulzeit in Königsberg, die Ferien im Memelland, kam nach zwölf Jahren als Soldat – die letzten vier in sowjetischer Kriegsgefangenschaft – nach Berlin, wohin seine Eltern 1938 gezogen waren. Dorthin, wo er aufgewachsen war, hätte er nicht zurückkehren können. Das Völker-, Kulturen- und Sprachengemisch, dem seine Familie entstammte und das ihn geprägt hatte, war, sofern es überhaupt noch existierte, für ihn verloren.
M. H., der als Schüler erst zu Hause hatte nachfragen müssen, ob er „Jude“ sei oder nicht, kehrte 1945 als britischer Staatsbürger und Offizier nach Berlin zurück. An ein Bleiben war nicht zu denken. Eine Folge der Emigration ist „diese verfluchte Zweisprachigkeit.“
Anfang Dezember 62 lernen sich Johannes Bobrowski und Michael Hamburger auf einer Schriftstellertagung der Evangelischen Akademie Berlin-Brandenburg kennen, der erste Brief datiert vom 1.1.63, der letzte vom 8.5.65; am 2.September 65 stirbt J. B. an den Folgen einer verschleppten Blinddarmentzündung.
Das Zwiegespräch ihrer Gedichte jedoch begann früher und wird so bald nicht enden.
Bereits im zweiten Brief bekannte M. H.:
Schon über ein halbes Jahr lang habe ich keine Gedichte geschrieben, fürchte aber diesmal kaum, daß es ganz aufhören wird – zum Teil auch, weil es mir nun weniger wichtig vorkommt, wer die Gedichte schreibt.
J. B. beschloß seine Antwort:
Der Gedanke, es sei weniger wichtig, wer die Gedichte schreibt, berührt mich sehr, ich habe ihn auch. Seit langem denke ich bei jedem Gedicht, es könnte das letzte sein, und ich denke es ohne Schmerz. Vielleicht war dies für mich das Letzte, ich leg es bei.
Die Selbstverständlichkeit, mit der sie für den Anderen, für andere überhaupt da sind, weil es weniger wichtig sei, wer die Gedichte schreibt, verbindet die beiden Dichter wie ein unterirdischer Strom, weshalb sehr schnell aus Bekanntschaft Freundschaft werden konnte. Diesen Dichtern liegt – und das ist weder tautologisch noch selbstverständlich – an der Dichtung.
Manchmal gehen die Gedichte direkt aus den Briefen hervor, stets sind sie als Dritter im Bunde anwesend.
„Wie Sie es tun, so kann man über Gedichte sprechen, über die eigenen – so ganz frei und so ganz einbezogen zugleich. Es bewegt mich immer sehr wenn Sie es tun“, schreibt J. B.
Mehr als in Briefen haben sie sich mit Gedichten verständigt und verstanden, nicht nur mit den eigenen. Hölderlin ist für beide der große Bezugspunkt, man erkennt einander an der Hochschätzung des damals bereits verstorbenen und kaum bekannten Franz Baermann Steiner. J. B. recherchiert für M. H. über Jesse Thoor, dessen Werke Hamburger herausgibt.
Geradezu eine Lektion in Kollegialität sind jene Passagen, in denen J. B. um Beurteilung der englischen Übersetzungen von Ruth und Matthew Mead bittet. M. H., der selbst, wie der gemeinsame Freund Christopher Middleton, J. B.s Gedichte übersetzt, zollt den Meads nach anfänglicher Skepsis höchstes Lob, das in dem apodiktischen Satz gipfelt.
Mead muss aber ein Dichter sein; und das ist die Hauptsache dabei.
Man erwartet die Gedichte des anderen, erbittet Proben, fragt nach, möchte Rat und berichtet von der Lektüre.
Ich kann schwer ausdrücken, wie mich diese Gedichte ergreifen – fast körperlich, so daß ich immer nur wenige Gedichte ertragen kann. (M. H.)
Man vergißt schnell die Sprachbarriere, die zwischen den beiden Werken liegt. J. B. ist bei der Lektüre von M. H.s Gedichten auf sein Schulenglisch angewiesen, glaubt aber den Ton in den Gedichten herausgefunden zu haben.
Aus Ihren Gedichten… kommt mir als erstes das Landschaftliche entgegen. Das andere kommt noch, ich merks schon, beim weiteren Lesen.
„Übrigens sollte ich wirklich Bauer werden, ursprünglich, in der Gegend, wo ich herstamme“, bekannte J. B. Als Leser glaubt man das geahnt zu haben, ein Städter könnte nicht so von der Landschaft und ihren Bewohnern und deren Vorfahren sprechen. Auf ähnliche Weise lassen M. H.s Gedichte erkennen, wie unmittelbar ihr Autor auch im Alltag Land und Natur braucht und sie kennt.
Wenn Bobrowski der Bauer ist, so ist Hamburger der Gärtner. Diese Affinität und dieser Unterschied verbindet sie und ihr Werk (wie es von Seiten Bobrowskis wohl nur mit Peter Huchel möglich war), und hat wohl viel zur Wahlverwandtschaft der beiden Dichter beigetragen.
Wer zudem von seinem Ort fortgerissen wurde und nicht zurückkehren kann – so denkbar verschieden beide Fälle sind – kämpft fortan immer gegen die Bodenlosigkeit an. Die Gedichte von M. H. und J. B. lassen sich auch als Versuche lesen, dieser Bedrohung zu widerstehen.
So nahe liegend die Idee war, den Briefwechsel vollständig zu veröffentlichen (manche Passagen finden sich bereits in dem Marbacher Katalog zu Bobrowski), so verdankt sich der entscheidende Impuls einem Abend im Oktober 2002, an dem M. H. im Literaturhaus Berlin auf Einladung der Johannes-Bobrowski-Gesellschaft über J. B. sprach. Am Tag zuvor waren M. H., Peter Waterhouse, der mehrere Gedichtbände von Michael Hamburger ins Deutsche übertragen hat, und ich nach Kladow gefahren, auf der Suche nach dem großelterlichen Haus. Ein viele Jahre zurückliegender Versuch war M. H. bereits geglückt, obwohl die Straßennamen sich geändert hatten, aus dem Sandweg eine Asphaltstraße geworden war, aus dem Flachdach ein Spitzdach. Vor allem erschwerten neue Häuser an Stelle von Gemüsegärten und Wiesen die Orientierung.
Vom Parkplatz in der Nähe der Wannseefähren aus liefen wir den Hang hinauf.
Der 78jährige M. H. stürmte voran, wir hatten beinah Mühe zu folgen.
Nach einigem Umherirren fragten wir einen der wenigen Passanten, einen großgewachsenen Mann, nach einem Haus am Hang, dessen frühere Adresse wohl „Am Quastenhorn“ gewesen war.
„Ach!“ rief er, „sie meinen das Haus, in dem Goebbels – oder nein: Göring gewohnt hat?“ „Nein“, erwiderte M. H., „das ist es bestimmt nicht.“ Der Verdacht, wir bewegten uns auf Goebbels oder Görings Spuren, erschien mir in diesem Moment aberwitzig. Was es denn da zu lachen gäbe, fuhr mich der Mann an, dafür gäbe es gar keinen Grund, die (Goebbels und Göring) wären schließlich „Personen der Zeitgeschichte wie viele andere auch.“ Trotz der Beschwichtigungsversuche von M. H. beruhigte sich der Mann nicht mehr, weshalb wir das Weite suchten; allein M. H. bedankte sich freundlich bei dem Kladower.
Eine Viertelstunde später standen wir vor dem Haus, klingelten vergeblich (bei dem ersten Besuch hatten die neuen Besitzer ungefragt versichert, alles rechtmäßig erworben zu haben) und ließen uns von M. H. die frühere, nun verbaute Aussicht auf den See beschreiben, auch die Lage der Gärten und des Hauses seiner Kindheitsfreundin.
Danach kehrten wir in dem kleinen, etwas heruntergekommenen italienischen Restaurant gegenüber der Anlegestelle ein, wo wir uns an den letzten freien Tisch setzten. Am Nebentisch hatte fast gleichzeitig eine ältere Dame Platz genommen. M. H. sprach sie an. Ja, sagte sie schließlich, sie habe hier schon immer gewohnt. Auch er sei früher hier sehr viel gewesen, sagte M. H., er habe aber 1933 mit seinen Eltern Deutschland verlassen müssen, mit neun Jahren. Sie nickte. Der Abschied, sagte M. H., sei ihm sehr schwer gefallen. Eine schwere Zeit damals, sagte er. Die Dame blickte kurz zu ihm auf, um dann wieder aus dem Fenster zu sehen. Ein Kellner glaubte, einschreiten zu müssen, ließ sich aber leicht beruhigen. Nicht einfach sei es damals gewesen, sagte die ältere Dame, besonders nach 45, die britische Besatzung, das sei wirklich eine schwere Zeit gewesen. Noch höflicher als bei unserer ersten Begegnung zog sich M. H. an unseren Tisch zurück.
Er habe die alte Dame angesprochen, schrieb M. H. später, „weil ich das Gefühl hatte, daß sie zum Kladow meiner Kindheit gehört und vielleicht sogar jenes Mädchen war, in das ich verliebt war? Ob sie dieses war, werde ich nie wissen und konnte sie auch nicht fragen, da ich sogar den Namen vergessen hatte! Sie wollte ja nur über das Unheil der britischen Besatzung sprechen – was zu politischen Fragen geführt hätte. […] Nie hätte ich eine fremde Frau angesprochen, wenn mich nicht irgend etwas Unverständliches dazu gedrängt hätte.“
Es fällt auf, daß in den Briefen nicht von der Vergangenheit die Rede ist. Man sollte das nicht als selbstverständlich abtun.
Der Emigrant, dem jene nach dem Leben trachteten, deren Uniform der Stabsgefreite J. B. trug, hat das, was ihm widerfuhr, in vielfacher Hinsicht als Aufgabe verstanden. Bereits 1943 veröffentlichte er seine ersten englischsprachigen Hölderlin-Nachdichtungen (in den Briefen meldet er den Abschluß der Hölderlin Übersetzungen!). Seither hat M. H. als Übersetzer, Vermittler, Kritiker, Lehrer, Herausgeber, Essayist und gastgebender Freund im wahrsten Sinne des Wortes Unschätzbares für die deutsche Literatur, vor allem die Lyrik, geleistet, nicht selten unter Zurücksetzung des eigenen Werkes.
J. B. hat die Wahl seines Themas als „so etwas wie eine Kriegsverletzung“ beschrieben.
Zu schreiben habe ich begonnen am Ilmensee 1941, über russische Landschaft, aber als Fremder, als Deutscher. Daraus ist ein Thema geworden, ungefähr: Die Deutschen und der europäische Osten. Weil ich um die Memel herum aufgewachsen bin, wo Polen, Litauer, Russen, Deutsche miteinander lebten, unter ihnen allen die Judenheit. Eine lange Geschichte aus Unglück und Verschuldung, seit den Tagen des Deutschen Ordens, die meinem Volk zu Buche steht. Wohl nicht zu tilgen und zu sühnen, aber eine Hoffnung wert und einen redlichen Versuch in deutschen Gedichten.
In seinem großen Buche Wahrheit und Poesie – Spannungen in der modernen Lyrik von Baudelaire bis zur Gegenwart sieht M. H. die deutschsprachige Nachkriegslyrik in der besonderen Spannung zwischen „Gewissen und Schöpfertum.“ Und schreibt dann über seinen Freund:
Gewissen und Schöpfertum sind in bewundernswerter Weise in Einklang gebracht im Werk des DDR-Lyrikers Johannes Bobrowski.
In dem Gedicht „Freunde“ heißt es in eindeutigem Bezug auf Bobrowski:
Zwischen seinem Fluß, seinem Reiher
Und der nächsten ausgebrannten Hütte
Der Hiatus, die tödliche Distanz,
Die sein Atem überbrückt.
„Rede, daß ich dich sehe, sagen wir. Rede, daß wir dich sehn“, steht in den Litauischen Clavieren. Bobrowski forderte von sich selbst, in seinen Gedichten „uniformiert und durchaus kenntlich“ zu stehen. Hat er es eingelöst? Ja und Nein. Was auch immer unausgesprochen blieb, im Gedicht, in der Prosa war das Unaussprechliche gegenwärtig.
Wo trafen sich Blicke?
Auf dem Wasser. Nur auf dem Wasser.
Und immer wußten wir beide:
unterm Spiegel zerrinnt der See.
So die zweite Strophe von Michael Hamburgers Gedicht „Abschied, in memoriam Johannes Bobrowski“, das diesen Briefwechsel beschließt.
Der letzten Zeile „Weitergehn. Sterbender. Stummer.“ ließe sich antworten, daß nicht nur das Werk der beiden Dichter, sondern auch ihre Freundschaft, die von diesen Briefen skizziert wird, die Welt lebenswerter und stimmenreicher gemacht hat.
Ingo Schulze, in Johannes Bobrowski / Michael Hamburger: „Jedes Gedicht ist das letzte“. Briefwechsel, herausgegeben und kommentiert von Jochen Meyer
W.G. Sebald besucht Michael Hamburger. Ein Text aus dem W.G. Sebald-Forum für den ausgewanderten Schriftsteller, Wanderer, Germanisten, Autor des Elementargedichts „Nach der Natur“ und weiterer Werke. Eingerichtet von Christian Wirth.
Fakten und Vermutungen zum Poesiealbum + wiederentdeckt +
50 Jahre 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6
Fakten und Vermutungen zum Herausgeber
Fakten und Vermutungen zum Autor + KLfG + IMDb +
DAS&D + Johann-Heinrich-Voß-Preis
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Galerie Foto Gezett
Nachrufe auf Michael Hamburger: P.E.N. ✝ Die Zeit
Michael Hamburger – Ein englischer Dichter aus Deutschland.


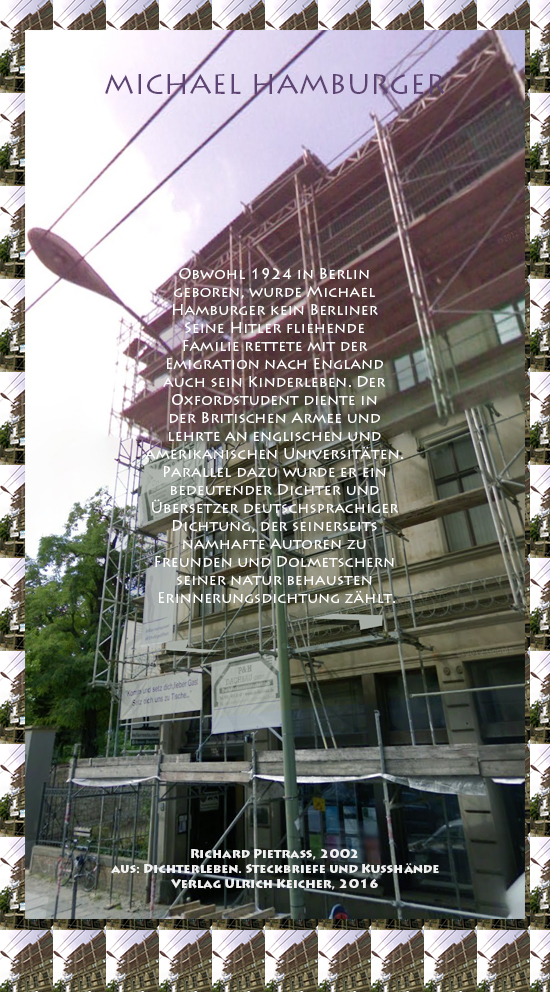








Schreibe einen Kommentar