Nicolas Born: Das Auge des Entdeckers
DAS ERSCHEINEN EINES JEDEN IN DER MENGE
Ist es eine Wohltat allein zu sein
im Gelage der Gedanken ohne Augenzeugen
ohne das Auge des Entdeckers das sieht wie’s
aaaaaschmeckt
ohne das geübte Ohr der Menge?
Was ist eine Tatsache wert die unteilbar ist
was ist ein Universum ohne dein Beben
dein Erscheinen vor leeren Sitzreihen?
Die Menge geht auf der Erde
und nichts vergeht in der Menge
auf den Rücken summender Webstühle
erreichen wir den großen Widerspruch:
das Erscheinen eines jeden in der Menge
Das Auge des Entdeckers
der Titel bezeichnet die Intention von Borns neuen Gedichten recht genau. Es geht um die Ausweitung des Erfahrungshorizonts, nicht nur in quantitativem, sondern auch in qualitativem Sinn: anstatt, wie es zumeist geschieht, neue Erfahrungen auf alte zurückzuführen, soll auch am unscheinbarsten Alltagsdetail – einem Frühstück, einer flüchtigen Liebesbeziehung – ein Stück Utopie sichtbar gemacht werden. Nicht zurück hinter das politische Bewußtsein, das die westdeutsche Lyrik in den letzten Jahren geprägt und weitgehend paralysiert hat, sondern einen Schritt darüber hinaus. Der Text ist durchsetzt mit Zitaten aus älteren Reiseberichten, Science-fiction-Romanen und klassischen Utopien, die seinen Anspruch verdeutlichen sollen: die kritische Haltung, die auch in der Negation stets an ihre Gegner fixiert bleibt, zu überwinden mit Hilfe einer utopischen Perspektive, die nicht nur das Unerwünschte, sondern auch das Wünschenswerte beschreibt:
Denn nur die Ahnung der Gerechtigkeit erlaubt es, sich über eine einzelne Ungerechtigkeit zu empören.
(Sartre)
Rowohlt Taschenbuch Verlag, Klappentext, 1972
Rückkehr zur Wirklichkeit
(…)
So ist es nicht bloß ein Tribut an Erwartungen, wenn am Schluß dieses notwendig lückenhaften Tableaus ein Autor dieser ,postmodernen‘ Lyrik figuriert: Nicolas Born mit seinem dritten Band Das Auge des Entdeckers. Born hat von der inszenierten Spontaneität der neuen amerikanischen Lyrik, insbesondere von Frank O’Hara gelernt, aber anders als dessen deutsche Epigonen gelingt ihm die Anwendung der adaptierten Methode auf deutsche Stoffe. Die unverkrampfte Verbindung von Realismus und Phantastik beläßt dem gewählten Realitätsausschnitt seine Besonderheit, transzendiert ihn aber zumeist in spielerischer Manier in Richtung auf utopische Vorstellungen. Wie in der Pop-Lyrik dient Science-fiction als Folie, die durchsichtig wird für Märchen und Utopie:
und die große wunderbare Wortvermehrung
ist die große wunderbare Brotvermehrung
ein Buch ist ein Brot
Die „unblutige Weltkarte“, die Born entwirft, ist unsystematisch und antiideologisch, sie wird besetzt mit Wünschen und Sehnsüchten, die durch ihre Spontaneität überzeugen. So verliert auch die Titel-Metapher vom ,Auge des Entdeckers‘ ihren programmatischen Charakter, indem die Gedichte sich als spielerische Entwürfe zu dem entsprechenden Buch geben. Wo dennoch Programmatisches in pathetischer Form auftaucht, überführt es sich durch Übertreibung seines Unernstes:
Wir sind die Verräter der Geschichte
wir sind die tobenden Liebhaber der Erde
wir sind die fühlende Materie
aaadie wächst und wächst
In den theoretischen Äußerungen, die der Autor als „Nachbemerkung“ folgen läßt, gibt Born sich dezidierter, wenn er sagt, das Wahnsystem Realität müsse „um seinen Alleinvertretungsanspruch gebracht werden“. Aber diese surrealistische Perspektive ist für Born wohl deshalb besonders wichtig, weil ihn die alltägliche Wirklichkeit so affiziert. Während bei Krolow die Anerkennung der Realität das Subjekt aufs bloße Registrieren einzuschränken droht, möchte Born den Realitätszusammenhang durchstoßen. Die Piloten-Metapher, eine der Chiffren der Pop-Lyrik, findet sich auch hier:
Das Auge des Piloten ist voll Zärtlichkeit
aaaWIR überfliegen den Wendekreis der Realität
eine abgesprengte Hülse ist zu erkennen
aaader Realismus unten ganz klein
und „Zitate“
Die Zärtlichkeit, die einer utopischen Vorstellung gilt, wirkt überzeugender in den Gedichten, in denen die Alltäglichkeit wirklich zu sich kommt; etwa in dem anektodisch angelegten Gedicht „Die sechs Richtigen“, das die Utopie des kleinen Mannes, die Hoffnung auf einen Lottogewinn als Ineinander von Illusion und Nüchternheit darstellt:
Wir sitzen alle an einem Tisch Millionen
haben sechs Richtige
und Samstagabend werden die Falschen gezogen
doch im Kopf arbeiten sie weiter
die sechs Richtigen
An solchen Stellen nähert Born sich dem selbstgeformten Ideal an:
Jedes Wort ist eine Tätlichkeit und eine zärtliche Berührung des Lebens.
Mag man die „Tätlichkeit“ noch als Konzession an die geforderte Nützlichkeit von Gedichten auffassen, die zarte Empirie ist etwas, das in der Lyrik der letzten Jahre selten geworden ist und deshalb nun neu belebend wirkt.
Harald Hartung, Neue Rundschau, Heft 1, 1973
„Unverbürgte Schönheit ist eine der schönsten Sachen,
die einem in Gedichten begegnen“ (Ezra Pound)
Hier ist sie en masse!
Mit Sprache musst du anstellen, was das Wasser mit dem Licht anstellt, das sich auf ihm bricht. Deine Gedichte müssen das Wasser sein.
Salvador Espiru
Hier fängt es an
am Horizont dieses Gedichts
SCHLAFEN SIE KURZ
UND TRÄUMEN SIE SO WEIT SIE KÖNNEN!
Nicolas Born, Schriftsteller, still engagierte Persönlichkeit und vielleicht einer der größten Lyriker der deutschen Nachkriegsgeschichte, wäre am 31. Dezember dieses Jahres 75 geworden; er starb am 7. Dezember 1979 an Lungenkrebs.
Welche Rolle spielt
der Tod in diesem Gedicht?
DER TOD IM GEDICHT
jeder ist mit seiner Arbeit beschäftigt
darum nicht mit dem Tod
jeder hält in seiner Arbeit
freundliche Gedanken an sich selbst versteckt
vielleicht ist Eigenliebe die vollkommenste
leider nicht durchzuhalten
Utopie und Sehnsucht – fragwürdige Grundsätze für einen Dichter oder notwendige? Meistens bewegen sich moderne Gedichte auf einer Gradwanderung zwischen beidem, verlassen sich als Rückendeckung auf Ironie und makellose Distanz. Nicolas Born tat in seiner Zeit mit seinem dritten und letzten Gedichtband Das Auge des Entdeckers (nach Marktlage und Wo mir der Kopf steht) eine überraschende Kehrtwende, die zwar schon vorher seine Dichtung quasi ausgemacht hatte, nun aber endgültig zum Programm vollendet wurde. Dieser Zug führt ihn weg von einer anorganischen Poesie zu einer fast schon molekularen, die im Alltäglichen das Leben mit Gesten, Schönheit und Poesie untermauert.
die Kellnerin die nicht nachkommt
und auch schon zum zweiten Mal verheiratet ist
und der Busfahrer der abseits steht
und seit vielen Jahren seine Gefühle für sich behält
alle wollen sie auffliegen
hier ist die große Nachfrage
und das lächerliche Angebot
die Jahre sausen durch die Kalender und wir
sind die Kalender – so abgerissen
Viele gute Gedichte tragen den unvermittelten Zug des Lebens in sich, er scheint sich einzuschleichen in die Zeilen, was sich nicht an Metaphern oder Techniken, sondern allerhöchstens an einem magisch koordinierten, inneren Zusammenhalt festmachen lässt, wodurch aus der mittellosen Sprache plötzlich eine ungeheuer wahre, verlässliche, schöne Betrachterin und Vollenderin wird.
ein Tag wie ein anderer Tag
die Bäume wachsen wo sie gepflanzt wurden
die Wälder singen und wandern in die Bibliotheken
die Bibliotheken schweigen
wie die Fotos von Massakern schweigen
und ich schreie auf im Schlaf
wie du Entfernter im Wachen schreist
Wir haben es nicht in der Hand
das Märchen im Kopf
Das Auge des Betrachters ist ein unkonventionelles und doch sehr unkompliziertes Werk. Kaum eines der Geschichte scheint einen Plan zu haben und meist ist auch die Thematik eher ein Alles in Einem, als ein streng sukzessiv vorangehender Prozess. Immer wieder gibt es streckenweise Zeilenfolgen von großer sprachlicher Fixierung, dann befinden wir uns plötzlich wieder im Niemandsland Ich, wo jedes winzige Detail hervorgehoben werden muss, jeder Blick auf seinem Weg verfolgt wird.
Der Bettgedanke der letzten Nacht ist einfach
einfach wie ich: Kunst heißt
das Leben mit Präzision zu verfehlen!
Wie schon oft nachzulesen, geht es Born in diesem Band vor allem darum dem „Wahnsystem Realität“ mit sehr persönlichen Glücks- und Wahrheitsmomenten zu begegnen und, wenn möglich, dass Wahnsystem gleichsam um diese Ich-Momente herum aufzustellen. Manche der Gedichte sind in ihrer unzielstrebigen Gelassenheit, ihrer formalen Windigkeit, die mit so großer, visueller Dichte einhergeht, einfach unverwechselbar, wie ein einmaliger Weg zu einem ganz bestimmten, bekannten oder wichtigen Ort. Viel von dem, was darin geschieht bleibt ihr Geheimnis und kann nicht wirklich extrahiert werden (deswegen bitte ein eventuelles Lesen nicht „zu“ sehr von den Zitaten hier abhängig machen) weil es die gesamte Form und Formulierung ist, eine Verästelung rätselhafter Differenzen und sich nähernder, untotalitärer kleiner Wunder und Fingerzeige.
Und im Wind
wehen die Ruinen der Diktatmaschinen
Auch in seinem letzten Band zeigt Nicolas Born, dass er ein ganz besonderer Dichter war, mit einer ganz eigenen Stimme, die „Nicolas Born Sachen“ sagte, Dinge und Formulierungen, die wohl kein anderer hätte finden können. Mit lässiger und dann doch wieder eloquenter Ambivalenz hat Born versucht in kleinen Momenten die Ambivalenz aufzuheben oder sie zumindest aus diesem Wort und aus dem Worten „Leben, Alltag etc.“ in andere, unscheinbare, aber wahrere zu führen. Dabei ist er selten aggressiv und wenn doch, dann mit einer Direktheit und einer unausführlichen Schnelligkeit, die einem mehr wie eine sehr geschliffene Wahrheit vorkommt:
Dann kamen Bosse so stark
machten uns schwach machten uns schwach
„Ich bin Realist“ sagte einer erfolgreich.
„Dann stirb doch“ habe ich ihm geantwortet
Weder war er ein großer Elegiker, noch hat er seine Themen über die Wesenheiten eines guten Gedichts gestellt. Er schrieb Gedichte, wollte schöne Gedichte schreiben und einige, so sagte er, seien zu seiner großen Überraschung tatsächlich schön geworden. Als Lyrikliebhaber wird man sich, denke ich, sehr darüber freuen, Born begegnet zu sein. Vielleicht wird es das Leben nicht irgendwie verändern, aber es wird ein neuer Stern am Himmel der eigenen literarischen Wahrnehmung mit ihm erscheinen, zu dem man hinaufsehen oder -zeigen, still nachsinnend über die rätselhafte Offenheit, Einsamkeit und Bedeutung seiner Gedichte…
Wenn es wahr ist dass Kriege sein müssen
ist es dann noch wichtig daran teilzunehmen
Timo Brandt, amazon.de, 13.12.2012
Lyrik
Du kannst nicht davon leben
mit der Wirklichkeit zu konkurrieren
noch kannst du von der Wirklichkeit leben
– mit diesen Worten beginnt ein Gedicht in dem neuen Lyrikband Das Auge des Entdeckers von Nicolas Born, der im Rowohlt Verlag (Reinbek) erschienen ist. Schon in seinen beiden ersten Lyrikbüchern Marktlage (1967) und Wo mir der Kopf steht (1970) hatte sich Born kritisch mit der Realität auseinandergesetzt. In prosanahen, nicht von vorgegebenen metrischen Mustern bestimmten Texten wurden Dinge und Tatbestände beim Namen genannt – nicht Evokation und Beschwörung war das Ziel, sondern der blosse Befund, die Bestandsaufnahme – im Zweifelsfall wurde die Banalität pseudolyrischer Scheintiefe vorgezogen.
Born wollte, wie so viele jüngere Autoren, bewusstseinsbildend wirken, und wenn er auch nicht glaubte, mit Gedichten die Gesellschaft messbar verändern zu können, so meinte er doch, ein Gedicht, das sich an die Wahrheit der Fakten halte, könne „subversiv“ sein. Freilich hielt er denjenigen, die von Literatur einen direkten politischen Effekt verlangen, entgegen:
Die Forderung, ein Gedicht habe entweder effektiv oder nicht geschrieben worden zu sein, ist eine Forderung von Krämerseelen, die sich an Massstäben orientieren, mit denen die Nationalökonomie einen Mann misst.
Inzwischen hat sich Borns Verständnis vom Gedicht als einem Spiegel der Wirklichkeit merklich gewandelt. Immer noch bildet er die Realität ab, das heisst, er registriert in durchaus subjektiven, von eigenen Erfahrungen ausgehenden Gedichten die Einflüsse der Wirklichkeit auf das lyrische Ich: unprätentiös, klar, keineswegs besserwisserisch, eher fragend als behauptend. Diese Gedichte zeichnet eine grosse Ehrlichkeit aus, alle Grosssprecherei ist ihnen fremd. Aber Born belässt es nun nicht mehr beim blossen Realismus des inzwischen sattsam bekannten zeitkritischen Gedichts: er ist vielmehr – so sagte es treffend Wolfgang Maier – zu einem Realismus gelangt, „der sich aus dem Utopischen speist“. Born hat sich leiten lassen von Sartres Wort, nur die Ahnung der Gerechtigkeit erlaube es, sich über eine einzelne Ungerechtigkeit zu empören.
Nicolas Born hat das Dilemma erkannt, dass ständiges blosses Hindeuten auf das, was ist, auf das bestehende Schlechte also, wirkungslos bleibt, dass der Autor mit seinen unentwegten Hinweisen auf das Bestehende in der Negation befangen bleibt und letztlich zum „kritischen Partner der Macht“ verkommt. Stattdessen fordert er eine Aktivierung des verkümmerten Bewusstseins von der Existenz unserer positiven Möglichkeiten:
Unsere besseren Möglichkeiten müssen besser ausgestellt und dargestellt werden; an den besseren Möglichkeiten muss die Realität gemessen werden, nicht umgekehrt. Vorläufig machen die Macher die Realität, und die Literatur liefert den passenden Realismus dazu.
Born plädiert für die Phantasie, wendet sich gegen den Alleinvertretungsanspruch des „Wahnsystems Realität“, dessen Vertreter die „transzendierenden Energien“ abtreiben wollen als lächerliche oder gefährliche kriminelle Utopien. Der Lyriker versucht in seinen Gedichten „den schmerzhaften Vergleich zwischen phantastischem Anspruch und realem Angebot“. „Information ist gut“, so heisst es weiter in Borns Nachwort, und:
Es ist nicht unter der Würde der Literatur zu informieren, aber unter ihren Möglichkeiten.
Utopische Vorstellungen verwechselt er dabei nicht mit praktischen Methoden, doch gesteht er ihnen den „Wert von Impulsen“ zu. Die neuen Gedichte Nicolas Borns sind noch immer stark der Realität verhaftet, sie sind keine freischwebenden utopischen Entwürfe. Aber die Wirklichkeit in ihnen ist der Hintergrund für den Aufweis anderer, besserer Lebensmöglichkeiten, die verschüttet worden sind: etwa der Vorstellung „einer weltweiten Machtlosigkeit / in der des einen Vorteil / nicht des anderen Nachteil ist“; einer Zeit, in der „sich jeder im anderen erkennt“, einer Epoche, in der man sagen kann:
Ein Buch ist ein Brot
und jedes Wort verwandelt sich in eine Frucht
jeder Gedanke ist die Erfindung einer Bewegung
und der Schmerz dazusein ist das Glück dazusein.
Freilich: diese Zeilen stammen aus dem „SF-Poem“; doch zwingt Born den Leser immer wieder zu der Frage, ob das, was er als Möglichkeit aufzeigt, Science Fiction und Utopie bleiben muss, zu der Frage auch, was der Realisierung besserer Möglichkeiten im Wege steht:
Eine Welt
in der jeder jeder ist –
Klingt das nicht vertraut?
Könnte das nicht von jedem sein?
J. P. Wallmann, Die Tat, 27.1.1973
Weitere Beiträge zu diesem Buch:
Werner Ross: Leierspiel – west-östlich
Merkur, Heft 27, 1973
Roland Willareth: Jedes Wort ist eine Zärtlichkeit und eine zärtliche Berührung des Lebens
In: Arbeitskreis Linker Germanisten (Hg.): Neue deutsche Lyrik, 1977
Detlev Zeiler: Kunst heißt / das Leben mit Präzision verfehlen
Arbeitskreis Linker Germanisten (Hg.): Neue deutsche Lyrik, 1977
Ursula Krechel: Lesarten. Gedichte, Lieder, Balladen. Ausgewählt und kommentiert von Ursula Krechel
Luchterhand Verlag, 1982
Hans Kügler: Gleichzeitigkeit – Anmerkungen zum Zeitbewußtsein in einem Gedicht von Nicolas Born
Klaus Berg / Norbert Kruse (Hg.): Communicatio enim amicitia. Freundesgabe für Ulrich Hötzer. Beiträge zur Germanistik-Didaktik-Musikwissenschaft, 1983
Wolfgang Maier: Anlauf zum Glück, gekoppelt mit Tod
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 26.9.1972
Wolfgang Maier: Ein Lyriker, der nicht auf Misere abonniert ist
Berliner Morgenpost, 26.11.1972
Yaak Karsunke: Riskante Balance auf die Utopie zu
Frankfurter Rundschau, 9.10.1972
Heinrich Vormweg: Das Prinzip Hoffnung im Gedicht?
Süddeutsche Zeitung, 27.10.1972
Roman Ritter: Das Auge des Entdeckers
Deutsche Volkszeitung, 30.11.1972
Ein paar Sätze für Nicolas Born
Ich kenne Nicolas Born seit fünfzehn Jahren. KENNEN heißt: seine Sache kennenzulernen auf dem Grund einer verläßlichen und weiträumigen Freundschaft. Ihn selber zu kennen kann ich nicht behaupten, ich kann es wünschen. Vielleicht erkenne ich seine Freundlichkeit (er braucht sie mehr für andere als für sich selbst), das zunehmend Illusionslose seiner Optik, die Rücksichtslosigkeit seiner Selbstanschauung. Ich weiß vielleicht etwas von der Unabhängigkeit seines poetischen und analytischen Denkens. Mir ist seine kritische Fairneß bekannt, seine literarische Toleranz auch dort, wo die Sprache anderer ihm fremd wird, seine weltanschauliche Integrität und so weiter. Es ist nicht unwichtig, das zu sagen, weil die persönliche Weitergabe des Preises (gemeint ist der Rilke-Preis 1979) bedeutet: die Sache und den Menschen bejahen zu können.
Preise oder Ehrungen sind nicht so wichtig, und eine Feierstunde, kurios, aber üblich, bestätigt einmal mehr das Inflationäre der gegenwärtigen Kultur, ihren Organisations- und Podiumscharakter. Da wird ein Preis authentisch durch die Person. Als Ernst Meister an einem Herbstabend anrief und fragte, ob ich den Preis von ihm annehmen wolle, sagte ich augenblicklich zu. Eine Bedenkzeit war nicht nötig, weil ich für Ernst Meister keine Bedenkzeit brauchte.
Als der Gedichtband Das Auge des Entdeckers erschien, war das ein helles Signal für die siebziger Jahre. Die Offenheit und Vitalität, mit der sich ein Mensch hier in die Epoche einblendete, war und ist eine atmende, echte Antwort auf alles, was falsch, fatal und halbwertig ist: Antwort auf ideologische Begradigung, Erstarrung des Denkens, Zerstörung von Lebensgefühl; auf Verflachung, Mode und Macht in jeder Form; auf Larmoyanz und Stubenhockerei in der Defensive. Es war und ist eine souveräne Antwort auf die durchschlagende Gemeinheit öffentlicher und politischer Formeln. Schließlich handelt es sich um eine Sprache, in der die Überflutung durch neue amerikanische Poesie syntaktisch gestaltet ist.
Das Werk hier festzulegen oder auszuwalzen kann nicht von Interesse sein. Es scheint mir aber wichtig zu sagen, daß die Härte und Wahrhaftigkeit seines Romans DIE FÄLSCHUNG ein weiterer Schritt ist. Sich steigern zu können ist für den Schriftsteller nicht selbstverständlich. Die Folgerichtigkeit von Arbeit und Leben, das produktive Verwandeln von Erfahrung, ist heute immer mehr in Frage gestellt. Die intellektuellen Krisen und Widersprüche, die inneren Katastrophen sind zu vielfältig, zu unübersehbar geworden (und möglicherweise kaum noch auszugleichen), als daß hier ein Mensch, soweit er voraussieht, für sich und seine Arbeit garantieren kann. Es ist deshalb schön, zu sehen und zu sagen, daß der neue Roman seine beste Prosa ist.
Nicolas Born schreibt poetische, epische und essayistische Sprache. Mit Rilke verbindet ihn vermutlich nur, daß er am anderen Ende steht. Nach langer Überlegung, den Preis betreffend, kam es mir schließlich darauf an, den DICHTER zu finden, der deutlich am anderen Ende steht. Rilkes WELTINNENRAUM und der Glaube an ihn ist heute zerstört. Kein Mensch steht unangetastet in seiner Menschenwürde, kein denkender Mensch lebt ohne Verlustgeschäft. Protest und Verzweiflung, kein Fisch lebt weiterhin wie der Fisch im Wasser. Das ist eine öffentliche Tatsache, der sich kein Mensch entziehen kann. In dieser Verhaftung bestimmt er noch immer sich selbst. Nicolas Born steht, wie wenige, ruhelos und direkt in der Erkenntnis wachsender Vernichtung von Zukunft, WELT- UND MENSCHENINNENRAUM. Mit allem, was er an kritischer Energie, an Lebendigkeit und offener Erfahrung verkörpert, steht er dagegen. Seine Wunschkraft ist hell, sein Widerstand genau, seine Zeit- und Gesellschaftskritik nicht pauschal, sondern gründlich. Am kollektiven und individuellen Rechthaben nimmt er nicht teil – er stellt sich dagegen mit einer ihm eigenen, konkreten, ganz gegenwärtigen Phantasie. Von Ausweg oder Tröstung macht er keinen Gebrauch. Seine Sprache schreibt die Wunden nicht weg, sondern legt sie bloß. Es versteckt sich in ihr kein Bemühen um Erleichterung von der Erkenntnis. Er ist ein Lyriker, der das spezifisch POETISCHE lyrischer Sprache bezweifelt, jedenfalls nur sehr sparsam gebraucht. Ich habe bemerkt, daß Klassizismus sprachlicher Form ihm Unbehagen bereiten kann. Für ein Unding wie KUNST AN SICH hat er keine Geduld.
Wir sind in London und gehen durch die Tate Gallery. Vor der Grafik William Blakes wird er unruhig, die museale Ordnung scheint ihn zu ermüden. Auf den Straßen danach ist er wieder zu Hause. In einer Kneipe fühlt er sich wieder frei.
Von Anfang an hat ein Verlangen nach unanfechtbarem Leben in der Zeit seine Sprache menschenmöglich gemacht. MENSCHENMÖGLICH heißt: das Dasein der vielen im eigenen zu erkennen, ihm Sprache, Gerechtigkeit, Utopie zu geben. Eine Zeile im Auge des Entdeckers heißt:
Jedes Wort ist eine Tätlichkeit und eine zärtliche
Berührung des Lebens.
Die zärtliche Berührung des Lebens ist selten, die Tätlichkeit der Sätze unversöhnlich geworden. Was die Sprache an Hoffnung aufgeben muß, das gewinnt sie an Schärfe und Belastbarkeit.
Restlos ging das Geheimnis der Wesen auf in Beton.
Resignation wäre Trost oder Einverständnis. Es gibt keine Resignation, weil es Sprache gibt.
Christoph Meckel, aus Rilke-Preis 1979 an Nicolas Born, Buchhändler-Vereinigung, 1980
NICOLAS BORN
Ich würde gern Born wiedersehen,
der hier geschlafen hat,
in diesem Bett, in diesem Hotel,
kurz vor der Renovierung.
Gerald Bisinger, der Dichter,
war damals Zimmerkellner
und sorgte für frisches Bier.
Wir sprachen darüber,
was nicht gewesen ist,
was nie gewesen sein wird.
Ach, der traurige Reichtum
seiner hohen hellen Lieder.
Schon damals gab es die Spinnen,
die mir jetzt ein Netz flicht,
in dem ich ersticke, fast.
Michael Krüger
Mitschnitt der Preisverleihung des Peter-Huchel-Preises (postum) vom 3.4.2005
Zum 80. Geburtstag des Autors:
Ingo Plaschke: Nicolas Born: Der politische Poet, der viel zu früh starb
Neue Rhein/Neue Ruhr Zeitung, 28.12.2017
Hilmar Klute: Eine Welt für alle
Süddeutsche Zeitung, 21.12.2017
Ruth Johanna Benrath: RUNDLING ANERDE, Schreyahn an Damnatz
fixpoetry.com, 31.12.2017

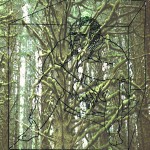








Schreibe einen Kommentar