Peter Rühmkorf: Lethe mit Schuß
MEINE STELLE AM HIMMEL
Komm an die Theke, Besiegter, heute abend
v e r b i r g
dich nicht hinter Mumienbinden –
Wir werden im kapitalistischen Tollwutbezirk
schon noch einen Barhocker finden
Schmeiß du die Lage, ich sing dir ein Liedchen dafür
v o n d e n f a s t s c h o n
z e r t r e t e n e n F l a m m e n . . .
Kopf hoch, Genossen, mit noch was Obstler bringen wir
genug kritische Masse zusammen.
Was man uns abband, steht deshalb nicht still;
selbst hier nicht im freundlichen Feuchten:
ich will meine Stelle am Himmel
w i d e r h a b e n, i c h w i l l
noch einmal von vorne leuchten.
Daß sich die eine minderjährige
u n d m e i n e U – P e r s o n
vielleicht doch noch finden und mischen…
Offen Ihr, rede ich Blödsinn oder dichte ich schon,
oder lieg ich, unhaltbar, dazwischen?
Wo ich schon nichts mehr beherrsche,
hassend was ich bediene,
liebend was ich verlor,
zöge ich selbst noch die rasende robespierresche
G l e i c h m a c h e m a s c h i n e
diesem Konkurrenzkäfig vor.
Wo waren wir stehengeblieben?
K a p i t a l i s m u s i s t K i e z:
einer betriebe des anderen Unterwerfung –
Warte nur balde – die Krise – die Lageverschärfung –
die inneren Widersprüche – dann unsre Klassenjustiz
Alle verbrüdert – verschwistert –
gib mir den Gnadenschluck, Lotti, ein Letztes, ein Bier:
Schön wie von unten die Sonne steigt,
wie die Krone zerknistert:
wenn ich noch etwas lebe, les ich es,
hoffnungsleichtes chinesisches
Milligramm-Zauberpapier…
Peter Rühmkorf und wir
Als Peter Rühmkorf 1981 eine Auswahl von Erich Kästners Gedichten herausgab, da beschloß er den Band 677 der Bibliothek Suhrkamp mit einem Nachwort, in dem es heißt: „Daß die Poesie von ihren psychosozialen Funktionen her ein Gesellungsmedium für aus der Bahn getragene und verstreute Einzelne ist, mag eine Binsenweisheit sein, wir müssen sie uns trotzdem bei jedem Dichter noch einmal von Anfang an zurechtbuchstabieren.
…
Als Klaus Wagenbach 1992 einen – formal weitergefaßten – Rühmkorf-Reader zusammenstellte, gab er dem „Komm raus!“ titulierten Buch eine Vorbemerkung mit auf den Weg: „Es gibt kaum einen deutschen Autor, bei dem ästhetische Anstrengung und inhaltliche Absicht, Vergewisserung (und Kenntnis!) der Tradition wie Lust am Experiment so nahe beieinander, ja fast aufeinander liegen wie bei Peter Rühmkorf. Wenn diese Überzeugungen und Leidenschaften zudem auch noch dem Herausgeber sehr naheliegen, muß er sich dafür entschuldigen, daß seine Auswahl wahrscheinlich zu persönlich geworden ist: er tut es hiermit.“
Besagter Gefahr versuchte ich dadurch zu steuern, daß ich zwei überpersönliche Auswahlkriterien einschaltete: Erstens nahm ich alle von Rühmkorf als „Selbstporträts“ gekennzeichneten Gedichte auf, das „Selbstporträt 1958“, das „Selbstporträt“ aus „Haltbar bis Ende 1999“, wohl Ende der 70er entstanden, und „Mit den Jahren / Selbst III/88“, ein in vieler Hinsicht ungewöhnliches Gedicht.
Als Rühmkorf 1989 die Ehrendoktorwürde der Gießener Justus-Liebig-Universität verliehen wurde, erwähnt er in seiner Dankesrede ein monumentales Buch, „Selbst III/1988, Aus der Fassung“, dessen „poetisches Bestreben“ er folgendermaßen umreißt: „Die Konstruktion einer lyrischen Galaxis aus Tausenden von disparaten Einzeleinfällen einmal an einem handlichen Modell vorzuführen. Es verzeichnet auf – sage und schreibe – 730 Seiten Din A4 den Bildungsgang eines einzigen Gedichtes, eine einigermaßen singuläre Wahnsinnsunternehmung“ – 730 Seiten voll faksimilierter handgeschriebener oder getippter Aufzeichnungen, die der Dichter Schritt für Schritt zu sieben Druckseiten komprimiert hat – fürwahr ein Verdichter!
…
Soviel zum ersten der beiden überpersönlichen Auswahlkriterien. Das zweite aber bestand darin, unterschiedslos alle Gedichte aufzunehmen, in welchen Rühmkorf vom „Flieder“ redet. Wie oft – und wann – das im Laufe der berücksichtigten sechsunddreißig Jahre Rühmkorfschen Dichtens der Fall gewesen ist, mag jeder nachlesen; warum es gerade der Flieder dem Rühmkorf angetan hat, darf jedweder im stillen Kämmerlein ebenso bedenken wie die Frage, was eigentlich „Flieder“ derart hartnäckig auf „Lieder“ und „immer wieder“ reimt.
Sechsunddreißig Jahre versammle dieses Buch, sagte ich; mit zwei Ausnahmen, muß ich hinzufügen. Das erste Gedicht der Auswahl ist ein Rühmkorf avant Rühmkorf; es stammt noch aus seiner Schülerzeit: „Machte Anfang Fünfzig mein Abitur (mit Hängen und Kotzen), dachte aber nicht im Ernst dran, das als ‚Reifeprüfung‘ zu nehmen, hatte die meine gerade bei Döblin laufen, der wollte was bringen von mir, im ‚Goldenen Tor‘“ – worauf Rühmkorf in seinem Erinnerungsbuch „Die Jahre die ihr kennt“ das Gedicht „Und ich war da“ einrückt.
Aus noch früheren Schichten von Rühmkorfs Trachten und Dichten aber speist sich der Titel dieses Auswahlbandes. Zwar findet sich die Fassung „Lethe mit Schuß“ erstmals in einem Gedicht der 60er, 70er Jahre, in „Jetzt mitten im Klaren“, doch der Einfall ist irgendwelche zwanzig Jahre älter und ein unheimliches Beispiel dafür, in welch festgefügten Sprachzusammenhängen diese oft doch so zerrissen wirkenden Dichter – ja was nun: eingesponnen sind? Selber spinnenartig agieren?…
Robert Gernhardt, Aus dem Nachwort
Robert Gernhardt
hat sich im lyrischen Œuvre eines Kollegen umgesehen. Und was er gefunden, was ihn erheitert, was ihn beeindruckt und nachdenklich gemacht hat, hat er in einem Band versammelt, der mit „Das Schönste von Peter Rühmkorf“ überschrieben sein könnte – wenn es sich nicht ausgerechnet um Rühmkorf handelte. Lethe mit Schuß stimmt sogleich Rühmkorfs unverwechselbaren Ton an. Daß unter diesem Titel ein so schönes Buch entstanden ist, dafür bürgten der Herausgeber und – vor allem – der Herausgegebene.
Suhrkamp Verlag, Klappentext, 1998
Beitrag zu diesem Buch:
Wolfgang Werth: Mit allen Fliederstellen. Ein Rühmkorf-Auswahl und ein Rühmkorf-Rätsel
Süddeutsche Zeitung, 18./19.7.1998
Zu Gast bei Peter Rühmkorf
Övelgönne – ein so besonderer Ortsteil von Hamburg, wie auch Peter Rühmkorf außergewöhnlich ist. Nur zu Fuß zu erreichen. Kein Auto kann vor dem Haus geparkt werden. Das ist nicht jedermanns Sache. Das Eingekaufte muss über die „Himmelsleiter“ getragen werden – eine lange Treppe, die von der Elbchaussee hinunterführt zum feinsandigen Elbufer und der alten ehemaligen Lotsen- und Kapitänssiedlung. Hier lebt Peter Rühmkorf seit 1967, gemeinsam mit seiner Frau Eva.
„Einen anderen Platz zum Leben kann ich mir nicht vorstellen“, sagt er, schenkt uns etwas zu trinken ein und zündet sich eine Zigarette an. Vom Wohnraum – bestückt mit ledergebundenen Klassikern und Kunst, die den Kenner verraten (Rühmkorf studierte außer Germanistik, Psychologie und Pädagogik auch Kunstgeschichte) – schaut man auf den regen Fluss und die Schiffsanlagen am anderen Ufer. Lieber wäre Peter Rühmkorf mit mir in den darüber gelegenen Arbeitsraum gegangen.
„Von dort oben kann man über alles hinwegsehen“, sagt er schmunzelnd, „über die ganze Welt!“ Aber Tausende von Büchern, zum ersten Mal seit 10 Jahren ausgestaubt, so erzählt er, versperren den Weg in sein Arbeitsreich.
„Früher waren ja hier noch diese kleinen Läden, wo man sich kannte“, sagt er jetzt. Unversehens sind wir beim Thema. „Diese kleinen Krauter“, und seine Stimme nimmt eine melancholische Färbung an, „denen habe ich mich immer verwandtschaftlich nahe empfunden. Das ist doch irgendwie ein verwandter Beruf!“
Tante-Emma-Läden, Jahrmarkt, Puppenspiel – Stationen einer Biografie, deren Anfänge Peter Rühmkorf so skizziert: „Geboren am 25.10.29 als Sohn der Lehrerin Elisabeth R. und des reisenden Puppenspielers H.W. (Name ist dem Verf. bekannt) in Dortmund.“
Ein Vagant, eine Art von Puppenspieler, der seine Gedichte, Possen und Lieder auf Märkten und Plätzen vortrug, ist Peter Rühmkorf ja dann auch geworden. Und seine provokativ-schelmischen, seine parodistisch-ernsten Verse sind nicht wegzudenken aus der Lyrik der vergangenen 30 Jahre.
Mit einem wachen Gefühl für die Gefährdung des Menschen durch Unterdrückung und Anpassung begann Rühmkorf neben seinen eigenen Arbeiten, sich für den Kindervers zu interessieren, nicht die bürgerlich-wohlmeinenden, die in Kinderlieder-Sammlungen zu finden waren, sondern diejenigen, an die er sich aus seiner eigenen Kindheit und Schulzeit erinnerte. Weil er diese nirgendwo aufgeschrieben fand, begab er sich gezielt auf die Suche nach ihnen, schaute dabei dem „Volk aufs Maul“ und förderte bei diesen Feldstudien eine Fülle von Material zutage.
„Es ging mir auf einmal ein Leuchter auf“, erzählt er, „dass alle Menschenkinder in einer bestimmten Zeit ihrer Kindheit mit Poesie Umgang gehabt haben. Vor Jahren schien mir das als Gottesbeweis schlechthin für die Poesie! Eine ganz eigene Kinderkultur war da am Werk: Es ist doch ungeheuerlich, dass kleine Kinder solche selbst geschaffenen Dinge im Kopf haben und sie weitertransportieren, ohne dass sie jemand dazu drängt.“
Besonders sei ihm aufgefallen, dass Kinder keine Heldenverehrung kennen. Kein einziges Lob! Weder für Sänger, Fußballspieler noch andere Größen der Erwachsenen- oder Kinderwelt. „Nur der Kindervers lässt sich nichts vormachen, er lässt sich nicht dirigieren, im Gegenteil“, resümiert Peter Rühmkorf seine Erfahrungen. „Er hat stets etwas dagegen anzumelden. Am Kindervers exemplifiziert sich das Antiautoritäre. Dennoch ist es erstaunlich, dass die Kinder mit solchen Versen nicht nur gegen die Erziehung und Ordnungswelt der Erwachsenen zu Felde ziehen, sondern dass sie sich darin auch kleine Regeln setzen, teilweise sogar auf geradezu demokratische Weise.“ Gemeinschaftsbildung finde hier in demokratischer Abstimmung statt, eine Vorstellung, die Peter Rühmkorf auch in den Anfängen der Studentenbewegung verwirklicht sah und die ihm ungeheuer gut gefallen hat. Das gemeinschaftliche Tun war für ihn ein wichtiges Kriterium der 68erJahre. „Leider ist es dann aber viel zu bald“, erzählt er mit Bedauern, „in Querelen und Kämpfen untereinander verloren gegangen.“
Seine Sammlung von Kinder- und Volkspoesie Über das Volksvermögen – Exkurse in den literarischen Untergrund – ist eine umfassende Dokumentation dieser Mikroflora, von der Peter Rühmkorf befürchtet, dass sie durch die immense Überflutung durch das Fernsehen mehr und mehr zum Verschwinden verurteilt ist.
Die Neugierde, die Entlarvungsfreude, die Enthüllungslust – all jene Eigenschaften, die den Kindervers dort entstehen lassen, wo die elementaren Interessen der Kinder gefährdet sind, sind auch die grundlegenden Motive für Rühmkorfs Schreiben. Das Interesse daran kam nicht von ungefähr. So ist auch Rühmkorfs eigene Lyrik gekennzeichnet durch Schnoddrigkeit, Aufbegehren, kritischen Sarkasmus, Parodie und Persiflage.
Schon früh (1956), als Vertreter einer betrogenen Kriegsgeneration, erhob Rühmkorf seine Stimme gegen die sich etablierende Wirtschaftswunder-Gesellschaft und verkündete das „Ende aller Ismen“. Große Hoffnungen setzte er in die Studentenbewegung der 60er-Jahre, die zunächst seinen Glauben in die Veränderbarkeit des Menschen und seines sozialen Umfeldes zu rechtfertigen schien. „Kunst muss getragen werden durch Verantwortungsgefühl gegenüber den sozialen Gemeinschaftsaufgaben.“ Der Zusammenbruch jener Solidaritätsideale war für Rühmkorf eine bittere Enttäuschung. Traurig bilanzierte er: „Habe viele Schlachten, aber nie meine Identität verloren.“ Und trotz manch resignativer Töne „Wo nun dieser mein Witz das Land nicht verändert, / mein Mund auf der Stelle spricht“, wurde er nicht zum „dichtenden Privatmenschen“. Das wäre eben nicht Peter Rühmkorf!
„Komm raus! Komm raus aus deiner kaskoversicherten Dunkelkammer!… Immer noch vielerlei Licht hier… / Hier nichts gewollt zu haben, / ist soviel wie verspielt, das weißt du, oder? / … Komm raus aus deinem Todeskoben, überleg dir das Leben: / Die Morgenschiffe rauschen schon an / ein Tag aus Gold und Grau: / willst du mit rein?“ Die häufig benutzten Imperative sind zugleich Programm: „Bleib erschütterbar – und widersteh!“
„Das Gedicht ist ja eine Form des Monologs, der Selbstansprache“, antwortet Peter Rühmkorf auf meine Vermutung, dass er mit solchen Aufforderungen auch sich selbst meine. „Es führt aber dann zum Dialog, wenn das Ich sich selbst als Du anspricht. Und über das geduzte Ich ist dann der Sprung zum Du des andern möglich, sodass in dem Du des andern auch das Ich mit angesprochen wird.“ Lächelnd fügt er hinzu: „Das ist die eigenartige Magie von Gedichten, diese Wechselbeziehung zwischen Ich und Du.“
Aber es gibt auch immer wieder und immer noch – dennoch – Dinge und Erlebnisse, an denen sich das Dichterwort zärtlich entzündet: „Flüchtig gelagert in dieses Gartengeviert, / wo mir der Abend nicht aus dem Auge will, / schön ist’s, / hier noch sagen zu können schön…“
Der möglichen Gefahr von romantischer Verklärung beugt Rühmkorf vor mit einer frechen Wendung, mit respektlos-virtuosen Variationen auf bekannte Lieder, durch Ironie… „Der Mond ist aufgegangen / Ich, zwischen Hoff- und Hangen, / rühr an den Himmel nicht. / Was Jagen oder Yoga? / Ich zieh die Tintentoga / des Abends vor mein Angesicht…“ Und ich verstehe, dass Hans Magnus Enzensberger ihn einen „metaphysischen Dichter“ genannt hat. „Ist Ihnen diese Bezeichnung unangenehm?“, frage ich Peter Rühmkorf. „Aber ganz und gar nicht!“, meint er mit Vehemenz. „Es ist ja wahr, es ist ja so, nur wusste es niemand, und ich bin froh, dass Enzensberger es gesagt hat.“
Seine frühen Vorbilder Hans Henny Jahnn, Brecht, Benn, Döblin hätten neben einem starken politischen Interesse auch die metaphysische Dimension in ihrem Werk gehabt. Da seien ja auch die großen Fragen der Menschheit nach dem Woher und Wohin. Und auch der Wunsch nach Erlösung. Poesie, Musik – das habe immer etwas mit Metaphysik zu tun: „Wenn ich in ein bewegendes Konzert gehe, gehe ich bereichert und erhoben und vielleicht sogar geheilt nach Hause.“
Der melancholische Dichter Peter Rühmkorf ist bei aller Provokation ein verkappter Romantiker, ein Moralist mit prophetischem Appell, ein poetischer Pädagoge und Liebeslyriker, all das zumeist im Gewande des „Bruder Lustig“, eines Possenreißers, der nicht so sehr Moral predigt, als vielmehr zunächst und besonders sich selbst in Frage stellt. „Dichtung ist Ausnahmezustand und wird es immer bleiben“, sagt er. Voraussetzung zum Dichten sei eine „eigentümlich verrückte Schiefstellung zur Welt“.
Rühmkorf will nicht nur bloßstellen, was in dieser Gesellschaft nicht stimmt. Er bleibt auch nicht beim Wunsch nach Aufbrechen von verkrusteten Strukturen, Veränderung, Erneuerung stehen. Über die Aufklärung, über die Entlarvung hinaus mahnt er das persönliche Mitgenommensein an, damit das Leiden an der Menschheit nicht „zum bloßen Routinefall“ wird: „… denn wenn es weiter so weitergeht wie bisher, / ist bald Schluß.“ – „Kein Grund zum Aufgeben, Meister!“, so beschwört er sich selbst. „Such dir Menschen, Genossen, Mitstreiter, die das Dunkel teilen, das reichlich nachgeflossen kommt.“
Bei diesen Zitaten, die ich ihm in unseren Gesprächen nenne, kommt Peter Rühmkorf noch einmal auf die 68er-Bewegung, die APO-Zeit zurück. „Ja, eine große Hoffnungsbewegung kann zu einer großen Enttäuschung werden.“ Und er erzählt von seiner literarischen Arbeit für die Zeitschrift konkret, in der damals „all die großen Themen“ behandelt worden seien und dass diese literarischen Bemühungen nicht im elitären Raum stecken blieben, sondern sich auf Straßen und Plätzen verbreiteten. „Es begannen sich die Früchte einzustellen in Form eines neuen Geistes der Solidarität, Freundschaft, Genossenschaft und Kameradschaft, der sich gegen eine autoritäre Besserwisserei durchsetzte. Dennoch hat sich die Bewegung schon nach wenigen Jahren als Illusion erwiesen. Es hat 67 begonnen und war 70/71 faktisch schon vorbei.“
Als Rühmkorf 1971 von einem Amerikaaufenthalt zurückkam, existierte die APO nicht mehr. Ein Selbstzermahlungsprozess hatte die viel versprechenden Ansätze zunichte gemacht. „Gruppen und Grüppchen lagen miteinander im Streit, lauter Alleinvertretungsansprüche sprachen der Idee der Solidarität Hohn.“ Durch Literaten, die in dieser Richtung mitmachten, wurde die Literatur selbst verabschiedet, der Literatur wurde der Abschiedsbrief ausgestellt, und die Paten der Bewegung wurden ziemlich unsanft abserviert. Dann war es schwer, erinnert sich Rühmkorf, „man musste sich wieder auf seine eignen Sachen besinnen und seine Knochen zusammensammeln“.
Nicht zum ersten Mal passierte es, dass ein „soziales Integral“ wie eine Seifenblase zerplatzte. Dennoch, so sieht Peter Rühmkorf es heute, sind die Denkanstöße von damals nicht folgenlos geblieben. Sie setzten vieles in Gang, was heute aus dem öffentlichen und auch privaten Leben nicht mehr wegzudenken ist, beispielsweise die Wohngemeinschaften, das Demonstrationsrecht, die Emanzipation der Frauen, die fehlende Autoritätshörigkeit, eine freiere Erziehung. „Ja, doch etwas ist geblieben“, sagt Peter Rühmkorf, schenkt uns noch einen guten Tropfen nach, lehnt sich im Sessel zurück und schaut versonnen dem Rauch der Zigarette nach.
Ich möchte von ihm noch gerne erfahren, was die Verleihung des Büchnerpreises, des bedeutendsten bundesdeutschen Literaturpreises, für ihn bedeutet habe. Seine Augen blitzen vergnügt hinter den Brillengläsern. „Ich habe das gerne als Gelegenheit genommen, um mal wieder eine Rede zu halten. Das habe ich immer gerne getan. Ich hatte so lange zur Lage der deutschen Dinge nichts gesagt, oder nur ganz wenig. Deshalb habe ich diese Gelegenheit gerne wahrgenommen, meine Gedanken dazu mitzuteilen.“
„Und Büchner selbst“, frage ich.
„Büchner ist natürlich eine ganz unvergleichliche Größe“, antwortet er, wieder ernst geworden. „Unvergleichlich heißt, dass er auch als ein Mensch, der jung gestorben ist, schon so früh weit ausgebildet war. Da ist ein wirkliches, bedeutendes jugendliches Genie. So war das bei mir ja keineswegs!“ Peter Rühmkorf lacht. „Bei mir hat sich alles langsam herangebildet, in Etappen. Trotzdem gibt es verwandtschaftliche Züge, auch über die Zeiten und über die Altersströme hinweg. Bei aller Unvergleichlichkeit eine Verwandtschaft an Neigungen, wenn man zum Beispiel den ,Hessischen Landboten‘ nimmt. Was da an sozialen Umwälzungen drinsteckt!“
„Peter Rühmkorf – also wie Georg Büchner ein Revolutionär?“, stelle ich als Frage in den Raum.
„Ein Revolutionär, ja, aber mit allen Skrupeln und aller Skepsis, die man gegenüber einem revolutionären Prozess haben kann.“ Trotzdem sei Büchner ein Mann des sozialen Engagements gewesen, bei aller Skepsis. Zwei Seelen hätten in seiner Brust gewohnt: die VerzweifIung an der Revolution und das Bedürfnis nach Umwälzung. „Fast schließt sich das aus“, sagt Rühmkorf, „aber als Widerspruchsträger muss man mit beidem umgehen.“
Und obwohl sich so viele revolutionäre Ideen als nicht realisierbar erwiesen haben, hat Peter Rühmkorf nicht vom Gedanken der Notwendigkeit einer sozialen Veränderung abgelassen. Es gab sie ja auch, die „Frühlinge“, die „Rosen-Revolutionen“ in vielen Nationen. „Viele Hoffnungen hat man geteilt,“ sagt er wehmütig, „die sich als Illusionen herausgestellt haben!“
Man hat Rühmkorf als einen linken Patrioten empfunden. Schon lange vor der Wiedervereinigung hat er versucht, in das „andere Deutschland“ hineinzuwirken. Bei seinen Besuchen und Dichterlesungen in Ostdeutschland hat er sich um eine Annäherung bemüht. „Drüben habe ich immer die Meinung vertreten, dass es dort an Freiheit mangelt, und hier habe ich die Meinung vertreten, dass es an Gleichheit mangelt.“
Ein Reformsozialismus, aber nicht in autoritärer Form, wo das Gemeinwesen in Ketten gelegt wird, ist der politische Traum von Peter Rühmkorf. Auch von der politischen, gesellschaftlichen Wirksamkeit des Gedichts hört er nicht auf zu träumen. Wie Büchner einst formulierte, „Es kann mir aber niemand wehren, alles, was existiert, bei seinem Namen zu nennen“, so versteht Rühmkorf sein Leben und Dichten als absolut „rücksichtsloses Wahrheitsverlangen“, mit dem er seinen Lesern die Wahrheit und nichts als die Wahrheit zuruft. Nicht um Utopien und wirklichkeitsferne Paradiese an einen unerreichbaren Himmel zu malen, sondern immer noch in der Hoffnung auf konkrete, dem Menschen helfende Veränderungen in einer als unzureichend erlebten Wirklichkeit.
„Das ist eine uralte Geschichte“, gibt er mir zur Antwort auf meine Frage, ob Kunst einen Erziehungsauftrag habe. „Ich weiß es nicht. Aber wenn Kunst sagt, sie sei nur für sich selbst da, dann ist sie ganz bald isoliert – wird anämisch und immer lebensfremder, sie verliert jede Verbindung zum Leben und wird völlig uninteressant.“ Nach einer kleinen Pause fügt er hinzu: „Ich glaube, dass Kunst einen eigenen Verfassungsauftrag hat. Speziell die Lyrik ist dafür da, um den Menschen neu zu verfassen.“
Wie jedes künstlerisch strukturierte Gebilde schaffe sie einen eigenen Raum, gewissermaßen einen Handlungsraum. Diesen Handlungsraum bietet der Dichter Peter Rühmkorf an mit seinem unverwechselbaren Ton zwischen Hoffnung und Zweifel, Parabel und Reflexion, Romantik und Aufklärung, Realismus und Poesie, Groteske und Harmonie. Und wir, seine Leser, täten gut daran, auf diesen Apokalyptiker im Narrengewand, diesen modernen Vaganten zu hören, bevor es zu spät sein könnte.
Gerne hätte ich Peter Rühmkorf ein zweites Mal besucht, um mit ihm über die Zeit zu sprechen, die seit unserem ersten Treffen vergangen ist.
„Natürlich erinnere ich mich noch unseres ergiebigen Gesprächs in der Övelgönne, und wir wollen uns auch gern noch einmal treffen“, schrieb mir Peter Rühmkorf, und ich freute mich schon sehr auf unser Wiedersehen, auf die zu erwartenden lebhaften Gespräche. Grundlage dafür sollten – nach seinem Wunsch – seine neuen Bücher sein. Sonst, so schrieb er weiter „ist alles noch so schöne Parlieren nur Haschen nach Wind“.
Doch das Erscheinen der Bücher ließ auf sich warten, und dann kamen plötzlich so viele Aufgaben und Anfragen, die an Peter Rühmkorf herangetragen wurden, dass er mir mit aufrichtigem Bedauern doch noch einen Absagebrief schicken musste. „Ich krieg schon ’n richtigen Beamtenton vor lauter Müdigkeit und Kraftlosigkeit … mein Kopf ist wüst und leer.“
Ich sehe ihn also, während ich nun schreibe, in Gedanken vor mir, wie er aus seinen mal melancholischen, mal verschmitzt blickenden Augen hinter den Brillengläsern hinausschaut auf die EIbe, die unterhalb seines Wohnsitzes träge vorüberfließt und die er in vielen Gedichten, besonders aber auch in seinem Tagebuch Tabu I in zärtlichen Tönen besingt. Ich sehe ihn, wie er seinem Zigarettenrauch hinterhersinnt, ein bisschen erschöpft, manchmal auch ein bisschen traurig, denn depressive Stimmungen kennt er durchaus, auch wenn er so freundlich lächeln kann. Und ich hoffe dabei, dass es hauptsächlich die viele Arbeit ist, die ihn an mich hat schreiben lassen: „Ich bin nur noch ein verglimmender Zigarettenstengel.“
Inzwischen habe ich Peter Rühmkorfs beide neuen Bücher vor mir liegen. Ein (auch äußerlich) sehr schöner Gedichtband mit „vorletzten Gedichten“, wie er untertitelt ist, Wenn – aber dann und die reich erweiterte Ausgabe seiner 1972 erschienenen Sammlung von Essays und autobiographischer Prosa Die Jahre, die Ihr kennt, die als erster Band einer Werksausgabe erschienen ist. Dieser bereits bei ihrem ersten Erscheinen als epochal gefeierten Autobiografie wurden von dem Herausgeber Wolfgang Rasch zahlreiche Bildbelege und unveröffentlichte Lebensdokumente aus dem Privatarchiv Peter Rühmkorfs beigefügt, sodass sich aus diesem Werk nun noch umfassender die private Geschichtsschreibung eines dem Leben und seiner Zeitgebundenheit stets sich bewussten kritisch reflektierenden Autors ablesen lässt.
Haltbar bis Ende 1999 hat Peter Rühmkorf einen Gedichtband genannt. Es ist typisch für diesen modernen Vaganten, so mit dem Verfall zu spielen, ja zu liebäugeln. Aber es sind ja nur vorletzte Gedichte, die er uns übergibt; also wird er weitermachen, weiterdichten, natürlich – denn anders kann er nicht: „Freund, wenn das Leben als solches / dich direkt bestürmt, berennt, / kann das Wort sich nur mitreißen lassen.“ („Formal nicht zu fassen“)
In seiner Trauer über die Heillosigkeit der Welt gegen den Ansturm von „Nichtigkeitsschaudern“ versucht Peter Rühmkorf nun schon seit langer Zeit „dem Lebewohl paar letzte Farben ab(zu)gewinnen, die man noch nie so sah“. Immer wieder krempelt er die Ärmel hoch, stellt sich den ihn oft überschwemmenden Welteindrücken in der nur ihm eigenen Poesie eines Aufrüttlers und Ducheinanderwirblers, Artisten und Possenreißers, eines melancholischen Liebenden, dem in diesen neuen, späten Gedichten der Abschied, das Alter ganz mächtig die Mähne zaust. Aber zum Glück hat er ja seinen Hut, mit dem man ihn kennt. „Solch ein Schweißband hält nämlich die Gedanken viel besser zusammen.“
Doch, Abschiedsstimmung der dem Ende zueilenden Jahre ist aus allen Versen seines Gedichtbandes Wenn – aber dann herauszuhören. Frech sind sie noch immer, nie dem Zeitgeist opportun, aber von einer noch größeren Zärtlichkeit für die kleinen Glücksmomente durchwirkt.
Ach, Abschied, oder was ist,
und wohin verzieht sich der Bogen
des gerade begonnenen Jahrs?
Eben noch diesen süßen Sauerstoff durch die Nüstern gezogen
Und – fahrengelassen – das war’s.
… Aber es war schon schön, eine frischbegrünte
Hasel gegen das altgediente
Grün des Efeus zu sehn.
Sicher und virtuos schmiedet Peter Rühmkorf seinen Wortwitz, seine Wahrsprüche in scheinbar kinderleichte gereimte Strophen. Bei ihm ist auch noch das Schwere stets leicht gesagt.
Noch ein Ruck und den Hut auf die Haare,
eine Primel schräg an den Hut, es sind auch die späteren Jahre
manchmal für ein paar Stunden gut.
… Zwar du läufst auf dem äußersten Tropfen,
was man leicht beim Sinnieren vergißt.
Aber was, wenn das Herz zum Klopfen
so unhaltbar entschlossen ist?!
Was so federleicht, so spielerisch daherkommt im Gedicht, ist Extrakt harter, schweißtreibender Arbeit. Peter Rühmkorf ist gierig und emsig, die Tausende von disparaten Einzeleinfällen, die Anwehungen von Elementarteilchen aus seiner Umgebung, aus menschlichen Begegnungen, aus Gedankensplittern zu politischen und sozialen Schieflagen zu sammeln und sie in Form zu bringen.
Aus spontanem Reagieren auf die Reize der Außenwelt und des eigenen Innenlebens filtert Peter Rühmkorf in einem Kristallisationsprozess ohnegleichen „poetischen Leuchtstoff“, und seine dichterische Arbeit sieht er darin, diesen vielen verschiedenen „Kollisionsfunken“ im „allgemeinen Kommunikations-Blabla ein individuell behauchtes Aha“ entgegenzusetzen. Wie meisterlich er dieses Metier beherrscht, davon zeugen auch diese Gedichte wieder.
In allem, was er schreibt – Gedicht, Essay, Rede oder Tagebuch – erweist sich Peter Rühmkorf als unermüdlicher Wahrheitssucher. In den seismographischen Aufzeichnungen all dessen, was ihm und seinen Zeitgenossen im Hier und Jetzt widerfährt, verlässt ihn nie sein sicheres Gespür für Widersprüche, Anmaßungen und Heuchelei. Besonders in seinem Tagebuch Tabu I – dieser Titel ist durchaus doppeldeutig zu verstehen – nimmt Rühmkorf kein Blatt vor den Mund. Derart ungeschützt, wie sich hier ein Mensch der Öffentlichkeit preisgibt mit seinen Schwächen und Gebrechen, seinen Gedanken über Mitmenschen, zumal auch bekannte und „berühmte“, habe ich Vergleichbares noch nicht gelesen. Das Tagebuch umfasst die Jahre 1989-1991, die Schicksalsjahre der Wiedervereinigung Deutschlands, ist Chronik jener Epoche, in der sich die Hellsichtigkeit Rühmkorfs zeigt, mit der er schon in den Noch-DDR-Zeiten die Anzeichen einstürzender Mauern registriert, sich dann aber der anschließenden Euphorie skeptisch entzieht. Die monumentale Sammlung der seit 1971 15000 Seiten umfassenden Tagebuchaufzeichnungen, die ursprünglich als Stoffsammlung für einen ZEIT-Roman dienen sollten (und wenn als Tagebuch, dann erst posthum zu veröffentlichen), hat Peter Rühmkorf zum verdaulichen Format eines 620 Seiten-Buches komprimiert. Hierin wie auch in Die Jahre, die Ihr kennt zeigt sich die Durchlässigkeit der Gattungsgrenzen. Ein manischer „Weltmitschreiber“ ist er, immer im Bestreben, Licht- und Schattenseiten gleich stark zu erfassen, dialogisch und dialektisch auf das zu reagieren, was ihn beunruhigt. Was Peter Rühmkorf dabei an Selbstmitteilung offenbart, setzt auf den „Teilhabenerv“ des Lesers und den Resonanzboden, der erst Wirkung entfalten kann.
„Das ganze gesellschaftliche Leben ist ja darauf angelegt, das Ich zu einem platten Nummernschild herunterzuwalzen, das gebrauchsfertig ist und funktioniert.“ Gerade aber einem solchen bloßen Funktionieren widersetzt er sich mit jeder Zeile, jedem Vers. „Wer schreibt überhaupt?“, fragt er und gibt selbst die Antwort: „Es schreibt doch nicht der ausbalancierte Mensch! Zu Papier drängt es doch nur den Beunruhigten, den Gefährdeten.“ Als solchen hat er sich ausgewiesen seit seinen Anfängen, als er ab 1951 für die Zeitschrift Zwischen den Kriegen seines Freundes Werner Riegel, danach für die Zeitschrift konkret schrieb und in Die Jahre, die Ihr kennt den zerstobenen Hoffnungen der 68er-Aufbruchszeit nachtrauerte. Dabei ist Peter Rühmkorf immer zutiefst Menschenfreund geblieben, ein „Meliorist“, der daran glaubt, dass die Menschheit noch zu verbessern sei, nicht so sehr durch spektakuläre Revolutionen, als vielmehr auf dem Weg der kleinen Schritte. Früh schon hat er dem Glauben an alle „Ismen“ abgeschworen. Ihnen setzt er sein dichterisches Werk entgegen, das in der Schonungslosigkeit sich selbst gegenüber, im Verständnis, in der Skepsis, in der Wachsamkeit für den anderen sich allein der Wahrheit verpflichtet fühlt.
Peter Rühmkorf, dieser dem Leben leidenschaftlich verhaftete Dichter, ist lange Jahre vom Literaturbetrieb nicht eben mit Anerkennung verwöhnt worden, obwohl ihm zahlreiche Preise und sogar der Ehrendoktorhut verliehen wurden und er sich daran freuen kann, dass seine bissig-traurigen Lieder nicht im Nichts verhallt sind.
„Nicht aufgeben, Meister“ und „Bleib erschütterbar und widersteh“, diese sich selbst verordneten Imperative sind auch heute noch des Dichters täglicher Ansporn, Kunst zu formen mit Sprache. „Einreden auf den Menschen / mit zauberischer Stimme, dass er was werde“, das tut er in seinem unverwechselbaren Ton von Schnoddrigkeit gemischt mit Melancholie, Ironie gewürzt mit Utopie, Groteske durchsetzt mit Heilsverlangen.
Man kann ja die Augen nicht unentwegt
vor den eigenen Gedanken niederschlagen;
lieber noch mal richtig reinbeißen in die Welt
…
Weil doch das langsame Wegblättern
ausnahmslos uns alle betrifft
und das große Dahinfahren auch
…
Gestreckte Augenblicke – ziemlich unscharf schon – noch etwas in die Länge ziehen
…
Aber nur jetzt nicht vorsichtig werden („Überraschendes Wiedersehen“).
Denn, so sieht es Peter Rühmkorf, Kunst ist dafür da, angesichts der Tatsache, dass wir sterblich sind, dass nichts auf dieser Welt in Ordnung ist, das Zentripetale zusammenzuhalten, das Ungleichgewicht etwas mehr in die Balance zu bekommen und für den Menschen ein bisschen Harmonie aufleuchten zu lassen. Doch bei Rühmkorf erwartet uns kein Harmoniegesäusel, im Gegenteil, er haut kräftig auf die Pauke und in die Kerben, die dem Lebensbaum/Weltenbaum schon geschlagen sind. Er verschließt die Augen nicht vor Dreck und Abfall und übersieht dabei dennoch nicht die beatmeten Augenblicke.
„Das Dennoch ist die Gedankenfigur, die mein Leben beherrscht“, hat er einmal gesagt. Vielleicht ist dieses Dennoch sogar noch ein bisschen elementarer geworden für ihn, dessen Leben spürbar die besten Jahre hinter sich gelassen hat. „Einmal noch über das Vorhandene hinaus … pfeif jedem bunten Vogel, dem du gleichst – / Mehr hast du nie gewollt.“ Es ist so etwas wie ein zärtlicher Trotz, dem unvermeidlichen Lebensende entgegengestellt, gestemmt, „im Augenblick die Dauer zu beschwören“, die Rühmkorf in betörendergreifende Bilder kleidet, wenn auch der Spott und die Selbstironie stets griffbereit sind.
Paar verräterisch gelbe Blätter schon wieder
hoch oben im Baum,
ach, die Welt
… Wenn da wenigstens irgend etwas über den Horizont,
ich meine, herausragen würde.
Eine spankistenblonde Sonne
oder eine Idee.
Statt wie ein Mistkäfer immer nur so weiter
seine Kugel vor sich herrollen müssen. („Ungemütlicher Tag“)
Oder in dem Gedicht „Nur aus Sport“:
Leider, es ist so, das Jahr verblüht sich,
nur der Efeu dreht sein Ding in Ruh,
doch du merkst, bei jeder Windung zieht sich
eine andre Schlinge
enger zu.
Es ist nicht verwunderlich, wenn Peter Rühmkorf sagt, in seinen Gedichten sei er noch immer am meisten er selbst. Nur ein Nie-Saturierter, ein Alles-in-Frage-Stellender verschreibt sich mit Haut und Haaren der Kunst. Einer Kunst indes, die nicht von Kulturverwaltern reglementiert wird, sondern die sich ihre eigene Freiheit gibt und dadurch niemals in den Dunstkreis von Ideologien begibt. Kunst muss Wagnis sein, soll sie sich nicht etablieren. Darin sieht Rühmkorf die Chance seiner Dichtkunst: Indem er sich nicht arrangiert mit Gesellschaft, sich nicht abfindet mit Bestehendem und scheinbar bereits Erreichtem, sondern weiterdrängt mit nimmermüden Fragen, wie es besser werden könnte. Vorgefundene Antworten, ein vorgefasstes Ich haben Entwicklung schon hinter sich gelassen. Dies aber wäre das Ärgste für einen Utopisten wie Peter Rühmkorf, der letzten Endes noch immer darauf hofft, dass der lyrische Monolog im Gedicht zu einem „sozialen Plural“ wird.
Peter Rühmkorf hat sich ein Leben lang für die subjektive Position entschieden. In Tabu I gibt es kein Thema, kein Ereignis, was nicht notierenswert, kommentierenswert ist: Spaziergänge an der EIbe, die Passanten, die junge Freundin von nebenan, die ihn in ihrer Wohlansehnlichkeit erfreut, Liebespaare, die Bäume, der Himmel, die Wolken, das Essen, die Verdauung, Musik-, Tabak-, Alkoholgenüsse, Einschlafschwierigkeiten, Hamburger Straßen und Plätze, Freunde, Kollegen und Kritiker, Ellbogenkapitalismus und freiheitlicher Sozialismus. Und obwohl er allein aus seiner Perspektive die Welt ins Visier nimmt, nimmt er dabei sich selbst nicht allzu wichtig. „Gestern Tag so hin. – Ausgeschlafen. Gepussel. – Unausgeschlafen. Bisschen Zeugs.“ Zwischendrin Gedichte. Und die Arbeit daran. Trotzdem: „Dieses ganze Dichter-Gedöns, das mir fremd wie irgendwas ist.“ Stattdessen: „Schiffe betrachtet / bewundert“ – und irgendwann zu Dichtung verarbeitet.
Und dann die Aperçus, eine Spezialität von Peter Rühmkorf. Tabu und Die Jahre sind voll davon, und man möchte sich daran forthangeln wie an einer Himmelsleiter: „Morgen ganz weiß mit drei-vier-fünf lila eingekreuzten Streifen darin, dann paar graue Feudelwischer beziehungslos drüberhin. – Die Elbe um 10.00 morgens wie eine hingeschmissene Glasscheibe. – Paar junge gebrechliche Flocken, zag, aus geizigem Himmel. – Der Himmel als Scheuerlappen mit ein paar lichten Rissen.“
Und die Paradoxien: „Keine Antwort auf die mich wirklich bewegenden Fragen nach einer unbegreiflich sinnreich konstruierten sinnlosen Welt. – Das schwierigste: sich mit einem lachenden Auge über das andere lustig machen. – Und immer wieder mal die Frage nach einem sinnvoll geführten Leben in einer wahnsinnig gewordenen Welt.“
Der Dichter Peter Rühmkorf dichtet und wird weiterdichten/verdichten, noch mit seinem vorletzten Atemzug. Er wird seine poetischen Finger auf die Wunden der Menschheit, der Gesellschaft legen, um den Laschen, den Lauen, den Angepassten zu zeigen, dass es so nicht weitergeht, wie es geht.
Was bleibt? Wer weiß. Vielleicht ein allerletzter Pfiff
den Saum der Welt noch etwas nachzuschrägen,
wenn ihr so wollt, Wollust mit Wellenschliff
So kommt die Kunst – auf Zeit – der Ewigkeit entgegen.
Die alten Verszeilen gelten ganz sicher noch für ihren Schöpfer und sollten auch für uns Leser Maßstab sein:
Ich aber nenne diesseits und jenseits der Stirn
außer der Liebe nichts,
was mich hält und mir beikommt.
Aus: Ilka Scheidgen: Fünfuhrgespräche, Kaufmann Verlag, 2008
Verslust, ewig
Man sagt mir, der Dichter Rühmkorf sei letzte Nacht in seinem Haus in Schleswig-Holstein gestorben. Ich glaube das nicht. Ein Mensch gleichen Namens mag wohl dahingegangen sein – das kommt vor, wir können nicht ewig am Leben bleiben, das bekommen wir schon im Kindesalter eingeschärft, und da wir Menschen sind, lernen wir, jederzeit damit zu rechnen.
Der Dichter Rühmkorf aber kann nicht gestorben sein, dazu war er zeitlebens zu quicklebendig. Diese Munterkeit in Form sprunghaftester Verslust war geradezu ein Markenzeichen des alten Kämpen. Gottfried Benn hat ihn lange genarrt – er war immer schon dort, wo der junge Rühmkorf um die Ecke bog, alle anderen aber hatte er mit seiner Grashüpfertechnik früh abgeschüttelt. In den goldenen Jahren der alten Bundesrepublik war er dann endlich so frei wie ein Jazztrompeter, der aus Übermut in seinen Improvisationen manchmal die Klassiker durchklingen lässt, sogar mit einer gewissen Wehmut, aber jederzeit bereit, sie mit einem einzigen schrillen Ton zu verscheuchen.
Milder Blick aus den Höhen
Ein wahrer Springinsfeld, ein freier Geselle – und ein feiner dazu. Nie wäre er einem Andersgleichgesinnten, einem Philharmoniker von der anderen Straßenseite, noch dazu einem Jüngeren, zu nahe getreten. Das Äußerste wäre ein ironisches Zirpen gewesen, ein milder Blick aus den Höhen, den hier schon rein körperlich gegebenen Höhen avancierter Vergeblichkeit. Weggefährten freilich und alte Mitstreiter haben es anders erfahren. Es gehörte zum Temperament dieses Mannes, dass er austeilen konnte.
Er war ein Satirendichter, jemand, der die moderne Gesellschaft persönlich nahm, so über alle Kulturkritik hinaus grimmig persönlich wie der späte Heine, der beim Auftauchen der Dampflok einen Nachruf schrieb auf das arme Pferd. Das war der Skeptiker Rühmkorf, doch der Erotiker folgte sogleich. Ihm und seinen Triumphen und Niederlagen konnte man noch bis in die höchsten Töne des Alterswerkes folgen. Das Lied der Libido blieb ihm immer erhalten. Die politischen Überdrehungen der Linken dagegen hat er so lange mitgemacht, wie ihm das Karussellfahren Spaß machte, danach ist er einfach abgesprungen und querfeldein gelaufen.
Allein der Name: Er ist mir immer wie eine gemeinsame Erfindung von Klopstock und Morgenstern erschienen. Zum Rühmen geboren, zum Korfen bestimmt. Das Korfen war eine Spezialform der geistigen Fortbewegung, ein lyrisches Grooven, das als melancholisches Säbelrasseln daherkam, eine versponnene und zugleich hochreflektierte Variante des LmaA (wem die Abkürzung nichts sagt, der muss sich, aus Gründen der Pietät, für diesmal gedulden). Übermut und Entsagung, Zartsinn und Draufgängerei halten sich in den meisten seiner Verse die Waage. Peter Rühmkorf ist nicht gestorben. Er ist nur eben mal tot.
Durs Grünbein, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 11.6.2008
Peter Rühmkorf-Tagung vom 23. bis zum 26.10.2009: Im Vollbesitz meiner Zweifel – Peter Rühmkorf
Gespräch I – Walter Höllerer spricht mit Peter Rühmkorf über seine Schulzeit
Gespräch II – Das Gespräch dreht sich um Rühmkorfs Studienzeit
Gespräch III und Lesung I – Peter Rühmkorf spricht über seine Zeit bei der Zeitschrift Konkret und liest Lyrik
Gespräch IV und Lesung II – Walter Höllerer spricht mit Rühmkorf über Politik und Rühmkorf liest Lyrik
Gespräch V und Lesung III – Ein Gespräch über Peter Rühmkorf als Poet und Poetologe. Noch einmal liest Rühmkorf Lyrik
Lesung und Gespräch VI – Peter Rühmkorf liest Gedichte aus dem Band Kleine Fleckenkunde, dann beantwortet er Fragen aus dem Publikum
Heinz Ludwig Arnold: Meine Gespräche mit Schriftstellern
Fakten und Vermutungen zum Herausgeber
shi 詩 yan 言 kou 口
Zum 70. Geburtstag des Autors:
Hajo Steinert: Ein Leben in doll
Deutschlandfunk, 24.10.1999
Zum 75. Geburtstag des Autors:
Hanjo Kesting: In meinen Kopf passen viele Widersprüche
Sinn und Form, Heft 1, Januar/Februar 2005
Zum 10. Todestag des Autors:
Ulrike Sárkány: Zum zehnten Todestag des Poeten Peter Rühmkorf
ndr.de, 7.6.2018
Zum 90. Geburtstag des Autors:
Stiftung Historische Museen Hamburg: Laß leuchten!
shmh.de, 20.7.2019
Julika Pohle: „Wer Lyriks schreibt, ist verrückt“
Die Welt, 21.8.2019
Vera Fengler: Peter Rühmkorf: Der Dichter, die die Welt verändern wollte
Hamburger Abendblatt, 21.8.2019
Volker Stahl: Lästerlustiger Wortakrobat
neues deutschland, 22.8.2019
Hubert Spiegel: Der Wortschnuppenfänger
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 24.8.2019
Anina Pommerenke: „Laß leuchten!“: Rühmkorf Ausstellung in Altona
NDR, 20.8.2019
Maren Schönfeld: Herausragende Ausstellung über den Lyriker Peter Rühmkorf
Die Auswärtige Presse e.V., 21.8.2019
Thomas Schaefer: Nicht bloß im seligen Erinnern
Badische Zeitung, 26.8.2019
Willi Winkler: Der Dichter als Messie
Süddeutsche Zeitung, 28.8.2019
Paul Jandl: Hanf ist dem Dichter ein nützliches Utensil. Peter Rühmkorf rauchte seine Muse herbei
Neue Zürcher Zeitung, 11.9.2019
„Laß leuchten!“ Susanne Fischer über die Rühmkorf-Ausstellung im Schiller-Nationalmuseum.
„Laß leuchten!“ Friedrich Forssman über die Rühmkorf-Ausstellung im Schiller-Nationalmuseum.
„Laß leuchten!“ Jan Philipp Reemtsma über die Rühmkorf-Ausstellung im Schiller-Nationalmuseum.
Fakten und Vermutungen zum Autor + Archiv + KLG + IMDb
Georg-Büchner-Preis + Johann-Heinrich-Merck-Preis
Interview 1 + 2 + 3
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum +
Autorenarchiv Susanne Schleyer + Galerie Foto Gezett
shi 詩 yan 言 kou 口
Nachrufe auf Peter Rühmkorf: Spiegel ✝ Die Welt ✝ FAZ 1 + 2 ✝
literaturkritik.de 1 + 2 ✝ Die tageszeitung ✝ Die Zeit ✝
Badische Zeitung ✝ Haus der Literatur ✝ Tagung ✝ Stufe ✝
Film über Peter Rühmkorf – Bleib erschütterbar und widersteh. 1/2
Film über Peter Rühmkorf – Bleib erschütterbar und widersteh. 2/2


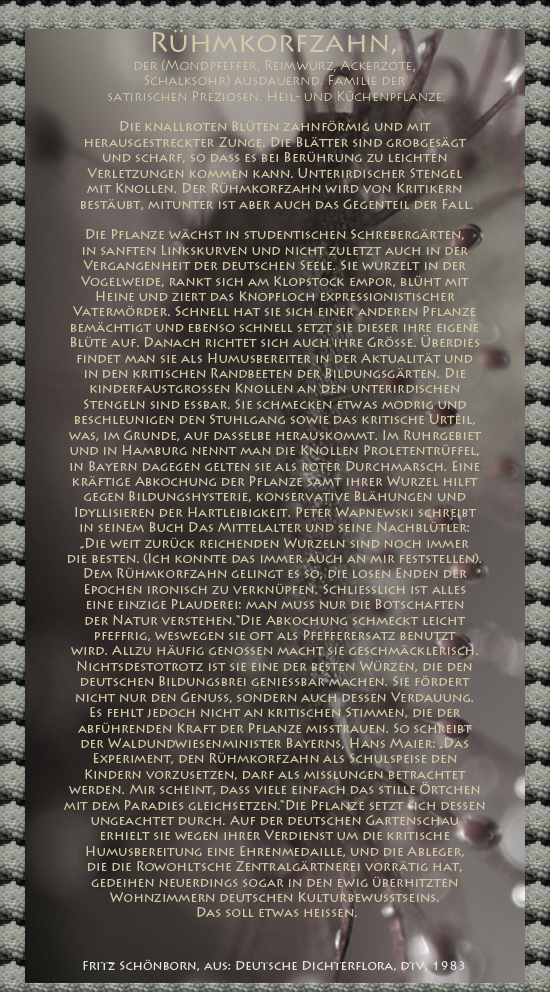
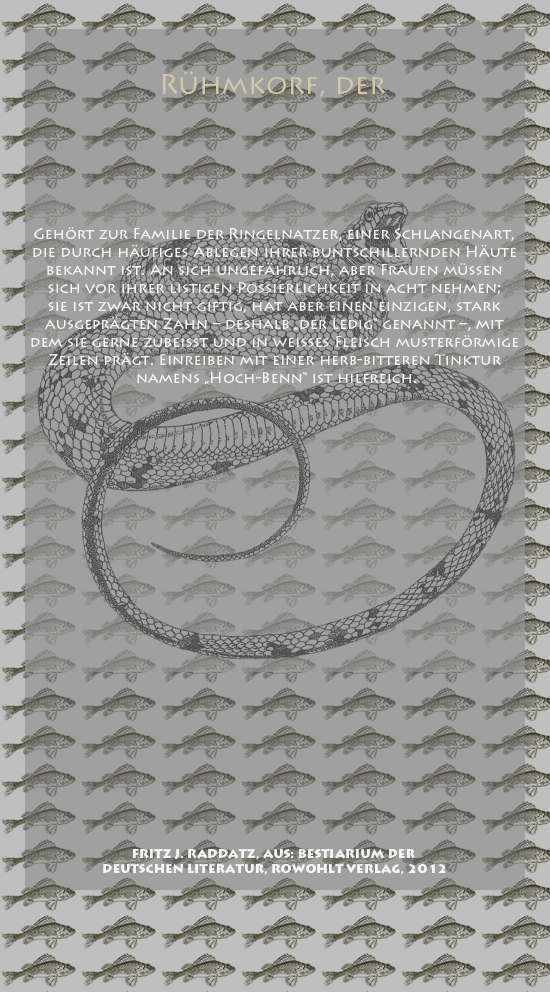
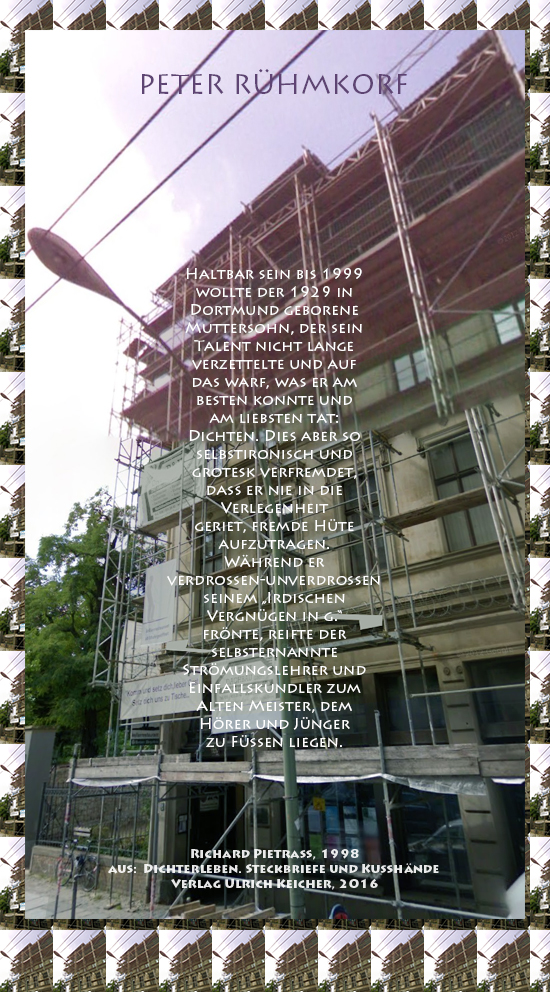








Schreibe einen Kommentar