Theodor Däubler: Das Sternenkind
MILLIONEN NACHTIGALLEN SCHLAGEN
Die Sterne. Blaue. Ferne.
Ein Flammensang der Sterne!
Millionen Nachtigallen schlagen.
Es blitzt der Lenz.
Myriaden Wimpern zucken glühend auf.
Das grüne Glück von Frühlingsnachtgelagen
Beginnt sein eigenbrüstiges Geglänz.
Die lauen Schauer nehmen ihren Zauberlauf:
Millionen Nachtigallen schlagen.
Erkenne ich ein freundliches Gespenst?
Ich werde mich im Ernst darum bewerben.
Der kleinste Wink will sich ins Wittern kerben:
Wer weiß, wann meine Träumlichkeit erglänzt?
Gespenster gleichen unsern sanften Tieren,
Sie können schnell den Samt der Neigung spüren.
Sie heben, schweben, weben sich heran,
Und halten uns unfaßbar sacht im Bann.
Ich will die Lichtgewimmelstille nicht verlieren,
Ein altes Walten muß sich bald aus Sanftmut rühren.
Millionen Nachtigallen schlagen.
Die ganze Nacht ermahnen uns verwandte Stimmen.
Es scheint ein Mond geheimnisvoll zu glimmen.
Doch ist zu warm die Nacht, voll atmendem Behagen!
Myriaden brunstbewußte Funken suchen sich im Fluge,
Sie schwirren hin und her und doch im Frühlingszuge.
Das Lenzgespenst, das Lenzgespenst geht um im Hage!
Es kann der Laubwald wandern und sich selbst erwarten,
Das schwankt und walzt nach allen alten Wandelarten;
Es lacht die Nacht: der Wagen wagt, es wacht die Waage.
Es blitzen da Myriaden tanzvernarrte Fragen −
Millionen Nachtigallen schlagen.
Nachbemerkung
Das Sternenkind erschien erstmals 1916 als Band 188 der vier Jahre zuvor mit Rilkes Dichtung Die Weise von Leben und Tod des Cornets Christoph Rilke eröffneten Insel-Bücherei. In den wenigen Jahren ihres bisherigen Bestehens hatte sich diese Bücherei den Ruf einer preiswerten und ästhetisch anspruchsvollen, populären Reihe erworben, und Däubler sah mit der Aufnahme in die Insel seinen größten Wunsch erfüllt, „nunmehr auch der Nation zugeführt zu werden“. Nachdem er die ersten Exemplare des Insel-Buches erhalten hatte, schrieb er voll Freude und Dankbarkeit an Katharina Kippenberg:
[…] heute ist Geburtstag, denn ich habe meine blaubesternten Bändchen bekommen. Möge das Sternenkind noch recht, recht vielen Freude machen, denn so ists gemeint. Die Luxusausgaben sind mir im Grunde entsetzlich. So ein Insel-Büchlein, ist, ich weiß es von mir, eine ,Insel‘ im Leben, in den endlosen Büchereien […].
Der kleine Band war Däublers erste Publikation im Insel-Verlag und brachte eine Auswahl aus dem bis 1916 entstandenen lyrischen Werk. Den Titel der Sammlung gab ein Gedicht aus dem „Ararat“-Zyklus des rund 30.000 Verse umfassenden Epos Das Nordlicht, das 1910 als sogenannte Florentiner Ausgabe in drei Bänden erschienen war. Diese phantastisch-visionäre Kosmogonie mit ihrer Botschaft vom Sieg des Geistes in der Welt hatte Däublers Ruf in der literarischen Öffentlichkeit begründet. Einen besonderen Widerhall fand der Dichter unter Vertretern der expressionistischen Bewegung, die ihn als Vorkämpfer und Mitstreiter begrüßten: Else Lasker-Schüler besang ihn als „Fürst von Triest“, Johannes R. Becher widmete ihm sein Gedicht „Brudertag“, und die von Franz Pfemfert herausgegebene Zeitschrift Die Aktion reservierte im März 1916 „dem großen Theodor Däubler“ ein ganzes Heft.
Neben drei weiteren Gedichten aus dem umfangreichen Epos enthält der Insel-Band auch Verse aus der 1916 bei Georg Müller in München publizierten Hymne an Italien, in der Däubler Landschaften und Städte des Mittelmeerraumes besingt. Der weitaus größte und das künstlerische Bild der Sammlung maßgeblich prägende Teil entstammt dem 1915 im Hellerauer Verlag von Jakob Hegner veröffentlichten Buch Der sternhelle Weg, das eine Reihe kleinerer, in den Jahren 1908-1915 entstandener Gedichte vereint. Darüber hinaus enthält Das Sternenkind bereits die „Sieben Gedichte“, die sich erst in der zweiten, vom Insel-Verlag 1919 besorgten, erweiterten Auflage des Sternhellen Weges finden.
Zeitgenössische Reaktionen auf das Insel-Buch belegen, daß Däubler eine gelungene Auswahl getroffen hatte. Hugo von Hofmannsthal schrieb am 23. Mai 1916 an Katharina Kippenberg :
[…] ich lag etwas elend (nicht ernstlich krank) im Bett als die neuesten Inselbüchlein kamen, griff nach dem Däubler und war von der Schönheit von drei, fünf, zehn dieser Gedichte ganz gefangen. Da gibts keinen Zweifel, das ist schön, neu, original und schön, merkwürdig, bizarr und schön, vor allem schön. Es ist etwas: es ist eine neue Welt. – Ich habe das Nordlicht von Däubler oft in der Hand gehabt, auch Partieen daraus sehr merkwürdig gefunden – aber das konnte ich nicht finden, was ich hier finde: das Schöne, das bezwingt, bindet u. beglückt. Mir ist doch, er ist nun erst zu seiner eigenen Schönheit durchgebrochen […].
Betonte Hofmannsthal derart die „eigene Schönheit“ der im Sternenkind vereinten Gedichte, verwies ein anderer Kritiker mit Nachdruck auf die ungewöhnliche sprachkünstlerische Leistung:
Däublers lyrische Sprache ist wie die unterirdischen und astralen Kurven seines Geistes schwer zugänglich. Sie ist neu, kühn, futuristisch, expressionistisch, – wenn man darunter nicht modern, absichtlich, spitzfindig, krampfhaft versteht; sie ist konservativ, traditionell, klassisch im Gegensatz zu reaktionär, ideenlos, weimarisch. Erst dann wird man das Sternenkind fassen, wenn man alle Voreingenommenheit der Sprache, dem ,Gedicht‘ gegenüber ausgeschaltet hat […].
Diese Aussage findet sich in einer Rezension Wieland Herzfeldes, die im „Theodor Däubler-Sonderheft“ der Zeitschrift Neue Jugend (Oktober 1916) veröffentlicht wurde. Kurt Pinthus nahm mehrere der im Sternenkind und im Sternhellen Weg gesammelten Gedichte in seine repräsentative Anthologie Menschheitsdämmerung auf. Anläßlich einer Würdigung zum 50. Geburtstag von Däubler am 17. Juli 1926 bezeichnete er diese Gedichte als „lyrisch milde Gebilde von rührender Vollkommenheit, […] huschend wie leuchtende Salamander durch die zerklüfteten, aus den Himmeln herabgebrausten Blöcke seiner Ideendichtung“.
Das Sternenkind brachte es bis 1930 in fünf Auflagen auf 26.000 Exemplare und ist damit die erfolgreichste Lyrik-Publikation Däublers im Insel-Verlag, der in einem knappen Jahrzehnt sowohl das bereits bei Georg Müller und Jakob Hegner erschienene lyrische Werk in neuen, zum Teil gründlich überarbeiteten und beträchtlich erweiterten Ausgaben herausbrachte, als auch die Edition der später entstandenen Bücher Die Treppe zum Nordlicht (1920), Päan und Dithyrambos (1924) und Attische Sonette (1924) besorgte. „Ich bin ja so glücklich, wenigstens meine hauptsächlichsten Bücher auf ,der Insel‘ geborgen zu wissen“, schrieb der Dichter im November 1917 an Katharina Kippenberg, die zweifellos einen großen Anteil daran hatte, daß sich zwischen dem Verlag und Däubler so fruchtbare Beziehungen über einen längeren Zeitraum entwickeln konnten. Der Briefwechsel gibt Auskunft darüber, wie engagiert diese Frau, die auch den jungen Becher förderte, sich um Däubler bemühte und anderen gegenüber seine eigenwillige künstlerische Individualität verteidigte. Von Verständnis und ästhetischem Urteilsvermögen zeugen ihre Worte:
Wenn Däubler dichtet, so scheint er immer im Luftschiff zu fahren, wo die Erde merkwürdig zusammengeballt, in ihren einzelnen Linien und Gegenständen überschnitten und unerkennbar kraus unter ihm liegt. Die Stadt, das Haus, der Acker und der Bauer werden unheimlich unterschiedslos und gleichgültig. Die Maße des Himmels, der Gang der Sterne umso wichtiger. Manchmal macht er aber auch lange Spaziergänge durch dichtestes Markt- und Großstadtgewühl, das eigenartig aufflimmert – ganz futuristisch malerisch aussieht – in die Landschaft, wenig wertend, aber alles für seinen Standpunkt ausnutzend. Da ist es oft, als ob ein Baum vom Sturm gepeitscht würde, ganz silbrige Blätter bekäme und so sehr sich beugen müßte, daß seine Krone den Boden berührte, und plötzlich fühlt man eine ungeheure Verbundenheit aller Dinge und sieht, wie die Erde zur Wurzel eingeht, zur Krone aufsteigt und wieder die Berührung der Erde braucht, sich zu retten. Entfernte Dinge der Geschichte werden hineingebogen in unser modernstes Heute. Aber regiert wird von den Sternen aus und was die Erde dazutut, ist für ihn unwesentlich.
Diese Charakteristik erfaßt treffend einen Grundzug Däublerscher Dichtung, in der das Wort Stern neben Mond, Erde und Sonne zu den am meisten gebrauchten gehört. Ihr vom Dichter beabsichtigter Sinn ergibt sich aus einem weltanschaulich-ästhetischen Konzept, demzufolge Erde und Sonne ursprünglich eine Einheit bildeten, die im Verlauf der Entwicklung zerstört wurde. Die humanistische Botschaft des Dichters lautet:
Die Erde wird wieder leuchtend werden, aber die Völker sind verantwortlich, daß dieser Stern, der ein dunkler ist, einst der allerhellste sei […] es bleibt unsre Pflicht, die Erde zu sich, das heißt zu ihrem eigentlichen Licht zu bringen.
Innerhalb dieser Sicht erscheint die Sonne als Sinnbild des Geistes, und der sich seiner geistigen Verpflichtung bewußt werdende Mensch repräsentiert die treibende Kraft zur Aufhebung der noch existierenden Polarität von Erde und Sonne. In der Pseudo-Objektivität des selbst produzierten Mythos sucht Däubler seiner humanistischen Ideenwelt jenseits aller historisch-politischen Gegebenheiten objektive Geltung zu verschaffen. Er konstruiert ein kompliziertes Symbolsystem, das seine lyrische Bilderwelt durchdringt und den plastisch gestalteten Dingen und Erscheinungen der Wirklichkeit einen völlig neuen, häufig schwer erschließbaren Sinn verleiht. Begriffe wie Wald, Baum, Insel, Meer erhalten ihre poetische Sinngebung aus einem vom angenommenen Sonnenmythos bestimmten Bedeutungsgefüge: Wald und Baum beispielsweise werden zu Symbolen des Strebens nach dem Licht, und Inseln fungieren als Sinnbild der Sehnsuchtserfüllung, da in ihnen Sonne und Meer zu fester Materie verdichtet seien.
Aber ,die Sprache der Dinge ist‘ – nach einem Wort von Georg Maurer – „glücklicherweise unendlich“, und viele der so stark auf Sinnlich-Anschaulichem und Naturhaft-Dinglichem basierenden Gedichte Däublers besitzen ungeachtet ihres mehr oder weniger engen Zusammenhanges mit dem mythischen Konzept ein durchaus eigenständiges Leben und vermögen durch den sinnlichen Reichtum ihrer Bilderwelt, durch Farbigkeit und Musikalität der Sprache sowie durch Schönheit der Form dem Leser ästhetischen Genuß zu bereiten.
Hans-Jörg Görlich, Nachwort
Fakten und Vermutungen zum Autor + Archiv 1 + 2
Theodor Däublers Gedicht Berauschter Abend gelesen von Konstantin Wecker.

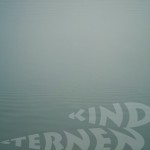








Schreibe einen Kommentar