Volker Braun: Gegen die symmetrische Welt
ARMSTRONG ALDRIN COLLINS
Drei von uns, 1000m
Über dem Meer der Ruhe
Mensch 1 m/s
Erhabne Metapher
Allein ohne Gott und die Welt
Gelenkt
Zwischen die Krater, die Fleischfüße
Tappen an Land
Weiße Tiere
Betend betend betend
In ihren Kokons: Serien-
Kolumbus, programmiert wie ein deutscher
Kirchenchor
Und funken ihr Bild
Hernieder, wo wir uns erkennen
An den göttlichen
Klimmzügen, kleiner
Schritt für einen Menschen, Schlußläufer
Des irdischen
Kampfs!
Und auf den Schirm schielen
Mit dröhnendem Magen
Hundefutter im Hals (20 %
Der Gesamtmenge), Harlems Halbmenschen
Geprügelt von härteren Fakten
Und an der Rampe die
Haderer, unter den Stöcken
Niedergeschlagen froh: Richtet den Blick
Auf die Erde! das entdeckte
Dunkel.
Während die größern
Schlächterkollektive, zwischen
Den Schüssen blinzelnd in die Sterne
Land Land Land
Gleichmachen
Dem Mond. Wo die Überirdischen jetzt
Starten, zündendes
Wort! ungebunden
Der Schwere der Befehle
Schöpfer im Funkschatten:
Mit einem Schub von 1590 kg reißt sie das Triebwerk aus der anziehnden Küste
Nach sieben vollen Minuten auf den
Vorgeschriebenen Strich. Und hinab-
Fahrend zu der Erde
Abhang, aus heiterem Himmel heim-
Trudelnd in die engren
Kreise, wo zwei mal zwei
Drei ist für die Armen
In die wirre
Atmosphäre. (Ach lös dich
Letzte Stufe
Von den leergebrannten
Sätzen.) Fallen
An Riesenschirmen spielerisch
In den Ozean, genannt der Friedliche
In den Hirnen der bläuliche Planet himmel-
Schreind schön. So die Erde
Sehn, und die Menschen würden
Sie schützen.
Lyrik
Seit seinem ersten Auftreten als Lyriker gilt Volker Braun (Jahrgang 1939) in der DDR als Propagandist des Sozialismus, als – wenn auch gelegentlich aufmüpfiger – „Chronist und aktiver Wegbereiter seiner am Aufbau des Sozialismus beteiligten Generation“, wie es im offiziösen Leipziger Schriftsteller-Lexikon heisst. Sein Stil wird als jugendlich forciert und oft subjektiv übersteigert charakterisiert, als wechselnd zwischen satirischer Ueberspitzung, sachlicher Verfremdung und preisendem Pathos. Auch in Brauns 1970 erschienenem Band Wir und nicht sie finden sich noch reichlich Anklänge an die Vorbilder Majakowski, Enzensberger und Brecht in Gedichten, die Stolz und Selbstbewusstsein artikulieren, das Hohelied der Arbeit im Sozialismus singen, Fortschritte und Aufbauleistungen in der DDR preisen und der Ueberzeugung Ausdruck geben, „im bessern / Teil der Welt“ zu leben. Freilich hatte Braun schon in jenen Gedichten den oft bramarbasierenden, nassforschen Ton ein wenig gedämpft, seine Stimme überschlug sich nicht mehr so oft wie früher in einem Pathos, das, bei aller subjektiven Ehrlichkeit des Gefühls, doch oft genug angelesen und nachempfunden wirkte.
In seinem jüngsten Lyrikband Gegen die symmetrische Welt – der Titel spielt an auf ein Hölderlin-Zitat – hat Volker Braun Gedichte aus den Jahren 1969 bis 1973 gesammelt, die zwar auch keinen Zweifel daran lassen, dass der Dichter weiterhin sozialistischen Heilserwartungen anhängt und sicher ist, in einem Gesellschaftssystem zu leben, dem die Zukunft gehört. Nur fragt er jetzt mehr als früher nach der Gegenwart, sieht schärfer die Diskrepanz zwischen der Realität des Heute und den Versprechungen auf ein besseres Morgen: „All unsre Erfolge: nur Abschlagszahlungen / der Geschichte“, sagt er, ein Marx-Wort aufgreifend, und er beginnt sein Buch mit der programmatisch gemeinten Aussage:
Ich lösche die Losung von meinen Wänden
Steig aus den Parolen wie ein Dieb
Zwar versteht Braun das lyrische Ich seiner Verse wohl noch immer als ein stellvertretendes Ich, aber er dürfte wohl kaum so emphatisch, wie er es früher gewiss getan hätte, Hermann Kants Behauptung zustimmen, wer in der DDR zu schreiben beginne, gründe quasi einen volkseigenen Betrieb. Stärker als zuvor spricht Braun in seinen neuen Gedichten von individuellen, privaten Erfahrungen und Problemen, vom Ich und seinen Bedürfnissen, die nicht mit Parolen zu befriedigen sind, spricht vom „Leben zwischen Gier und Abscheu“ und mokiert sich darüber, dass der Mensch allein durch seine Arbeitsleistung definiert wird:
Mensch
Plus Leuna mal drei durch Arbeit
Gleich
Leben.
Auch bei Volker Braun ist eine neue Sensibilisierung zu konstatieren, wie sie sowohl bei der schreibenden (einst so genannten) „Neuen Linken“ im Westen als auch bei einer Reihe jüngerer DDR-Autoren festzustellen ist, die gemerkt haben, dass mit optimistischen Schlagworten allein niemandem geholfen ist.
Besang Braun früher in beinahe romantisch anmutender Manier Maschinen und Hochöfen, so ist jetzt, bei allem Stolz auf das Geleistete; doch auch von „Rauchfahnen“ und „verdreckter Gegend“ in der „Mitteldeutschen Ebene“ die Rede:
Ausgelöffelt die weichen Lager, zerhackt, verschüttet, zersiebt, das Unterste gekehrt nach oben und durchgewalkt, und entseelt und zerklüftet alles.
Beinahe nostalgisch anmutende, leicht wehmütige Gedanken gelten den einst noch unzerstörten Landschaften der Kindheit, und bei einem Text wie „Hans Georg Braun unter anderem“ scheint Brauns Generationsgenosse Wulf Kirsten mit seiner Naturdichtung Pate gestanden zu haben.
Ein Gedicht wie „Undiplomatische Aeusserung“ kann man möglicherweise als eine getarnte politische Attacke Brauns auf Missstände im eigenen Hause deuten, denn der Name Franco, der erst in der letzten Zeile auftaucht, wäre immerhin auch gegen andere Namen austauschbar. In anderen Texten jedoch, die wie Bekenntnisse zwischen die skeptischeren Gedichte eingestreut sind, lässt Braun keinen Zweifel an seiner Treue zum Sozialismus aufkommen, im „Revolutionslied“ etwa. Merkwürdig halbherzig dagegen mutet sein „Prag“-Gedicht an, wo er zwar der DDR-offiziellen Lesart über die Okkupation vom 21. August 1968 beipflichtet und von den Panzern schreibt, sie hätten die Stadt „Gerettet / womöglich, vor sich und der herstürzenden / Flut“; anderseits aber scheint ihm dabei nicht recht wohl zu sein, denn er schreibt:
So war es. Ich sage dafür nicht gut
Oder böse.
Dominierend ist in diesem Buch der Grundton fragender Skepsis: „Das kann nicht alles sein“, heisst es im Blick auf die erreichten materiellen Erfolge, auf die Pläne, Neuerungen und zu hoch hängenden Losungen:
Was erwarte ich noch von mir?
Es klingt eher bitter als aggressiv, wenn Volker Braun in den acht Stücken seines Gedichts „Kontinuität“ unter anderem sagt:
Während wir beinahe gekonnt
Um die Ecke biegen, erklären wir ruhig,
Dass wir die Richtung beibehalten.
Und:
Bei all den schönen Schritten nach vorn
Behaupten wir standhaft unsre Position.
Und:
Wir lernen dazu
Was wir immer gewusst haben.
Das Gedicht schliesst:
Und es wird sich daran nichts ändern
Bis eines schönen Jahrhunderts
Fragt mich nicht wie
Der Kommunismus ausgebrochen ist.
P. S.: Volker Braun hat wegen seines neuen Lyrikbandes Gegen die symmetrische Welt in der DDR, wo das Buch – allerdings um ein wesentliches Gedicht gekürzt – im Mitteldeutschen Verlag (Halle) erschienen ist, Schwierigkeiten bekommen. Die Gedichtsammlung wurde deswegen vorerst auch noch nicht an die Buchhandlungen ausgeliefert. Wie zu hören ist, verlangen einige einflussreiche Leute nach Sanktionen gegen den Autor, Vertreter offenbar nicht nur der symmetrischen, sondern der heilen Welt, die sich von einem Schriftsteller nicht irritieren lassen möchte. Möglicherweise beantworten sie Volker Braun noch auf ihre Weise die Frage, die er in den beiden letzten Zeilen seines Buches gestellt hat:
Und ich frage mich, ob ich zuviel nicht rede
Zuviel nicht rede für unsern Kopf und Kragen.
Jürgen P. Wallmann, Die Tat, 31.10.1975
Aber die Erwartung ist Groß
1.
In Volker Brauns frühen Gedichten lebt eine ungeheure Erwartung. Auch heute noch springt sie dem Leser aus Versen entgegen, die Proklamation und Bekenntnis sind, die sich so direkt und unverhohlen agitatorisch ans Publikum wenden wie folgende:
Unser Glück ist total; es läßt sich
nicht ausrechnen.
Unsre Vorsicht vor uns ist vergeblich:
wir sind maßlos.
(„An die reifere Jugend“)
Der Dichter des „Zyklus an die Jugend“ vertraute darauf, seine Leser mit Lebensgefühl und Selbstbewußtsein anzustecken. Sein „Wir“ gründete auf gemeinsame Aussichten. Die Adressaten von damals gibt es nicht mehr, die Generation ist älter geworden, der gleiche Ton trifft die nachfolgenden nicht. In „Die Leute von Hoywoy“, einem nachdenklichen Aufsatz aus den Notaten, merkt Braun selbst an, wie fremd in einer veränderten Landschaft sich die Gedichte heute ausnehmen. An jener ungeheuren Erwartung gemessen ist die der Gedichte von 1974 gemäßigt. Volker Braun legt mit Gegen die symmetrische Welt eine Sammlung vor, die das frühe Thema aufnimmt wie ein Leitmotiv und zugleich abrechnet. Das fordert zum Vergleich auf. „Allgemeine Erwartung“ heißt das große Gedicht, welches ausdrücklich mit dem Motiv arbeitet. Der darin immer wieder auftauchende Satz „Das kann nicht alles sein“ meldet Ungenügen an, und die lapidare Bilanz „Das meiste ist noch zu erwarten“ zeigt sich nicht befriedigt von Erreichtem, beansprucht aber die Zukunft mit Ungeduld. Wie nimmt sich die Unruhe dieser Erwartung aus neben der Zuversicht, aus der die ungeheure geflossen war? Was gilt die ernüchterte Geste, die nun „Losungen“, „Parolen“, „Verheißungen“ absagt („Freiwillige Aussage“), die vormals Zielangaben sein wollten? Wieviel vom Vorgefühl der Zukunft lebt in diesen Gedichten weiter?
Mit solchen Fragen ist man schon dabei, sich Rechenschaft über eine der poetischen Mitteilungen dieses Bandes zu geben. Er eröffnet die Sicht auf den geschichtlichen Standpunkt der Gegenwart, weil er Anliegen und Anschauungen der sechziger Jahre nicht einfach beiseite schiebt oder verwirft. Braun bricht nicht mit sich und seinen Erfahrungen, er verarbeitet sie. Gegen die symmetrische Welt ist durchzogen von Anspielungen, Selbstzitaten und Zitaten. Was in „Wir und nicht sie“ unter dem Kennwort „Bleibendes“ als Bestandsaufnahme begann, wird jetzt als Selbstkritik weitergeführt, in der wiederholten Auseinandersetzung mit Thema und Text dieses Gedichts.
„Bleibendes“ selbst war schon eine kritische Debatte mit dem früheren, noch ganz im Pathos der ungeheuren Erwartung gefaßten „Vorläufiges“. Es stellte sich Widersprüchen und widersprach selbst. Nur die Schlußverse waren so allgemein, daß man sie für Parole halten könnte, während sie doch Allgemeingültiges fassen wollten: sowohl die Metaphern vom „Kräftesammeln“ und „neuen Sprung“ als auch der unbestimmte Inhalt der Wir-Gemeinschaft, wenn vom „uns immer bleibenden Kampf“ und der „Zeit des Volkes“ die Rede ist. Das wird nun in den wörtlichen Anspielungen von „Freiwillige Aussage“ als Quelle einer Illusion kritisiert, die Unschärfe zwischen Wirklichem und Künftigem angegriffen. Die Zuversicht wird als Glauben an Verheißungen denunziert, und statt „dauernder Kampf“ heißt die tägliche Arbeit „rollende Woche“ oder „größere Mühe“. Ebenso beziehungsreich wird nach dem Bleibenden in „Die Aussicht von Sosa“ gefragt, mit deutlicher Polemik in den Versen „Der weite Winkel des Andenkens / nichts blieb…“ und dieser ungeduldigen Frage am Schluß, die man schon aus „Allgemeine Erwartung“ kennt. Kaum noch polemisch, aber dafür sehr ernst entgegnet die Sicht auf Bleibendes in „Hanß Georg Braun u.a.“.
Mittelbarer sind Bezug und Widerrede in „Unwirsche Auskunft“ und „Die Industrie“ vorgebracht. Beide demontieren idyllische und heroische Bilder von DDR-Geschichte, nicht die eigenen nur, sondern auch andere literarische und außerliterarische. Eine gleiche historische Kritik im Zitat bzw. Selbstzitat ließe sich auch an Gebrauch und Wertwandel der Land-Metapher nachweisen.
Im Ergebnis bekommt man mehr als einen Beleg für die Entwicklung eines Lyrikers. Braun zitiert und bedenkt Haltungen, die DDR-Geschichte sind. Der Zusammenhang seines Werkes, welcher in Gegen die symmetrische Welt fast ausschließlich aus dem Blickwinkel unnachsichtiger Urteile auftaucht, bezeugt unsere Geschichte und ist es wert, selbständig neben Brauns poetisches Urteil gestellt zu werden. Schließlich sind es keine halbfertigen, vorschnellen Gedanken, die da durch späteres Besserwissen korrigiert werden, ebenso wie die frühen Gedichte nicht unbeholfene Poesie sind. Sicher kann man „Provokation für mich“ heute entgegenhalten, daß die Perspektive zu kurz geriet, neuer Mensch und neue Beziehung allzu leicht erreichbar erschienen und die ganze leidige Vorgeschichte sich ausnahm, als bedürfe es nur eines Kraftaktes noch, um sie zu überwinden. Auch sieht man jetzt besser, daß das Ziel uneingeschränkter Selbstverwirklichung noch von fremden Idealen leiht und abstrakt ist angesichts des wirklichen geschichtlichen Weges. Trotzdem ist das Pathos der Gedichte weder komisch noch falsch geworden. Es dokumentiert das ganz eigene Vorgefühl jener Zeit, da das Ende der Übergangsperiode erreicht war. Der Sieg des Sozialismus in der DDR und seine Sicherung zu Beginn der sechziger Jahre machten zum ersten Mal die Sicht auf den Kommunismus konkret und anschaulich. Beispiele dieses hochgestimmten Selbstbewußtseins, das einen geschichtlichen Augenblick lang von den „Mühen der Ebenen“ absah, finden sich in der Literatur jener Zeit mehrfach. Eine ganze Anthologie entstammt dem gleichen Geist (In diesem besseren Lande). Sie alle sagen uns nichts Überholtes, wenn wir sie als eine Stufe von Gesellschaftsverständnis wichtig nehmen.
Gegen die symmetrische Welt organisiert die Selbstbegegnung des Dichters und damit die poetische Reflexion über den Standort der Gegenwart in der Geschichte. Das könnte kaum gelingen, wenn das Subjekt in Brauns Lyrik sich nicht selbst auch gleich bliebe. Das „Ich“ seiner Gedichte ist weder betrachtend noch durchdringt es die Dinge in tiefer Anschauung. Nicht Bildreichtum noch Qualität der Metaphern zeichnen es besonders aus. Dieses „Ich“ hat vorwiegend oratorische Eigenschaften. Es bezieht seine Aktivität aus dem Denken, man folgt stets einem Subjekt, das die Dinge denkend bewegt. An diesem Gestus hat Braun festgehalten, bei allen nötigen Entwicklungen. So wurde seine „arbeitende Subjektivität“ zu einer Persönlichkeit unserer Literatur. Ihre Bedeutung kommt aus der Schärfe eines Denkens, das Fragen stellt, die so noch nicht gestellt wurden und sich immer auf zentrale Anliegen unserer Gesellschaft richten. Sie wuchs mit der Leidenschaft, sich „der politischen Verantwortung“ der Poesie zu stellen. Entsprechend ist auch der Leser jedesmal an der Kommunikation beteiligt, er wird zu Meinungen gefordert und nicht mit Resultaten versehen.
Wie das Subjekt in Brauns Gedichten das Profil einer Persönlichkeit ausbildet, wird gut sichtbar, wo Bezüge zu den Großen der deutschen Lyrik hergestellt werden. Auch dies Thema ist nicht neu in Gegen die symmetrische Welt, aber es bringt neue Resultate. Auf Brecht gehen mehrere Gedichte ein. Sie verarbeiten diese Tradition nicht mehr im Sinne der Nachfolge. Mit „Der Lebenswandel Volker Brauns“ variiert Braun das Muster der „Ballade vom armen B. B.“, wenn er den Gleichklang der Titel sucht, rhythmische Nähe herstellt – mit dem ähnlichen Auftakt beider Gedichte etwa – und schließlich den Gedichtaufbau, fingierter Lebenslauf als Anlaß zu Selbstporträt und Bekenntnis, übernimmt. Zugleich wird auf die Diktion von „An die Nachgeborenen“ angespielt. Der Tonfall einzelner Verse („Ja ich kann von Glück reden, die Gemetzel sind fern.“), vor allem aber das Übertreiben der Bescheidenheit ((„Und was sage ich schon – (Was hab ich zu sagen?)“) und die Rechenschaft vor jedermann erinnern an das große Gedicht Brechts. Braun verarbeitet das Muster weder nachbildend noch parodierend. Er entlehnt vielmehr Gestus und Struktur, um auf eine Weise zu zitieren, die als solche wahrgenommen sein will. Das Zitat hat selbst mitteilende Funktion. Es setzt das „Ich“ aus Brauns Gedichten unbefangen neben das der Gedichte Brechts. Im „Revolutionslied“ dagegen ist das Zitat eingesetzt, um ein antithetisches Verhältnis zu schaffen.
Die strukturelle Übereinstimmung mit „Keiner oder alle“ erstreckt sich auf Strophengliederung, Reimschema und rhythmischen Effekt. Sie bewirkt, daß man Brauns Gedicht liest wie einen neuen Text zur alten Weise. Die Beziehung zu Brechts Gedicht ist polemisch. Sie kann, vorausgesetzt, man vollzieht die Projektion auf Brechts Text von 1934 nach, als geschichtlich bedingte Korrektur verstanden werden. Der Appell des Brecht/Eisler-Liedes an die Arbeiterklasse, die Macht in Initiative umzusetzen, wird neu gefaßt. Durch das Zitat stattet Braun seinen Appell mit einem Bewußtsein historischer Ungleichheit aus, das Gleichheit im Grundsätzlichen einschließt.
Der Gebrauch derselben Techniken: Zitat, Anspielung, Anklang, hat bei Brauns Umgang mit Hölderlin eine ganz andere Bedeutung. Der Titel des Bandes wurde aus dem Gedicht „An Friedrich Hölderlin“ genommen. Das bezeichnet schon die Teilnahme Brauns an Hölderlin. Silvia Schlenstedt nennt das Gedicht ein „Zwiegespräch mit Hölderlin“ und Heinz Czechowski „eine poetische Leistung im Sinne Hölderlins“. Beide drücken aus, daß Braun sich dem Gestus des anderen Poeten nähert wie einem alter ego. Die Situation des Miteinandersprechens im Gedicht leugnet den zeitlichen Abstand nicht, wie es etwa ein Porträtgedicht mit seiner vergleichsweise robusten Vergegenwärtigung täte. Braun nimmt den Einfluß der Sprache Hölderlins bereitwillig auf, aber er kontrastiert sie durch Elemente der zeitgenössischen politischen Sprache („Dein Eigentum auch, Bodenloser… / Ist volkseigen;… Dein Gott in Stahl gehüllt / Geht unter den Werktätigen:“), Im Vergleich dazu ist „Prag“ vom Ton des Hölderlin-Gedichts „Heidelberg“ so durchdrungen, daß unterschiedene Sprachebenen nicht entstehen. Dafür ist die verarbeitete Erfahrung aber auch so aktuell, daß es der ausdrücklichen Gebärde des Aneignens nicht bedarf. „Prag“ verschweigt nichts von dem Schmerz, welchen der wissend bewältigte Widerspruch hinterläßt. Bei den Gedichten gemeinsam ist das innige Verhältnis zu einem wahlverwandten Dichter. Sie nähern sich der Sprache Hölderlins, wie sie auch mit der inneren Spannung übereinstimmen, die jene zeugt. Denn ein gleiches, bis zur Zerreißprobe vorgetriebenes Konfliktbewußtsein zeichnet Braun auch in das Selbstporträt ein, das er „Morgendämmerung“ nennt:
Jeder Schritt, den ich noch tu,
reißt mich auf.
Bekannt ist, daß Braun im Verhältnis zu Goethe einen viel größeren Spielraum aufbaut. „Im Ilmtal“ spricht nicht mit dem Dichter der poetischen Vorlage. Es sucht die vertraute Situation von „An den Mond“ und wandelt sie ab. Das produktive Verhältnis zu seinem Gedicht bewegt nicht das zu Goethe.
Die Beispiele der Varianten zeigen, Volker Braun stellt seinen Platz gegenüber der Tradition selbstbewußt fest. Eine Souveränität gegenüber dem Erbe ist erreicht, die Polemik ebenso wie Nachahmung als jeweils einseitig hinter sich läßt. Da die geschichtliche Funktion der eigenen Poesie mit deutlicher Schärfe begriffen ist, können Epigonalität und Besserwisserei leicht abgetan werden.
2.
Die großen Worte gebühren nicht dem Dichter allein. Der Entwicklungsgrad des Sozialismus macht es möglich, unbefangener als zuvor die Geschichte zu befragen. Er macht es auch nötig, die Gegenwart an den schönen und unfertigen Entwürfen der Vergangenheit zu messen. Es muß aber auch einer genügend kritisches Verständnis der Gegenwart aufbringen und von der Verantwortung der Poesie überzeugt sein, um so unbestechlich zu messen, was erreicht worden ist, was noch aussteht und was sich als Illusion erwiesen hat. Mit diesem Anliegen setzt Braun selbst Maßstäbe für das Gewicht historischer Erfahrungen. Die ernüchterte, ja enttäuschte Haltung, von der viele Gedichte des ersten Teils sprechen, muß wohl als eine solche Erfahrung ernst genommen und nicht als falsches Verhalten getadelt werden. Darum kann nicht von Resignation die Rede sein, wenn der Rückblick auf die vergangenen Jahre wie auch einige Aussagen über weitere Aussichten einigermaßen bitter klingen. Dies war bislang bei Braun ungewohnt. Wenig Glück nur scheint noch verbürgt in den beiden Liebesgedichten („Du liegst so still“ und „Schwierige Forschung“), wenig Hoffnung erhalten in der Bilanz von „Freiwillige Aussage“ oder „Beschäftigung“. Aber der Band verharrt nicht dabei, die Probleme auszubreiten. In der Folge und im Zusammenspiel aller Gedichte werden sie doch verarbeitet, auf produktive Seiten hin befragt und akzeptiert.
Wie die meisten Gedichtbände der jüngsten Zeit will auch dieser als Werk zur Kenntnis genommen werden, einschließlich der Komposition. Diese aber spiegelt sich nicht in den eigenen Schmerzen, sondern entwickelt die Themen. Ungeduldig drückt das „Gleich / Leben, gleich! / Ich habe nur noch wenige Sommer“ („Die Industrie“) aus, wie die Differenz zwischen persönlichem Glücksverlangen und Ferne des Ziels als latenter Konflikt erlebt wird. Dabei stellt dieses Gedicht das Problem in den konkreten Raum eines Geschichtsabschnittes und begründet damit die bitteren Urteile und den elegischen Ton der anderen, die sich sonst leicht als „allgemeine Enttäuschung“ mißverstehen ließen. Braun versachlicht den Konflikt, indem er ihn als Frage seiner Generation zum Beispiel nach der fortdauernden Subordination des Persönlichen unter das Gesellschaftliche aufnimmt. Der Gedanke war zum ersten Mal in dem Gedicht „Schwellen“, da aber thesenhaft ausgesprochen worden. Fällig sei endlich, so in „Schwellen“, Widersprüche zu benennen, statt sie zu verklären. Abgelehnt wurde die Alternative von Einzelglück und Gemeinschaftswohl, widersprochen der Forderung, zugunsten der Zukunft in der Gegenwart zu entsagen. Wenn die gleichen Widersprüche nun als Faktoren in der Praxis beobachtet werden, fällt der Anschein der unversöhnlichen Gegensätze ab. Braun beginnt die Anspruchsproblematik so zu behandeln, daß sie sich verwandelt. In „Haltung einer Arbeiterin“ oder „Allgemeine Erwartung“ kommt er zu den ihr eigenen Inhalten.
Besonders eindringlich beschreibt „Allgemeine Erwartung“ die Dynamik des unbefriedigten Anspruchs. Die eigenen, noch brachliegenden Fähigkeiten beunruhigen den Arbeiter, er drängt darauf, die Perspektive zu verwirklichen, die seine Arbeit herbeiführt. Sein fragendes „Das kann nicht alles sein“ fordert nichts von der Gesellschaft, was nicht für sie gefordert wäre. Sein Anspruch hat den sozialen Inhalt, Entwicklung voranzutreiben. Dem komplizierten gedanklichen Gefüge entspricht eine komplizierte Struktur. Der Ablauf eines anstrengenden Arbeitstages ist die Wirklichkeit, aus der die Gedanken der Arbeitergestalt entwickelt werden. Und das ist ein Vielfaches mehr, als der unmittelbare Arbeitsablauf ihm abverlangt. Das daraus erwachsende Gefühl, „Allgemeine Erwartung“ genannt, richtet sich nicht auf private, sondern auf gemeinsame Angelegenheiten. Der innere Monolog wird von einem „Ich“ gesprochen, dessen Bewußtsein durch seine Arbeit geformt ist, und der Autor bedient es mit den nötigen Worten. Nicht diesen Worten, sondern dem Vermögen der Gestalt entspringt die Energie, welche über die nahen Ziele der täglichen Planerfüllung hinauswill.
Braun verwendet hier eine Technik, die der Mitschnitt eines Bewußtseinsstroms zu sein scheint. Ungegliedert, unangeglichen begegnen sich verschiedene Sprachschichten, Gedanken, politische Leitworte, Kommentare des Autors. Bewußtsein soll so als Vorgang aufgeschlossen werden, die eindringende Darstellung Genauigkeit garantieren. Der soziale Inhalt Erfahrungswelt macht das Verfahren zweckmäßig: Eine Arbeitergestalt war zu gestalten, ohne die Unterschiede zur sozialen Situation des Dichters zu verwischen. Dieselbe Technik kann aber auch das Verständnis hindern. Wie alle Verfahren, die auf den Eindruck von Authentizität ausgehen, stellt der Text keine faßlichen Zusammenhänge heraus. Die Gefahr, daß der Leser bei der Einzelheit stranden und der antithetischen Gedichtführung nicht gewachsen sein könnte, war nicht auszuschließen bei einer Reihe der umfänglichen Gedichte aus „Wir und nicht sie“, sie ist auch nicht gebannt in den reihenden und argumentierenden Texten wie „Leichter, ungeheuer“ oder selbst „Die Industrie“.
Gedichte so vertrauter Genres wie Chronikballade oder Lied machen die Gedanken Brauns für mehr Leser zugänglich. Erzählende Gedichte wie „Haltung einer Arbeiterin“ oder „Aussage des ungarischen Ingenieurs vor der Konfliktkommission“ führen überzeugende Beispiele für produktive Reaktionen auf Widersprüche an. Besonders einleuchtend ist die Pointe im Bericht von der Weberin, die protestiert, indem sie verändert. Diese Gedichte gehören zu den vielen, die den Sozialismus als gemeinschaftliches Unternehmen vieler Nationen behandeln. Braun kann tatsächlich von sich sagen,· „An ein Land nur verschwend ich mich nicht länger“ („Der Lebenswandel des Volker Braun“), denn seine Gedichte verhalten sich zu diesem neuen Moment unserer Entwicklung eingreifend. Der bloß betrachtenden Haltung der Reiselyrik war dieses Niveau nicht erreichbar. Im Gegensatz zu ihrem verbreitet auftretenden Hang zum Exotismus – andere Länder und Menschen fungieren als Sinnbild schöner Ferne und verlorener Naturnähe – sind Brauns Gedichte konkret. Sie nehmen in allen sozialistischen Ländern die Menschen als soziale Wesen wahr. Fremd ist ihnen auch der allgemeine Appell, da sie mit den Menschen auch Konflikte auffinden.
Braun zeigt Integration als Prozeß im Alltag, zeigt, wie ihr Einfluß um sich greift und jeden betrifft. So beweist er ihre politische Bedeutung, statt sie zu postulieren. Wenn politische Lyrik bedeutet, politisches Denken und Handeln zu veranlassen, so sind seine Gedichte es. Veränderte, neue Verhaltensweisen werden so vorgeführt, daß man angeregt wird, sich selbst zu überprüfen, zum Beispiel auf Reste von Nationalismus. Neue Beziehungen werden demonstriert, daß man die Freude am erweiterten Horizont spürt. Diese Gedichte sind alle heiter. Sie sagen, die Praxis hat hier einen Vorsprung vor der Einsicht, den wahrzunehmen sich lohnt. Welch ein schöner Gedanke in „Gdańsk“, ein Stück zukünftiger Welt beginnt da, wo Heimat aufhört, ein Besitzverhältnis zu sein.
In seinem Gedicht „Karl Marx“ rühmt Braun den „Mangel an Illusionen“, in seinen politischen Gedichten verbreitet er ihn. Dies fördert einen Typ von operativem Gedicht, der polemisch, einseitig und zugespitzt agiert. Damit erweitert Braun seine bisher vorwiegend pathetische Diktion um eine satirische Variante. Beabsichtigt ist, jedermann herauszufordern durch eine unfertige, d.h. unfertige Äußerungen hinstellende Position. Titel wie „Unwirsche Auskunft“, „Undiplomatische Äußerung“, „Freiwillige Aussage“ künden eine Redeweise an, die den spontanen Ausdruck und alltägliche Gesprächsformen als Medium nimmt. Es sind Unmutslieder und Pamphlete, die sich meist ausdrücklich auf den bestimmten Anlaß beziehen. Ähnliche Strukturen, die den unmittelbaren Eindruck und die unsortierte Emotionalität der mündlichen Rede übermitteln sollen, werden in letzter Zeit auch bei anderen Lyrikern verarbeitet, so in der Betonung des Gelegentlichen und Unfeierlichen in Karl Mickels Eisenzeit.
Braun entscheidet sich für provokante Gedichte als Werkzeug einer operativen Absicht: Er kehrt damit, auch das ein Rückbezug, zu Teilen der Poetik der frühen sechziger Jahre zurück. Zugleich wandelt er die dort durchsichtiger und didaktisch angelegte Weise des Provozierens ab. Denn jetzt wird die Selbständigkeit des Lesers so ernst genommen, daß er auch nicht unmerklich auf eine wünschenswerte Lesart gelenkt wird. Der Autor geht das Risiko von Mißverständnissen ein. Angesichts des Literaturverständnisses, das sich in den letzten zwei Jahrzehnten bei uns entwickelt hat, muß das befremdlich wirken. Die Mißverständnisse werden also nicht ausbleiben, sobald nämlich die Gedichte als fertige Aussage genommen werden und nicht als Anreiz zur Debatte. Das betrifft nicht Braun allein. Es wird eine Zeit des Umlernens nötig sein, bis dergleichen Schwierigkeiten im Umgang mit der zeitgenössischen Literatur behoben sind. Am Dichter ist es nicht, die nüchterne Sicht zu beschönigen oder die Provokanz zu mildern, wenn sein „Mangel an Illusionen“ uns erschreckt, statt produktiv empfunden zu werden. Mit der Einseitigkeit und Angriffslust bringt Braun das Profil des politischen Gedichts entschieden voran.
3.
Ein Vergleich mit dem 1973 erschienenen Auswahlband Gedichte zeigt, daß Brauns poetische Sprache vielseitiger geworden ist. Dieser Sprache, die einer weit ausholenden, diskursiven Gedichtstruktur entstammt, ist der Lakonismus an sich fremd, nicht dort entfaltet sie ihre Stärke. Durch den Zwang zur Kürze, dem sie jetzt oft unterworfen wird, bekommt sie jedoch den gespannten, die Fülle der Gedanken und Gefühle zusammendrängenden Ausdruck, für den das Hölderlin-Gedicht Beispiel ist. In „Fröhliche Trauer“, dem Gedicht für Georg Maurer, wird die gedrängte Fülle mit einer Metaphorik erreicht, die das Oxymoron zum Grundmuster hat. Die antilogische Verbindung als Bauplan organisiert den gesamten Text. Das „Und meine Brust schreit vor Schmerz / Und, lacht…“ der Schlußverse wiederholt die Grundfigur der Rede. Das Gedicht erhält durch diese Verbindung des Widerstrebenden seine Unruhe, Vermittlerin eines Schmerzes, der nicht gestillt werden soll; einer emotionalen Erfahrung, die dauert.
Auch in „Letzter Aufenthalt auf Erden“ sind die Elemente unvermittelt und gegen die Ordnung der zeitlichen Folge gefügt. Der unheimliche Aufmarsch rings um das Haus Nerudas ist in der Schwebe zwischen Vision und realem Vorgang. Sprunghaft wechseln die Einzugsgebiete der Metaphorik, eine Bildschicht durchdringt die andere oder überlagert sie. („An seinen laubigen Zaun… / Klammern sich Kraken… / … hocken, schwitzend vor Dummheit / Die geheimen Schaben … /“ usw.) Die „Caprichos“ Goyas werden gegenwärtig, die Tiermenschen Daumiers. Der jähe Wechsel unausgeführter Vorstellungen schafft den visionären Raum, von dem sich die Gewißheit des Schlußsatzes um so klarer abhebt.
Insgesamt wird die emotionale Intensität der Vorstellung stärker als zuvor genutzt. Das ist nicht an Anschaulichkeit oder ausführliche Bilder gebunden, sondern geschieht hier durch plötzliche Eingriffe, Verstöße gegen den gewöhnlichen Ablauf der Wahrnehmung. Indem er die Grenze zwischen sinnlicher und vermittelter Realität ignoriert, erzwingt der Dichter die synthetische Aufnahme von Wissen und Fühlen. In „Tag und Nacht“, einem seiner Vietnam-Gedichte, benennt Braun Bewußtsein so:
… das wissend und auch
Fühlend.
Das Thema Vietnam erklärt wie kein anderes das politische Anliegen des poetischen Konzepts. Eine Chance der Poesie ist ihr Einfluß auf die Emotionen, durch ihn befördert sie parteiliche Anschauung der Welt.
Die gleiche Aufgabe erfüllt der imaginative Raum in all den Gedichten, die über das Verhältnis zur Geschichte aussagen. „Landwüst“ gewinnt seine Tiefe durch mehrfache Verwandlung der Landschaft, die Vision überlagert die sich dem Auge darbietende Ansicht. Das Spiel mit dem Doppelsinn der Worte („Natürlich bleibt nichts. / Nichts bleibt natürlich“), das Auftauchen des versunkenen Dorfs inmitten des gegenwärtigen, die sprechende Gebärde der Gegenstände, all das hebt eine unsichtbare Wirklichkeit ans Licht. Die bildlich-emotionale Qualität ist dem Gedankengang nichts Äußerliches. Der Gang durch das Dorf und auf den Hügel ruft die Geschichte hervor, die Gedanken berichtigen das sinnliche Bild, indem die in die Landschaft eingegrabenen Züge ihrer Vergangenheit sichtbar werden.
In „Hanß Georg Braun u.a.“ faßt Braun dieses Durchleuchten der Gegenwart auf ihre Vergangenheit in Worte, die wie Programm klingen:
Und sichre
Die Spuren in mir selbst, der
Ein andres Werk treibt, mit dem Schädel
Gegen den Strich der Zeit
Für die Leute in der Mühle des Lebens
Dieser Zugang zur Gegenwart ist nicht nur irgendein Thema der Literatur, es ist ihre Art, auf die Zukunft zu drängen. Braun begreift seine Erwartungen historisch, das heißt als die gemeinsamen in unserer Gesellschaft. Was sie erreicht hat, kann ihm deshalb nicht genügen, weil er sie als werdende sieht. Für ihre kommunistische Perspektive verwenden sich seine Gedichte mit leidenschaftlicher Bedenklichkeit.
Ursula Heukenkamp, Sinn und Form, Heft 4, Juli/August 1977
Gegen die symmetrische Welt
Der Titel des Lyrikbandes Gegen die symmetrische Welt, der zwischen 1969 und 1973 entstandene Gedichte enthält, bezieht sich auf eine Stelle in einem Brief Hölderlins an seinen Bruder aus dem Jahre 1799. Wie im Fall von Wir und nicht sie bezeugt also bereits das Titelblatt, wie sehr Brauns Bemühungen um Gegenwärtiges von einer Auseinandersetzung mit vergangenen Epochen der deutschen Geschichte geprägt sind, wie wesentlich die Vorstellung der Prozeßhaftigkeit ist. Trotz dieser unübersehbaren Gemeinsamkeit macht sich jedoch eine gewisse Akzentverschiebung bemerkbar: während Braun einst die Aussage Klopstocks im Bewußtsein des inzwischen Erreichten glaubte umkehren zu können, tritt er jetzt eher als Gesinnungsgenosse Hölderlins auf. In der betreffenden Briefstelle heißt es:
… die Besten unter den Deutschen meinen meist noch immer, wenn nur erst die Welt hübsch symmetrisch wäre, so wäre alles geschehen.
Es liegt auf der Hand, daß Braun, der sich seit jeher in der DDR für das Recht auf ,Ecken und Kanten‘ einsetzt, im schönen Satz seines Vorgängers eine noch aktuelle Einsicht erblicken müßte, und eben dieser Satz wird im Gedicht „An Friedrich Hölderlin“ zitiert:
Dein Eigentum auch, Bodenloser
Dein Asyl, das du bebautest
Mit schattenden Bäumen und Wein
Ist volkseigen;
Und deine Hoffnung, gesiedelt
Gegen die symmetrische Welt!…
Es ist im Grunde dieselbe Stimmung, die in Wir und nicht sie vorherrscht: das Geleistete wird nicht heruntergespielt (der Boden ist volkseigen), doch es ,tröstet‘ den Dichter nicht. Gleichzeitig wird kein Zweifel daran gelassen, daß sich Hölderlins Traum von einer humanen Gemeinschaft, in welcher Menschenliebe mehr gelten sollte als Ordnungsliebe, verwirklichen wird:
… Brust an Brust weitet sich so, daß die aufsprengt diese
eiserne Scheu voreinander!…
Dieses Gedicht ist ein Beispiel dafür, wie ein produktives Verhältnis zum Kulturerbe aussehen sollte: jenseits höflich-musealen Interesses wird Hölderlins Denken und Schaffen nach heute noch Gültigem hin untersucht (das falsche Gefühl historischer Überlegenheit hat hier nichts zu suchen). Zu dieser Einstellung dem Erbe gegenüber gehört allerdings auch der Mut, das historisch Überholte im Werk der ,Olympier‘ ans Licht zu bringen, und das tut Braun auf überzeugende Weise im Gedicht „Im Ilmtal“, das an Goethes „An den Mond“ erinnert. Während Goethe beim Gang durch die schöne Landschaft sich nach verlorenem Liebes- bzw. Freundschaftsglück sehnt („… Selig, wer sich vor der Welt / Ohne Haß verschließt, / Einen Freund am Busen hält / Und mit dem genießt…“), beklagt Braun gerade seine ungewohnte Absonderung von der Welt. Der Grund für die Isolation („… Einmal lebte ich so, freudig / Mit den Genossen…“) bleibt unausgesprochen, und das private Glück reicht zur Beruhigung nicht hin:
… Nicht glücklich kann ich verschließen
Mich mit ihm vor der Welt…
An die Stelle der bürgerlichen Idylle tritt das Ideal einer sozialistischen Lebensweise:
… Zu den verstreuten, tätigen
Gefährten, wer es auch sei, muß ich kommen, und nie
Verlassen den großen Kreis
Und was ich beginne, mit ihnen
Bin ich erst ich
Und kann leben, und fühle wieder
Mich selber in meiner Brust.
Die beiden Gedichte „An Friedrich Hölderlin“ und „Im Ilmtal“ beleuchten zwei Pole des lyrischen Ichs in Gegen die symmetrische Welt: einerseits begegnet man dem Vorwärtsdrängenden, dessen Begeisterung sich von Illusionen freihält, andererseits trifft man auf einen zeitweilig Resignierten, der sich an Hindernissen wund stößt. Erst beide Aspekte zusammen ergeben ein Gesamtbild des lyrischen Ichs.
Die poetischen Erkundungen dieses Bandes werden – auch dies eine Ähnlichkeit mit Wir und nicht sie – von zwei wichtigen Gedichten gleichsam umrahmt, die das Andauern der Kämpfe und die qualitativ neue Stufe der Auseinandersetzung thematisieren. Im früheren „Lagebericht“ wurde die Propaganda-Schlacht der am Status quo Interessierten mit einer Vision der um sich greifenden Masseninitiative von unten kontrastiert. In „Freiwillige Aussage“ wird eine Suche nach der Realität hinter diesen „Lösungen“ und „Parolen“ angekündigt („… Auf der Straße ohne Vorsatz, mit bloßem Auge…“), und der Suchende ist diesmal als Individuum erkennbar:
… Ich schlage (mein Beruf) die Schalungen vom Beton
Von der Brust…
Statt die künftige Entwicklung vorwegzunehmen, richtet der Beobachter seinen Blick auf die Gegenwart, auf die alltäglichsten Dinge:
… Was bleibt? unter den Deckgebirgen
Der Verheißungen, kühl und wirklich das Leben
Die Mühe, die Lust, der kalte Kaffee…
Die Bilanz, die im Schlußgedicht „Der Lebenswandel Volker Brauns“ gezogen wird, fällt auch nicht so positiv aus wie diejenige in „Um sinnloses Wutvergießen zu vermeiden“. Die damalige Zuversicht des kollektiven „Wir“, die trotz aller zur Kenntnis genommenen Gefahren geäußert wurde, weicht jetzt der Unsicherheit eines durchaus verwundbaren Einzelnen:
… Für einen Augenblick im Dämmer seh ich meine
Schienbeine glänzen
Wie Totengebein, und ich liege abwesend von mir
Und ich frage mich, ob ich zuviel nicht rede
Zuviel nicht rede für unsern Kopf und Kragen.
Angesichts der vorherrschenden Stimmung in diesen ,Rahmengedichten‘ kommt man nicht umhin, danach zu fragen, inwiefern der charakteristische Aktivismus des Lyrikers Braun sich mit dem utopischen Hoffen sowie dem Anflug von Resignation in den in Gegen die symmetrische Welt gesammelten Versen vereinbaren ließe.
Die Bestimmung des neuen Standorts zwischen Utopie und Gegenwart ist eine zu schwere Aufgabe, als daß sie in einem Anlauf erledigt werden könnte: verschiedene Perspektiven sind dazu erforderlich. Das Gedicht „Karl Marx“ trägt z.B. zur Orientierung auf der Ebene der revolutionären Theorie bei. In drei Teilen wird angeblich ,objektiv‘ berichtet (die ironische Umkehrung muß vom Leser geleistet werden), was uns Marx abgenommen bzw. überlassen hätte. Nicht mehr nötig wären die „Mühe“ seiner „übermenschlichen Arbeiten“ und die grausame „Härte“ gegen sich selbst, seine Familie und seine Mitarbeiter. Vererbt hätte er uns allerdings eine Haltung, die im Laufe der Zeit immer unentbehrlicher werden müßte:
… Aber was hat er uns überlassen!
Welchen Mangel an Illusionen.
Welchen weltweiten Verlust
An sicheren Werten. Welche verbreitete
Unfähigkeit, sich zu unterwerfen!
Und wie ausgeschlossen, unter uns
Nicht an allem zu zweifeln. Seither
All unsre Erfolge: nur Abschlagszahlungen
Der Geschichte. Dahin die Zeit
Sich nicht hinzugeben an die Sache
Und wie unmöglich, nicht ans Ende zu gehn:
Und es nicht für den Anfang zu halten!
Entspräche dieses Bild tatsächlich der DDR-Wirklichkeit, dann würde zweifellos passieren, was Wolf Biermann einmal – in einem anderen Zusammenhang – prophezeit hat:
… Zu uns fliehn dann in Massen
Die Menschen, und gelassen
sind wir drauf vorbereit’…
Da die explosive Verquickung von Hingebung und Zweifel jedoch immer noch unerwünscht ist, muß agitiert werden, und das „Revolutionslied“ zeigt, was für eine Agitation vonnöten ist. Braun kämpft hier gegen die Gefahr der Verkleinbürgerlichung:
… Keine Laus im Fell mehr und kein Loch im Bauch
Die warme Stube auch –
Das kann nicht alles sein…
Die „Freie(n)“ – so werden die Genossen und Mitbürger angeredet – wären erst dann wirklich frei, wenn sie den künftigen Kurs selbst bestimmen könnten. Das Volkseigentum an den Produktionsmitteln ist nur der erste Schritt:
… Nicht die Fabriken nur: den Staat…
Die Wir-Form, in der die Weiterführung der Revolution in Richtung sozialistische Demokratie gefordert wird („… Es reicht uns noch nicht aus…“), wirkt wegen seiner Abstraktheit nicht ganz überzeugend; dafür kommt ein Schichtarbeiter in einem anderen Gedicht selbst zu Wort. In „Allgemeine Erwartung“ ist die Botschaft dieselbe (der Vers „Das kann nicht alles sein“ wird sogar sechsmal zitiert), doch diesmal lernt man die konkreten Bedingungen kennen, denen die Forderungen und Hoffnungen entspringen. Der Arbeiter, der „… in einer Halle / Die vor Hitze flirrt…“ laut denkt, ist ein Held, und zwar gerade deshalb, weil er keiner ist:
… Ich Selbstausbeuter, Hennecke, inoffizieller
Held der Arbeit, die eine Sache der Ehre ist
(Die Ventilatoren sind ausgefallen!)…
Bei aller Kritik möchte er das bisher Geleistete nicht bagatellisieren („… Schon das… / Ich hätte es nicht gedacht / Von mir und meinen bedenklichen Brüdern / In diesem besessenen Land…“), doch er wird das Gefühl nicht los, daß das erst der Anfang ist:
… Das meiste
Ist noch zu erwarten.
Diese Schlußfolgerung rührt nicht zuletzt von höchst persönlichen Überlegungen her: allmählich dämmert es dem Arbeiter, daß der Vorrang, welcher der Intensivierung der Produktion gegeben wird, unweigerlich zu einer ,Programmierung‘ aller Aspekte seines Lebens geführt hat:
… Und am Abend, nach diesem heißen Tag
Sehe ich ein
In etwas Hingestrecktes, mein Leben:
Eine beschlossene Sache…
Diese Vorstellung, daß die ,große Ordnung‘ funktioniert, während die Menschen kaum dazu kommen, nach dem Sinn ihres schnell vorbeifließenden Lebens zu fragen, taucht in Gegen die symmetrische Welt immer wieder auf und wird zum Drehpunkt des ganzen Bandes. Hierin liegt die ,Verpersönlichung‘ von Brauns Lyrik, die Haltung, „die sich nicht so forciert für eine Sache engagiert, sondern für die vielen Sachen, die zum Menschen gehören“.
Die schreibenden Männer in den westlichen Industrieländern haben dank der neuen Frauenbewegung der letzten Jahre gelernt, daß auch das Persönliche ,politisch‘, d.h. wichtig ist. Da es in Osteuropa keine solche Bewegung gibt, ist diese Erkenntnis dort keine Selbstverständlichkeit, und ihre Veranschaulichung in Volker Brauns kurzem Gedicht „Beratung“ ist deshalb um so beachtenswerter:
Zu den Seiten meines Tisches
Hängen zwei Bilder. Den Besucher
Setze ich so, daß er das Massaker von Guernica
Betrachten kann, und während er spricht
Sehe ich den Garten der Lüste.
Über den breiten Tisch
Schwankt das Gespräch.
Diese programmatischen Verse sollten allerdings nicht den Eindruck entstehen lassen, als ließe sich dieses Ideal des ,schwankenden‘ Gesprächs – geschweige denn des in jeder Hinsicht intensiven Lebens – mühelos realisieren. Im spielerischen Gedicht „Die Austern“ erfährt man z.B., daß das Kulinarische eine Kunst ist: die „Wolfs“ werden bewundert, weil sie so „gründlich“ fressen („… Das sind noch Menschen…“), während Braun „die nackten Tierchen“ erst mit Zitrone „betäuben“ muß, ehe er sie „mutlos“ schluckt. Am Ende kommt eine Einsicht, die man schwerlich in früheren Braun-Gedichten hätte finden können:
… So, sage ich nun, das
Leben zwischen Gier und Abscheu
Zergehen lassen auf der Zunge, ja.
Die schon immer gepriesene Dialektik wird nun auch auf das eigene Leben (nicht nur auf die gesellschaftliche Entwicklung) bezogen. Die neue Haltung könnte auch als „fröhliche Trauer“ (so der Titel eines dem verstorbenen Lyriker Georg Maurer gewidmeten Gedichts) bezeichnet werden. Das lyrische Ich, das jetzt eine unerhörte Verwundbarkeit an den Tag legt („Jeder Schritt, den ich noch tu, / reißt mich auf.“ – „Die Morgendämmerung“, sucht unaufhörlich nach dem Sinn des Lebens. Der Mann, der den „Schatz“ bei seiner Geliebten zu finden hofft, ist der Verzweiflung nahe, weil seine „plumpen Schritte“ nichts taugen:
… Wo ist der Gang
In diese Tiefe, der Blick woher
In dies versiegelte Feld?…
(„Schwierige Forschung“).
Das Schatz-Motiv kehrt in „Du liegst so still“ wieder, wo das nächtliche Grübeln zu einer Trennwand zwischen den Partnern wird:
Du liegt so still, in dich versenkt
Schatz, ungehoben, jede Nacht…
Der neue Hang zum Nachsinnen ist hier die Angelegenheit eines Individuums, doch in „Das Eigentliche“ macht Braun deutlich, daß er gegen einen kollektiven Verdrängungsmechanismus ankämpfen will, und die Wir-Form weist darauf hin, daß er sich als Mitverantwortlicher empfindet. Wie schon in „Freiwillige Aussage“ wird von der Scheinwelt der Propaganda Abschied genommen:
… In unsern Redensarten; Freunde
Kann der Sinn nicht ganz liegen…
Da Braun seine Leser zum Nachdenken bringen will, erklärt er nicht, was das „Eigentliche“ ist; man erfährt nur, daß es „mit vielem Getue“ umgebracht, „mit grämlichem Eifer“ zugeschüttet, „in aller Eile“ vergessen und „wie eine Freude“ gescheut wird. Gerade das Letzte, diese Scheu, deutet an, worauf Braun vielleicht hinauswill: das, was die Handwerker, Denker, Priester usw. erst zu Menschen macht, ist nicht das Wohl geordnete, Eingeplante, Glatte, sondern das Spontane, Unerwartete, Naive. Die allzu weit verbreitete Angst vor Innenschau und Selbsterkenntnis, die einst den Idealisten Hölderlin (und dessen Deutschlandbesucher Hyperion) vor Wut und Betrübtheit rasen ließ, zermürbt auch noch den nachgeborenen Materialisten Braun, der als Bürger eines sozialistischen Staates zumindest theoretisch ganz andere Zustände erwarten dürfte. Ein bedeutender Teil der Gedichte in Gegen die symmetrische Welt setzt sich mit einer zählebigen deutschen Hinterlassenschaft auseinander, die von den offiziellen Hütern des ,Kulturerbes‘ geflissentlich übersehen wird.
Vor einigen Jahren meinte die DDR-Kritikerin Sigrid Damm, Braun habe mit diesem Gedichtband „erst am Anfang einer dritten Schaffensphase“ gestanden. Hinzuzufügen wäre, daß er gleichzeitig frühere Schaffensphasen weiterführt. Dazu gehört z.B. das erschütternde Gedicht „Tag und Nacht“ in dem gefragt wird, wie der ,normale‘ DDR-Alltag angesichts der Greuel des Vietnam-Krieges weitergehen sollte:
… Und dieselbe bist du
Oder ich, das wissend und auch
fühlend…
(Vgl. „Elendsquartier“ in Wir und nicht sie.) Der Agitprop-Ton der „Kriegs-Erklärung“ klingt in „Armstrong, Aldrin, Collins“ an, und zwar in einer nicht gerade glücklichen Verbindung mit der Sprache der ,Kosmonauten-Gedichte‘ aus den frühen sechziger Jahren. Neben der Herausbildung der ,neuen Subjektivität‘ ist es aber vor allem der Internationalismus – wie schon in Wir und nicht sie – um den sich Braun bemüht. In „Der Lebenswandel Volker Brauns“ heißt es dazu:
… Was soll die Versessenheit?
An ein Land nur verschwend ich mich länger nicht…
Diese Einstellung paßt ohne weiteres zum oben skizzierten Bild des ,suchenden Subjekts‘, doch es fällt ein anderer Satz, der einen nur befremden könnte:
Als wir eines Tages wußten
Daß das Wichtigste getan war
In unserem Land
Kamen wir uns auf einmal seltsam
Allein vor…
(„Der geflügelte Satz“)
Es ist kaum zu fassen, aber diese Verse stammen vom selben Dichter, der sich zu beißender Kritik verpflichtet fühlt:
… Eingezwängt Hals Knochen Schwanz
In den Apparat.
Bestochen von Bajonetten und schönen
Worten, die jeder wechseln muß
An Denken gar nicht zu denken…
(„Unwirsche Auskunft“)
Durch Gegen die symmetrische Welt geht ein tiefer Riß, der den Genuß der gelungenen Gedichte – vor allem der ersten zwei Teile – im nachhinein relativiert. Jenseits von Zweifel und Analyse wird die sozialistische ökonomische Integration in den RGW-Ländern zum leuchtenden Wegweiser in die Zukunft erhoben. Mittels Humor und Ironie werden die grundlegenden Schwierigkeiten in heitere Mißverständnisse verwandelt (vgl. „Aussage des ungarischen Ingenieurs Lajos K. vor der Konfliktkommission“), und Braun ist sogar nahe daran, die osteuropäische Landschaft als eine regelrechte Märchenwelt darzustellen:
Thrakien, welch Blühn. Die kleinen Bäume
Starren vor roten Apfeln. Der Wein
Mit seinen vielfaltigen Brüstchen, hängt
Vor dem Mund in den Lauben…
(„In aller Freundschaft“).
Um die Annäherung durch wirtschaftliche Zusammenarbeit nicht zu technokratisch-abstrakt erscheinen zu lassen, muß auch eine schöne Liebesgeschichte her: die leidenschaftliche Zuneigung des DDR-Deutschen Roland zur Polin Jana überwindet alle Hindernisse, und auf der Hochzeit ist man sich einig:
… zwei Länder geben mehr
An Spaß her als nur eins, nach so schwieriger
Verbindung.
(„Annäherung“)
In „Leichter, ungeheurer“, einem überlangen Gedicht im Majakowski-Stil, wird zwar Kritisches zu diesem Thema vorgebracht („… Da kann ich mich einpacken / oder die Frau / In brüderliche Entschlüsse / wenn ich nicht rede…“), doch man übersieht es fast inmitten des lyrischen Dickichts. Das rätselhafte Wesen des Braunschen Zwiespalts läßt sich nicht so leicht erhellen, doch der Vergleich von zwei poetischen ,Städtebildern‘ verschafft einem zumindest ein paar Aufschlüsse darüber. Das schöne ,Gdańsk‘ („Meine mögliche Heimat…“) wird nicht nur als „koloriertes Märchen“, sondern auch als ehemaliger Kriegsschauplatz erlebt:
… Wand um Wand stürzt die
Stadt in die Geschichte…
In künftigen Jahren, nachdem die Konflikte zwischen Polen und Deutschen längst vergessen wären, würde die wiederaufgebaute Schönheit der Stadt alle Menschen erfreuen:
… Jedem gehörig
Ihr Glanz…
Solch utopische Zustände können heraufbeschworen werden, weil keine tagespolitischen Unannehmlichkeiten im Wege stehen (man schreibt das Jahr 1973). Anders im Gedicht „Prag“: hier wird so sehr laviert, daß der Leser weder ein Bild der ,goldenen Stadt‘ noch eine eindeutige Stellungnahme zu den Ereignissen des Jahres 1968 bekommt. Die Schrecken werden zwar nicht verschwiegen („… Die Eingebornen wie / Wachsfiguren, blicken / Aus der Wäsche, bleich, auf / Bajonette…“), doch es bleibt unklar, inwiefern sie für den Besucher tatsächlich welche sind:
… So liegt die Stadt
Sicher, darnieder, gerettet
Womöglich, vor sich und der herstürzenden
Flut … Die leisen Frauen
Wen nähren die Brüste noch: freie Knechte
Oder Freie?
Die Verwendung von moralischen Kategorien („So war es. Ich sage dafür nicht gut / Oder böse…“) verschleiert die Notwendigkeit einer politischen Beurteilung von politischen Vorgängen. Man muß leider feststellen, daß Braun trotz seiner Hölderlin-Bewunderung manchmal (unbewußt?) noch zur Verfestigung einer symmetrischen Welt beiträgt. Vgl. dazu das Selbstporträt des Schwankenden:
Mit gemischten Gefühlen harre ich meiner Entschlüsse
(„Der Lebenswandel Volker Brauns“)
Als Gegen die symmetrische Welt 1974 erschien, meinte der Lyriker und Kritiker Yaak Karsunke, Brauns „dialektische Betrachtungsweise“ finde „ihre sprachliche Entsprechung in einer sehr komplexen Bauart der Gedichte, einer äußerst verschränkten Montage“; anders als in Wir und nicht sie führe der neue Band „die komplizierte Technik“ jedoch „in oft schon fast täuschender Einfachheit vor“. Es stimmt schon, daß Braun seine poetische Technik viel sicherer handhabt als im vorigen Band (was nicht zuletzt mit der Themenwahl zusammenhängt), doch die wachsende Virtuosität geht nicht unbedingt mit einer Erleichterung der Leser-Arbeit einher. Die Auseinandersetzung mit den z.T. schwer zugänglichen hymnischen Dichtungen Hölderlins eröffnet neue Perspektiven, fordert aber nicht unbedingt deren Vermittlung. Hinzu kommt, daß die früher intensive Rezeption der Brechtschen Lyrik (außer in den Kurzgedichten „Bauarbeit“, „Beschäftigung“ und „Beratung“, im „Revolutionslied“ oder in „Der Lebenswandel Volker Brauns“) in diesem Band kaum zu Buch schlägt. Die Gefahr einer Hinwendung zum Dialog mit der Elite der sozialistischen Leserschaft ist durchaus da.
Jay Rosellini, aus Jay Rosellini: Volker Braun, Verlag C.H. Beck & Verlag edition text + kritik, 1983
Volker Braun: Nicht nur der Kunst ist der Menschheit
Würde in die Hand gegeben
Aber Marx wußte was er sagte, was weiß ich?
In diesem neunzehnten Jahrhundert, voll
Von nackten Tatsachen, und keine Kunst
Die sie auffraß, sah man noch durch
Auf den Tag, an dem die Ketten reißen.
Was immer kommen mußte, schrecklicher
So rettender wars. Das hätte schwächeres Fleisch
Befeuert fortzudenken. Die große
Gewißheit der Klassiker und die langen
Gesichter der Nachwelt. Wohin soll ich denken?
Nach vorn immer durch den Vorhang von Blut
Der Blick auf die Kulissen und nicht hinter.
So viele Kunst und hat nichts zu bedeuten.
In der Vorstellung verbrauchen sich die Köpfe.
Was immer kommt ist besserschlechter oder als.
Was mir die Augen, öffnet nicht die Lippen.
(Volker Braun: „Rechtfertigung des Philosophen“)
Die sichtbaren Veränderungen, die nicht nur im Tonfall der Gedichte sondern im Denken der Dichter vor sich gegangen sind – eine grassierende Desillusionierung der Vorstellung von Wirklichkeit und Geschichte in den Köpfen der Zeitgenossen – Volker Brauns Gedichte aus den letzten Jahren zeigen sie wie eine transparente Folie: Verse disparater Gedanken, Verse gebrochener Gefühle und betroffener Zäsuren: „Was mir die Augen, öffnet nicht die Lippen…“. – Suchten andere Autoren das allgemeine gesellschaftliche Dilemma in der Parabel zu treffen, Metaphern der Bitterkeit, berechtigter Enttäuschungen, demonstrativer Aversion oder resignativer Mahnung, ging Braun das Übel konkret an, stellte sich, stellte sich in Frage, streitbar und damit angreifbar. Sagten andere: „Nein“, sagte er „Ja, aber“. Einseitigkeiten sollten seine Sache nicht sein, zumindest möchte er sie, soweit es von ihm abhängt, zu seiner Sache nicht machen, selbst nicht in einer Zeit, die außer schwarz und weiß keine Farben gelten lassen will:
Womöglich war es mein Fehler
daß ich mich nicht entschloß
in Schwarz zu gehn oder ganz in Weiß
zu den vorgeschriebenen Stunden
Weder Resignation noch Ressentiment scheinen ihm jetzt angemessen, weder lange genug geübte Zusage noch trotzige Absage, wie wir sie nicht selten lesen. Nur der Vers geht ihm nicht mehr glatt von der Zunge, der fällt, sich selbst unterbrechend, ständig mit wenn und aber ins gültige Wort; schwierige Selbstbehauptung hält ihn lebendig, Leben, das durch Widerrede und Zweifel sein tägliches Recht fordert. Er liest wieder in den Briefen Georg Büchners:
Der Gedanke, daß für die meisten Menschen auch die armseligsten Genüsse und Freuden unerreichbare Kostbarkeiten sind, machte mich sehr bitter…
und er kommentiert:
Hier herrscht das Experiment und keine steife Routine.
Hier schreit eure Wünsche aus: Empfang beim Leben…
Der jugendliche Elan, den man emotional-ungestüm und messianisch die Versperioden vorantreiben sah, dieser Elan ist jedoch längst einer nachdenklich-stockenden Nüchternheit gewichen, die sich nur hartnäckig an einen Satz, wie den historischen von Thomas Müntzer, als noch mögliche Zuflucht hält: „Ich kann es nicht anders machen“ (wer hätte nicht dazu gleich den Satz von Müntzers Gegenspieler Luther: „Hier stehe ich…“ parat?) Von „experimentieren“, gar von „herrschen“ kann die Rede da nicht mehr sein, nicht von Wünschen oder selbst von „allgemeinen Erwartungen.“ Bleiben nur Stufen der Erfahrung:
Um nicht zu stolpern, falln den Hals zu brechen
Hinab und hinauf, die Knochen schneller
Als der Verstand, oder viel verstehend
Hocke ich da, lachend über die Gangart
Der Mitbürger auf demselben Terrain
Das sie trickreich bewohnen. Was zum Teufel
Kratzt mich untern Sohlen auf dem Marsch
Ins Morgen. Gestern wußt ichs aber heute
Muß ichs lernen. Stufen…
Diese Stufen gehts mühsam, manchmal holpernd hinauf oder auch wieder hinab wie im Gleichnis vom Besteigen hoher Berge, und die einstige Verheißung ist nur noch ein „geflügelter Satz“:
Wir, die wir einst nichts zu verlieren hatten
Als unsere Ketten, aber eine Welt zu gewinnen
Fragen uns nun erbittert:
Was haben wir gewonnen?
Was ist das für eine Welt?
Solche Fragen, grundsätzlich gestellt, nicht Äußerungen gekränkten zeitweiligen Unmuts oder achselzuckender Abkehr, können so absolut nicht mehr beantwortet werden, schon gar nicht mit formelhaften Argumenten, ideologischen Sprüchen, selbstermutigenden Slogans, wie sie auch Braun einst gern hatte. Das selbstgemute „Wir“ früherer Gewißheit spricht sich im monologisch abwägenden oder den Dialog mit einem Adressaten suchenden Vers vorsichtiger als „ich“ aus, ein Ich, das sich allerdings nicht außerhalb von Gesellschaft sieht, im Gegenteil. Je mehr es sich zur Gesellschaft kritisch stellt, ihr nur umso peinigender verbunden und verkettet ist es:
Ich den alles trifft und der alles vergißt
Ich begegnete mir in der erregten Menge…
Ich der alles trifft und den alles vergißt
Mit dieser offenen Wunde in den Gedanken.
Dieses Ich verleiht sich selbst ein Statut seiner Dauer und Hinfälligkeit, und das Statut gleicht allen zeitlich beschränkten Statuten von Organisationen oder Parteien – es vergeht mit ihren Zwecken. Brauns Gedichte sind jetzt weder aufrufend noch meditierend, weder traurig noch optimistisch, weder linientreu noch revisionistisch – sie stehen jenseits solcher beschränkten Kategorien.
Manche werden über den Autor den Kopf schütteln, daß er sich noch immer oder noch immer wieder mit den „brennenden Fragen unsrer Bewegung“ (Lenin) herumschlägt, andere werden ihn – wie immer – verdächtigen, daß er es auf diese freimütige, direkte Weise tut. Daß er für seine Vorstöße Rückschläge in Kauf nimmt, taktische Rücksichten, Rückzüge, die nicht elegant aussehen, wenn er noch eben radikal vorgebrachte Schlüsse wiederum zur Position stellt – wer wirft auf ihn den ersten Stein?
Brauns Gedicht entsagt der geschlossenen Form, sein Sprecher verweigert sich der Lockung ins metaphorische Alibi – er kann sich aus den anstehenden Konflikten nicht heraushalten bei Strafe seines Talents, das Gedicht ist ihm „Material“ für den „Stoff zum Leben“, so nennt er einen Zyklus, geschrieben 1975/76, in welchem die Verse selbst in die erregte Debatte eintreten, in lyrische Prosa, in den dramatischen Dialog – es ist vielleicht das elementarste Stück seiner Dichtung überhaupt, ein mit bohrender Selbstbefragung vehement vorgetragener Text, der eben aus den bisher geübten Formen gerät. Klassische Zitate sind dem Text einmontiert, auf Zitate wird mit tatsächlicher Erfahrung allergisch reagiert. „Material II: Brennende Fragen“:
Früh um fünf im Train Bleu
Zwischen den schwarzen leeren europäischen Hügeln
Der Mann und die Frau, seine Hand an ihrem Leib.
Die Dämmerung rollt in die nassen Wiesen
Ihre Körper gleiten auf den Schienen nebeneinander
Und berühren sich auf dem Schotter der Masten
Plastikmüll quietschende Bremsen (was brauche ich)
An Stoff für dieses berührende Gedicht?)
Fahl ein Streif fließt in ihren Augen und wächst
Nach oben, sie wirft sich zurück
Ins Polster gepreßt, seine Hand noch immer
Oder ein Bach aus der Landschaft springt über Geröll
…
Mit zuen Augen, die schöne Bourgogne:
Durch die Scheiben fällt Wasser durchsichtig grau
Mit Muscheln und Kies, ein sinnliches Meer
Von Dächern und Fensterflügeln, in die Sonne bricht
Unvermutet. Die Bäume und Stangen
Greifen in ihre Brüste in ihren Schoß
Während Frankreich verschwimmt, oder wie hieß das Land?
Felder von durchdringendem Licht und sieben Himmel
Vor den Augen nichts, aber das alles in ihr
Rast durch sie, sie krümmt sich, sie schluchzt
Sie öffnet die Augen um acht auf die fremde
Stadt: unter den Gleisen rasselnd. Was hat sie gesehn
Von der Landschaft? nichts (aber was sah sie denn?
Was ist ein Gedicht: auf dem weißen internationalen
Papier, ein Stoff
Zum Leben?) sie lächelt hinaus…
Was fühlst du
in der Umarmung?
Die nackten Tatsachen Für einen Kuß
In der ,Stunde der Politik‘ (,des Weltfriedens‘, ,der Klassik‘)
Die Intensivschicht
aaaaaaaaaaaaaaaain der Mundhöhle, die Stellungnahme
(Du bist blaß, Luise?
Es ist nichts. Du bist ja da. Es ist vorüber.)
Mit der Zunge
aaaaaaaaaaadas Geschlecht streicheln, die Berichte
Das Kollektiv
aaaaaaaaaaaeine bleibende Empfindung
,Du bist nicht bei der Sache‘ – ,Wo du dauernd quatscht‘
(Willst du mir ein Glas Limonade zurecht machen.)
EVP –, 53, Flaschenpfand, Plandiskussion
Im offenen Fenster die Abgase, die brennden
Fragen
in deinen Augen, und die Fernsehscheiße!
,Mußtn immer was aussetzen‘. – ,Hatn angefang!‘
,Ich habs satt wenns kein Spaß macht‘ – ,Denkst wohl mir‘.
,Wenn du mir nie zuhörst‘. – ,Immer dein Mist‘.
,Du liebst mich nicht‘.
aaaaaaaaaaaaaaaaaaes folgen die Spätnachrichten.
(Die Limonade ist matt wie deine Seele – Versuche!
Wendet sich, sobald sie das Glas an den Mund setzt, mit einer
plötzlichen Erblassung weg und eilt nach dem hintersten
Winkel des Zimmers.)
,Dann geh ich ebn fremd‘ – ,Ich halt dich nicht!‘
(Die Limonade ist gut.)
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaDie Worte Schwanz, Brust etc.
Überhaupt Worte (Reizwörter, Sprach-
Regelungen, Memoranden zwischen den Zeilen
Zu entziffern) haben mehr Wirkung
Als die Dinge
aaaaaaaaaaawarum? weil sie verdecken
Verallgemeinern, vervielfältigen
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaweil sie verdecken was fehlt
Was fühlst du? So vieles geschieht
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaazu zweit
Ist die Welt am deutlichsten, unausweichlich
(Wenn du meinst was ich meine). (So meine ich es doch nicht.)
…
Schluß! sage ich, um bei der Sache zu bleiben
In diesem Gedicht im kühlen Abend
aaaaaaaaaruhen, auf den Rückenwirbeln
Auf dem Bett, in der Mundhöhle
In den Möglichkeiten
aaaaaaaaaaaaaaaaaaim offenen Fenster
So vieles geschieht! Schluß!
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaund das Einsundalles
Ist nichts ohne das andre
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaKannst du nicht schweigen?
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaadas fehlt, das Ganze
Das zwischen uns liegt (was fühlst du jetzt?
Ich kann es nicht sagen.)
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaadas Gerücht der Gedichte
Im offenen Fenster
aaaaaaaaaaaaaaaarußig, undeutlich
Erheben sich die Fragen
In Zeitungspapier gewickelt, namenlos
Ist das die Möglichkeit?
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaadie brennenden Fragen
Unsrer Bewegung
aaaaaaaaaaaaaaaauf dem Bett, auf dem Materialsektor
Undeutlich, unglänzend durch Anwesenheit
In deinen Augen in den Worten
aaaaaaaaadie ich darüber verliere.
Diesem Zyklus „Der Stoff zum Leben“; sind als Motto Verse aus T.S. Eliots The Wast Land vorangestellt – nach den hierzulande üblichen Attacken gegen diesen als dekadent verschrieenen Apologeten des Spätbürgertums allein schon eine Blasphemie. Und blasphemisch geht Braun hier generell seinem Stoff zu Leibe, travestiert im 1. Material Goethes berühmte Zeile „Wie herrlich leuchtet mir die Natur“ nicht nur durch poetische Brechungen, sondern indem er sie strikt durch die eigene Daseinssituation in Frage stellt: wie im Zeitraffer wechseln Szenen, Gespräche, Kommentar und Zitat, sinnlicher Akt mit abstrakter Reflektion, um die brennenden Fragen der Zeit in ihrer Bewegung zu erfassen.
Solchen Situationslyrismen werden historische Begebenheiten entgegengesetzt, Material gibt am Beispiel Che Guevaras die tödliche Problematik aktueller Historie.
„Die Suche nach dem Stoff (zum Schreiben, zum Leben), um gegebenenfalls den Tod zu finden“ – sie wird selbst Struktur dieser Texte, um die „Mechanismen des Zeitalters auseinanderzuschrauben, die Beziehungen zu zerfasern nach dem geheimen Blut der Geschichte.“ Wir können hier nur Fragment-Zitate für einen großen Zusammenhang geben. – Im prosaischen „Höhlengleichnis“ schließlich stoßen wir im Schlußsatz auf das Motiv, das seinem neuen Gedichtband den Titel gibt:
Aber in dieser Zeit begann ein neues härteres Training, des schmerzhaften und wunderbaren aufrechten Gangs.
Dieser Satz zielt auf einen wichtigen kritischen Aspekt. Ernst Bloch, bei dem Bild und Begriff vom aufrechten Gang philosophisch interpretiert werden – er erscheint schon in Herders „Ideen zur Philosophie der Geschichte“ – entwickelt ihn bei Betrachtung des Naturrechts und gibt ihm eine utopische Größe. Bloch sagte 1965 in einem Interview dazu:
… daß das Naturrecht, das Recht auf menschliche Würde, vom Bürgertum in der Aufklärung ausgebildet, nicht in den Marxismus hineingekommen ist. Die sozialen Utopien betrachtet Engels als Vorstufen zum wissenschaftlichen Sozialismus, das Naturrecht dagegen, das (…) die kämpferische Ideologie für die Herbeiführung und Ermöglichung von aufrechtem Gang ist, das ist nicht aufgenommen worden (…) Die Abschaffung des Zustandes, in dem es Mühselige und Beladene gibt, das ist das Thema der sozialen Utopien gewesen, dann das Thema des wissenschaftlichen Sozialismus. Dagegen die Abschaffung des Zustandes, in dem es Erniedrigte und Beleidigte gibt (was eine ganz andere, nicht ursächlich getrennte, aber doch andere Sphäre darstellt), diese Art Abschaffung ist nicht theoretisch vom Marxismus durchdacht worden. Infolgedessen haben wir heute praktischen Anschauungsunterricht schrecklicher Art, daß die bloße Vergesellschaftung der Produktionsmittel nicht die Springquellen des gesellschaftlichen Reichtums in Gang setzt (…) Die staatskritischen Prämissen (…) – dieses: Wie rette ich den einzelnen Menschen vor dem Staat? sind nicht zu Ende gedacht worden (…) Also das Subjektive nicht als ein Ersatz für die materiellen gesellschaftlichen Kräfte, sondern als der zweite Akt, der zugleich im ersten Akt, in der ökonomischen Bewegung mit enthalten ist, damit das Leben gesellschaftlich in Ordnung kommt und es nicht zwei Arten von Menschen gibt, Herren und Knechte…
– Volker Braun, „Ist es zu früh. Ist es zu spät“:
Der Sommer ist vor der Tür.
Die hellere Zeit. Und starr noch
Blüht alles, die Gedanken. Wie wenig frei
Gehn wir aus uns, und hängen
In unsern Häusern. Und was sind das für Genossen
Ungleich selbst, und dulden die Räubereien
Hinter den Meeren
Oder Preußens Pfützen…
Ist es zu früh. Ist es zu spät.
Ein Loch brechen in die Reden
Und sehn, wie wir uns selbst
Zu gemalten Männlein machen. Unter die alten
Töpfe schmeißen, aus denen wir ewig
Fressen, daß wir nicht reif sein
Uns zu geniessen. Das Freudigste
Im Zorn sagen
Um bei Sinnen zu bleiben.
Ich kann es nicht anders machen.
Braun hat diese selbstkritischen Erwägungen Thomas Müntzer gewidmet, weil ihm die Historie ständig Muster für die eigene prekäre Lage zu bieten scheint. Er notiert beim Lesen der Briefe Georg Büchners:
Wir ehren Müntzer, wir ehren Heine, wir ehren Lenin und wissen kaum, von wem wir reden. Diese Leute, gestehn wirs nur ein, sind noch immer kaum zitierbar (…) Müntzer: Sein Prager Manifest ist nicht so gänzlich verjährt; wie unsere Umarmung glauben machen will; man stelle den Mann nur auf die Bühne mit seiner ,ausgedrückten Entblößung‘, und er wird abgesetzt werden vor der ersten Vorstellung. Lenin: Das bloße Hersagen seiner Aprilthesen eine Provokation, das Aufzählen der Mitglieder seines Politbüros ein diplomatischer Skandal. Und das schreibe ich im sozialistischen Preußen und Sachsen; im kapitalistischen Hessen oder Bayern sind das noch Unpersonen (…) Wahrlich ,die Losung der Ulbrichtzeit hat ihren Sinn: wir haben diese Leute überholt, ohne sie einzuholen.
Wer so spricht weiß, daß eine deckungsgleiche Identität des Verses mit der wirklichen Gefühls- und Bewußtseinslage nur annäherungsweise zu erreichen ist, wenn Alternativen in der Realität fehlen.
Welche Verwüstung, welche Erbauung
in meinem beliebigen Kopf…
Und dieser Kopf, ist durchaus nicht beliebig, sondern nur wie jeder andere den oft sich selbst widersprechenden Widersprüchen ausgesetzt, auf denen er eigenwillig beharrt gegen die übliche verbreitete herrschende „im Kopf wohlgeordnete Welt“.
Wie mich dieses beliebige Jahr
getötet hat und belebt
Und entwaffnet bis an die Zähne…
Wie sie verkommen ist meine Freude
Erstochen von blanken Worten
Und wie sie überlebt wie eine zähe Katze
Überlebt und vor die Hunde geht
Und immer noch in mir zappelt…
Womöglich war es mein Fehler
Daß ich mich nicht entschloß
In Schwarz zu gehn oder ganz in Weiß
Zu den vorgeschriebenen Stunden.
Ich denke, wir gehören zu einer aussterbenden Art
Die es verlernt hat, sich gelten zu lassen
Und fröhlich fröhlich zu sein
Oder traurig
Und ich bin ein beliebiger Mensch und nicht zwei
Und dies zerreißt mich
Und das ist mein Fehler.
Sicher: Dieser beliebige Mensch ist nicht auswechselbar, wie ein beliebiges Jahr kein x-beliebiges ist, sondern wie die Vorkommnisse konkret; Vorkommnisse, die sich allerdings mit ihren harten Konflikten zwischen denkendem Individuum und funktionaler Gewalt auch in der sozialistischen Gesellschaft zäh wiederholen: Der Mangel an real existierender Freude. Volker Brauns Gedicht „Der Müggelsee“ jedenfalls, das ein bekanntes Muster aufnimmt und gleichzeitig zerstört, ist unschwer nach den Ereignissen vom November 1976 zu datieren, die nicht nur Freunde auseinanderrissen:
Aber am schönsten ist
Von des schimmernden Sees Traubengestaden her
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaain der Zeit Wirre
Die die Freunde verstreut roh
Vom Herzen mir, eins zu sein
Mit seinem Land, und
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaGedacht
Mit Freunden voll das Schiff, fahre ich
Fort in dem Text, den der Ältere
Verlauten ließ, an einen anderen Punkt.
aaaaaaaaaaaaUnd auf den Bänken Bernd
Still lächelnd, Reiner, geblecktes Gebiß
Wolf schreind ein freches Lied
Und wir säßen im selben Boot
Auf der selben Welle noch, vor welchem Ufer
Ist mir egal und sei es getrockneter
Mist in Preußen, du kämest, Freude
Volles Maß auf uns herab!
Aber ich fahre hin, an den dunkleren Punkt
Der Geschichte, der ein froh Gesicht
Verzieht zur Fresse, und die beschämend
Schöne Natur geschenkt
aaaaaaaaaaaaaund Sarah vom siebzehnten Stock
Stürzt über die Mauer, ihr Liebes-
lied voll Raben! Raben!
Schwarz, unter Wasser.
Geblähte Fahnen. Aber aus dem Kahn
Kippen sie, die der Kurs fremd
Ankommt, oder von sturen
Schlägen gewippt in die Brühe.
Fröhliches Wasser
aaaaaaaaaaaaUnd sie gehen unter
Aus dem freudigen Text in den bitteren hier
Den ich knurre, ein Gram
Nicht des Schweißes wert.
Klopstocks Ode „Der Zürchersee“ von 1750 gilt als Beispiel der Hymne auf Natur und Freundschaft, mit der sich einst bürgerliches Selbstbewußtsein im Vorfeld künftiger Revolution im Gesange freispricht, der „Freude volles Maß“ in neuer Sprache zu feiern. „Schön ist, Mutter Natur, deiner Schöpfung Pracht…“: die Zeile steht am Beginn einer Epoche deutscher Lyrik. Klopstock beschreibt eine Fahrt auf dem Zürchersee, im Boot die Freunde, die bei Namen genannt werden, die Lieder der nicht anwesenden Freunde singend, und die Göttin Freude selbst ist mit ihnen – Freude, die Schwester der Menschlichkeit. Unsterblichkeit aber ist die Sehnsucht der Fahrenden – ein großer Gedanke, des Schweißes der Edlen wert, wenn ihre Lieder – wie es ja nun eingetroffen ist noch von den Enkeln gekannt werden:
O so bauten wir hier Hütten der Freundschaft uns!
Ewig wohnten wir hier…
Braun, dem Nachgeborenen am märkischen Müggelsee, der sich der Ode Klopstocks erinnert, sind freilich solche wohl gefügten Zeilen heute verwehrt. Die Fahrt mit den Freunden im Boot – er nennt sie, wie Klopstock einst, bei Namen – ist nur noch eine Fahrt, gedacht in der Phantasie. Nah sind sie ihm nur noch in diesem bitteren Text, der oft mitten in der Zeile jäh abbricht – „verstreut roh vom Herzen mir“, die Freunde Bernd Jentzsch, Reiner Kunze, Wolf Biermann – von gemeinsamer Fahrt und Freude ausgeschlossen. Brauns Verse, von Klopstock vorgegeben, vorgegeben ihr harmonisches Maß, stocken mitten im Takt:
Aber am schönsten ist
… eins zu sein
Mit seinem Land, und
Der Hymnus auf die schöne Natur ist nicht möglich, Harmonie von Umwelt und Bewohnern gestört, Freundschaft nicht realisierbar mehr, sondern Vision. Gesang bitterer Text, nicht des Schweißes wert. Und aus der Unmöglichkeit der vollkommenen Ode, aus der schroffen Absage, entsteht ein anderes Gedicht, das uns nun durch diese Verstörung berührt: Freundschaft dauert im gebrochenen Vers.
Wie hieß es doch:
Was mir die Augen, öffnet nicht die Lippen
Was ihn sprechen läßt, ist mit Händen nicht mehr zu greifen, das Gedicht ist Instrument der Utopie. Einer Utopie freilich, die nicht frei in der Luft schwebt, sondern sich auf die Kenntnis historischer Entwicklungen beruft. Braun notiert bei der Lektüre von Briefen Georg Büchners:
Ich studierte die Geschichte der Oktoberrevolution und watete durch das Blut der dreißiger Jahre. Ich sah mich gegen eine Wand von Bajonetten wandern. Ich spürte die Tinte der Lügen brennend auf meiner Haut (…) Die Fragen zu fragen, gestern tödlich, heute ein Schnee. Der Gesamtplan der Wirtschaft, das Tempo der Industrialisierung, der Sozialismus in einem Land: „die Partei ist kein Debattierklub“ – aber die Geschichte diskutiert die Fragen zuende. Viele Verräter von einst wortlos rehabilitiert durch den Gang der Dinge. Ein Gang blutig, hart, irrational: solange wir geduckt gehn, blind, unserer Schritte nicht mächtig. Die sinnlosen Opfer, weil wir die Gangart nicht beherrschen (es gibt notwendige Opfer), „Personenkult“, die feige Ausrede, die alles erklären soll, ein Augenauswischen. Statt einzuhalten im fahrlässigen Marsch, das Gelände wahrzunehmen, die Bewegung zu trainieren. Das Training des aufrechten Gangs.
Aus solchen Erwägungen beziehen Brauns neue Verse ihre unbequeme Dialektik – Dialektik, von der man so viel redet, und die doch so schnell ideologisch-positivistisch-pragmatisch-dogmatisch-realitätsfremd beiseitekritisiert wird, ihr Sprecher ein Abweichler, auf den man mit Fingern zeigt, wie der historische und deshalb aktuelle Ketzer Bruno:
Schwieriger Umgang mit dem Abweichler
Es hilft nicht, die Instrumente zu zeigen:
Er hat sie beschrieben.
Er beharrt, auf seinem feindlichen Standpunkt
Daß sich die Erde bewegt
Die Vernehmer glauben sich zu verhören
Im Knast agitiert er die Mönche
Als wüßten sie nicht wo Gott wohnt
Die Folter verfängt nicht: er singt ein Tedeum
Wohin mit ihm? die Hölle nimmt ihn nicht auf
Verbrennen wäre die Lösung, doch die ist nicht neu.
Brauns Gedichte sprechen eine deutliche Sprache, die aber unsere Deutung verlangt, das heißt unsere Mitsprache, denn darauf ist er aus. Er, den alles trifft und der es ablehnt, die verordnete Miene zu tragen zu den vorgeschriebenen Stunden, er, der auf die Geräusche seines Landes hört wie auf den eigenen Schrei, in die eigene Stille, ein beliebiger Mensch, mit uns vertrauten Ängsten und Hoffnungen, ein Dichter, der gesteht:
Ich sehe alles ein. Ich lebe gern.
Arbeite esse rede. Aber was
Ist das woran mein Kopf stößt…
Ein beliebiger Mensch, der sich selbst eine Satzung zu geben sucht, seine Irrtümer zu begründen, diese Arbeit, die ihn zerreißt, der Prozeß dauert an.
Ich bewege mich auf dem Boden der Gesetze
Gewiß doch, ihr Lieben!
Meines Herzens, das in jedem Körper schlägt
Legal und zerstörerisch, unzüchtig und sanft.
Ich vereinige die wirkliche Sehnsucht
Und die wirklichen Küsse
Die Verzweiflung und die Detonationen
Der Sinne.
Vor allem aber, entgegen dem äußeren Anschein
Versammle ich in mir
Die Freude, den unbedenklichen Stolz
Das Aufatmen bei der Ankunft
Der Wahrheit.
Sehr ihr, ich kann nicht reden von dem
Was ich schon weiß: nur von dem was ich entdecke…
Wie heißt es doch in Ernst Blochs Schrift Naturrecht und menschliche Würde“am Schluß:
Der rote Glaube war immer mehr als Privatsache, es gibt ein Grundrecht auf Gemeinde, auf Humanismus, auch politisch und im Zweck. Dazu war das fordernde Recht unterwegs. Die Eunomie des aufrechten Gangs in Gemeinsamkeit; nicht nur der Kunst ist der Menschheit Würde in die Hand gegeben.
Auch davon sprechen die Gedichte Volker Brauns.
Gerhard Wolf, die horen, Heft 124, 4. Quartal 1981
VOLKER BRAUN
Die landschaft seiner worte ist keine
sanfte gegend
mit stillen sammelplätzchen
ansichtskartenidyll
umgewandelt zu großen bauplätzen
liegen die wortfelder
offen und rissig
wer herkommt soll nicht
sich erbaun sondern mitbaun
Franz Hodjak
In der Reihe Klassiker der Gegenwartslyrik sprach Volker Braun am 9.12.2013 in der Literaturwerkstatt Berlin mit Thomas Rosenlöcher.
Welche Poeme haben das Leben und Schreiben von Karl Mickel und Volker Braun in der DDR und Michael Krüger in der BRD geprägt? Darüber diskutierten die drei Lyriker und Essayisten 1993.
Zum 80. Geburtstag des Autors:
Katrin Hillgruber: Der ewige Dialektiker
Der Tagesspiegel, 5.5.2019
Rainer Kasselt: Ein kritischer Geist aus Dresden
Sächsische Zeitung, 7.5.2019
Hans-Dieter Schütt: Die Wunde die bleibt
neues deutschland, 6.5.2019
Cornelia Geißler: „Der Osten war für den Westen offen“
Frankfurter Rundschau, 6.5.2019
Helmut Böttiger: Harte Fügung
Süddeutsche Zeitung, 6.5.2019
Erik Zielke: Immer noch Vorläufiges
junge Welt, 7.5.2019
Ulf Heise: Volker Braun – Inspiriert von der Widersprüchlichkeit der Welt
mdr.de, 7.5.2019
Oliver Kranz: Der Schriftsteller Volker Braun wird 80
ndr.de, 7.5.2019
Andreas Berger: Interview zum 80. Geburtstag des Dresdner Schriftstellers Volker Braun
mdr.de, 7.5.2019
Fakten und Vermutungen zum Autor + Linkliste + Archiv 1 + 2 + KLG
DAS&D + Georg-Büchner-Preis + Anmerkung zum GBP
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum +
Autorenarchiv Susanne Schleyer + Galerie Foto Gezett +
Dirk Skibas Autorenporträts + Brigitte Friedrich Autorenfotos
shi 詩 yan 言 kou 口


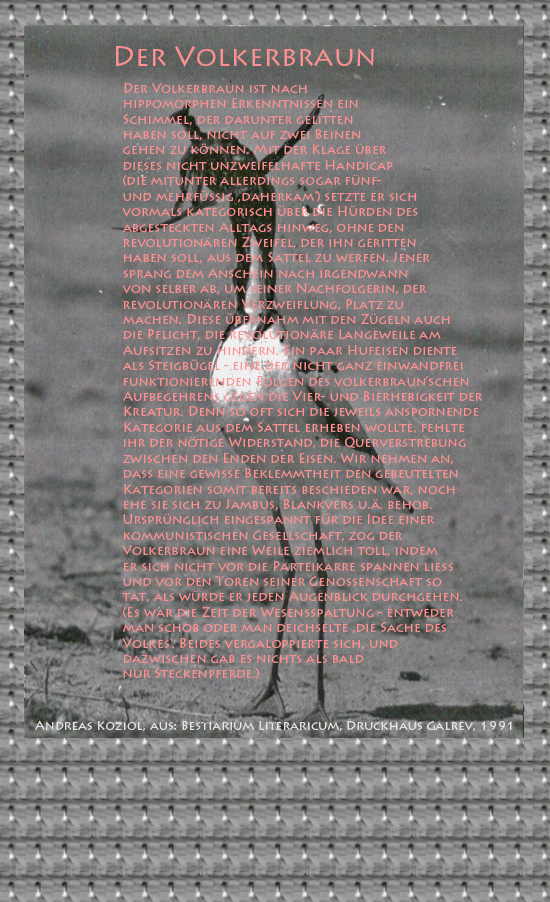
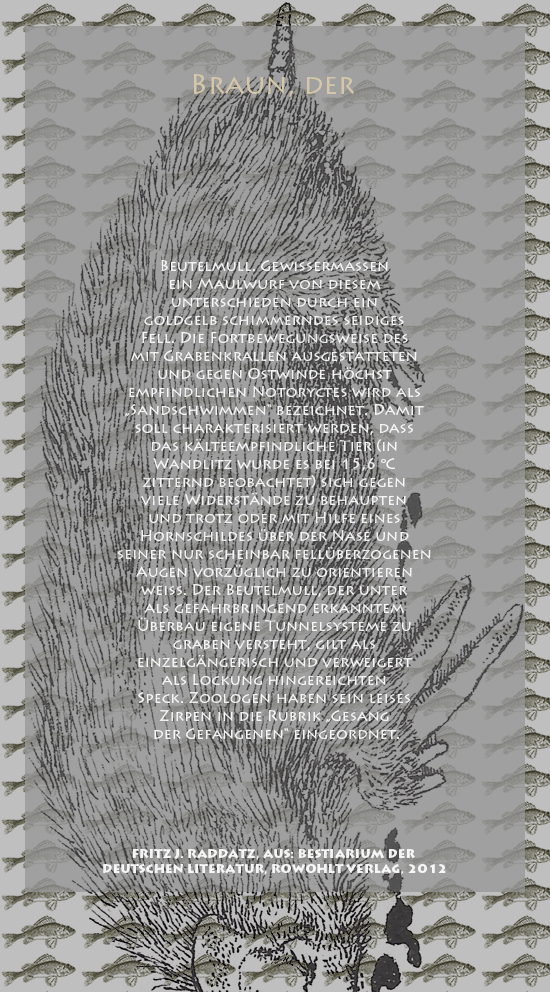
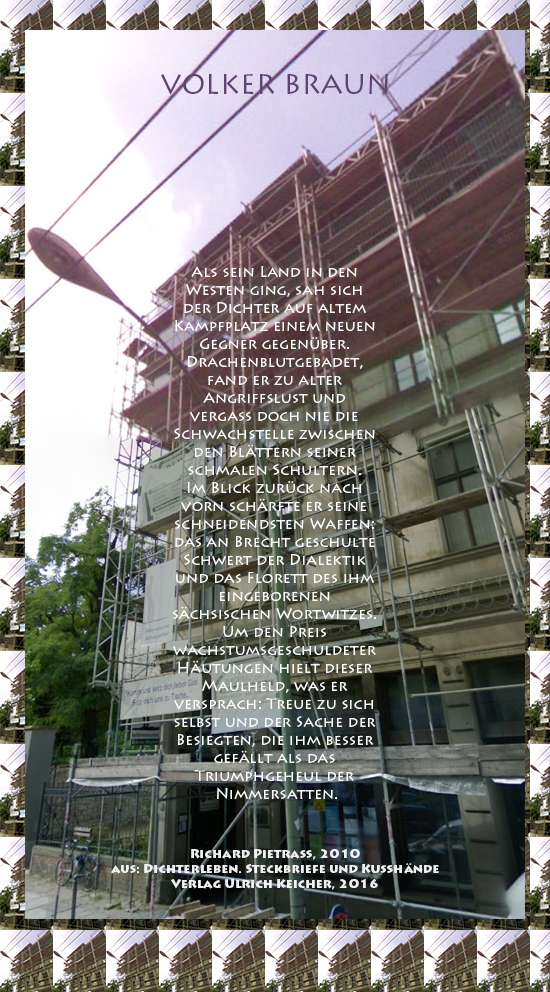








Schreibe einen Kommentar