Vor 95 Jahren, am Morgen des 24. Juni 1922, wurde Reichsaußenminister Walther Rathenau auf seinem Weg ins Auswärtige Amt von Mitgliedern des paramilitärischen Geheimbunds Consul ermordet. Consul war Deutschlands erste Terrororganisation, diese hatte ihren Ursprung in der Kaiserlichen Marine. Mark Jones ruft in Erinnerung, was sich bei dem Attentat in Berlin-Grunewald ereignete und fragt, welche Faktoren damals wie heute dazu führen, dass junge Männer zu Terroraktivisten werden.
Von Mark Jones

Gedenkfeier für Walther Rathenau, Juni 1923. Foto: Bundesarchiv I CC BY-SA 3.0 de
Sie parkten ihren Mercedes vor einem Haus in der Josef-Joachim-Straße, von wo aus sie auf die Königsallee, jene lange Straße, die den Grunewald mit dem Kurfürstendamm verbindet, blickten. Endlich waren sie so weit. Tags zuvor waren sie zu der Stelle gefahren, von der aus sie angreifen würden. Das Auto hatte falsche Nummernschilder, seine Insassen eine Automatikpistole und eine Handgranate. Sie trugen Hüte und hatten für den Anschlag spezielle Kleidung ausgewählt. Der Fahrer des Wagens zeichnete sich durch einen bodenlangen, modischen und teuren Ulstermantel aus. Als dann das Fahrzeug des Ministers in Sicht kam, hatten sie das Gefühl, als hätte sich die Zeit plötzlich verlangsamt. Ihr Wagen fuhr dem des Ministers hinterher. Der Rädelsführer, ein gewisser 23-Jähriger namens Erwin Kern, sagte zu seinem Komplizen, dem 20-jährigen Ernst Werner Techow: „Kerl, fahren Sie rasch, sonst holen Sie ihn nicht mehr ein!“ Kern hielt seine automatische Handfeuerwaffe bereit. Beide Fahrzeuge hatten das Verdeck heruntergelassen. Als der Wagen des Ministers das Tempo verlangsamte, um eine Kurve zu nehmen, brachte Techow den Mercedes auf gleiche Höhe, und Kern eröffnete das Feuer. Er sollte sein Ziel nicht verfehlen. Nachdem er mit dem Schießen fertig war, warf sein 26-jähriger Mittäter, Hermann Fischer, eine Eierhandgranate auf die Rückbank, wo Rathenau saß. Ihre Zielperson hatte keine Chance. Der Kugelhagel hatte ihren Körper durchsiebt, noch bevor die Granate explodierte. Um 11 Uhr am 24. Juni 1922 war Walther Rathenau tot. Ermordet hatte ihn Deutschlands erste Terroristenorganisation: die Organisation Consul.
Damals wie heute machte der Terrorismus Schlagzeilen. Die Jagd auf die Mörder setzte sofort ein. Die Berliner Polizei arbeitete, vielleicht aus Groll über Vorwürfe, die Ermittler hätten zu langsam auf die Ermordung Matthias Erzbergers im August 1921 reagiert, mit atemberaubender Geschwindigkeit. Schnell drang sie zum weiteren Komplizenkreis des Mordes vor. Das Automobil, das beim Anschlag genutzt worden war, wurde in seinem Versteck aufgefunden. Kurz darauf veröffentlichte man die Namen der Mörder, und eine dramatische Großfahndung begann. Die Reichsregierung setzte eine Belohnung von einer Million Mark für Hinweise aus, die zur Ergreifung der Mörder führten. Nach weniger als einem Monat war die Jagd beendet. Man hatte bereits Mitglieder des weiteren Komplizenkreises verhaftet, als Kern und Fischer, nachdem sie wiederholt knapp entkommen waren, am 17. Juli 1922 in ihrem Versteck in der Burg Saaleck (einer abgelegenen Burg unweit der Saale) aufgespürt wurden. Erwin Kern kam bei einem Schussgefecht mit der Polizei ums Leben. Fischer richtete daraufhin seine Waffe gegen sich selbst und beging Selbstmord – eine Erinnerung daran, dass die Dschihadisten von heute nicht die einzigen Terroristen sind, die lieber Selbstmord begehen, als sich der Polizei auszuliefern.
Damals wie heute müssen wir uns die Frage stellen, was aus diesen jungen Männern Terroraktivisten machte. Der Antisemitismus spielte gewiss eine Rolle, aber es wäre irreführend, in ihrer Gewalt einfach nur einen Ausdruck des Judenhasses zu sehen, der damals in der deutschen Gesellschaft weitverbreitet und quer durch Europa vorhanden war. Er war vielleicht ein wichtiger Kitt, der dabei half, die Organisation Consul zusammenzuhalten, aber er war nicht ihr Ausgangspunkt.
Es ist allgemein in Vergessenheit geraten, dass die Organisation Consul ihren Ursprung in der Kaiserlichen Marine und nicht in den Schützengräben der Westfront hatte. Konkret ging sie aus einer anderen Marineorganisation hervor: der 2. Marinebrigade, einem paramilitärischen Freikorps, das von früheren Marineoffizieren im Winter 1918/19 gegründet worden war. Zu den ausdrücklichen Zielen der Marinebrigade zählte nach dem Schock darüber, dass die Novemberrevolution ausgerechnet unter den Matrosen der deutschen Hochseeflotte ausgebrochen war, auch die Wiederherstellung von Ehre und Ansehen der Marine. Ihr Anführer, der später die Organisation Consul gründete, war der frühere Torpedoboot-Kapitän aus Kriegszeiten Hermann Ehrhardt.

Mitglieder der Kaiserlichen Marine. Foto: Bundesarchiv I CC BY-SA 3.0 de
Die Anführer jeder einzelnen der drei Geheimdivisionen der Organisation Consul waren im Krieg ebenfalls Torpedoboot-Kapitäne gewesen. Viele der wichtigsten Freiwilligen der Organisation unmittelbar unterhalb dieser Führungsebene hatten ebenfalls einen Marinehintergrund. Die Mörder Matthias Erzbergers hatten beide der 2. Marinebrigade angehört. Nach einer Aussage, die seine Schwester in den 1930ern gegenüber nationalsozialistischen Wissenschaftlern tätigte, war Erwin Kern „von Anfang bis Ende“ bei der 2. Marinebrigade. Bei seiner Beerdigung bedeckte die Kriegsmarineflagge seinen Leichnam, und seine Mutter stimmte das Ehrhardt-Lied, das Lied der Brigade, an. Insgesamt konnten fünf der neun Männer, die für ihre Rolle bei der Ermordung Walther Rathenaus zu einer Gefängnisstrafe verurteilt wurden, als frühere Mitglieder der 2. Marinebrigade identifiziert werden.
Wie kam es, dass Marineoffiziere den Kern stellten, aus dem heraus sich die Organisation Consul entwickeln sollte? Heute ist die Antwort auf diese Frage sehr viel leichter in Begriffe zu fassen als noch vor zwei Jahrzehnten. Wie 9/11 auf eindrückliche Weise vor Augen geführt hat, handelt es sich bei der Gewalt im Terrorismus um eine Form politischer Kommunikation. Durch einen Akt der Gewalt kann eine ansonsten unbekannte und randständige Gruppe von Personen oder sogar ein einzelnes Individuum eine Botschaft in die Welt senden, die sie ins Zentrum der politischen Aufmerksamkeit rückt. Diese bewusste Schockstrategie war für die Gewalt der Marinebrigaden und später der Organisation Consul von zentraler Bedeutung. Männer wie Ehrhardt und Manfred von Killinger, ein späterer nationalsozialistischer Reichskommissar, bedienten sich der Gewalt, um Rache für die Demütigung zu nehmen, die sie in Form von Revolution und Niederlage am Ende des Krieges erfahren hatten.
Dem Wesen der Niederlage in der deutschen Marine wird in historischen Darstellungen über das Ende des Ersten Weltkriegs nur selten Aufmerksamkeit geschenkt. Es ist in Vergessenheit geraten, dass als Teil der Waffenstillstandsbestimmungen allen verfügbaren Schiffen der deutschen Marine angeordnet wurde, in See zu stechen und der britische Flotte entgegenzufahren. Die deutschen Kriegsschiffe wurden anschließend einem demütigenden Kapitulationsritual unterzogen. Während die deutschen Soldaten von der Westfront in einigermaßen geordneter Formation nach Deutschland zurückmarschierten, mussten die Marineschiffe zwischen zwei Reihen britischer Kriegsschiffe hindurchfahren, wobei die britischen Kanonen auf sie zielten. Ehrhardt beschrieb später den Zorn, den er empfunden hatte, als sein Schiff in die Gasse aus zwei Reihen britischer Kriegsschiffe einfuhr und die Kriegsflagge einholen musste. Er behauptete später, seine Männer seien während der Nachkriegsgefechte und des Kapp-Putsches unter dieser Flagge seines Schiffes marschiert. Von Killinger hielt später schriftlich fest, dass er damals ein Versprechen ablegt habe, diesen Augenblick zu rächen. Während die Mehrheit der deutschen Besatzungen innerhalb von Wochen, nachdem sie ihre Schiffe nach Scapa Flow gebracht hatten, nach Deutschland zurückkehren konnte, blieben einige während der Internierungsphase als Rumpfbesatzungen zurück und zerlegten bekanntlich bei dieser Gelegenheit die deutschen Schiffe eher, als dass sie den Briten erlaubten, sie in Besitz zu nehmen. Zwei, die damals dabei waren, nahmen später Schlüsselpositionen in der Organisation Consul ein.
Das Bedürfnis, diesen Augenblick der Schmach durch die Anwendung von Gewalt wettzumachen, verlieh Ehrhardts Marinebrigade zusätzlichen Antrieb und hinterließ bei ihren radikalsten Mitgliedern eine Kultur der Gewaltausübung, die sie zu spektakulären Mordanschlägen anregte. Rathenaus Ermordung, die sich etwas weniger als vier Jahre nach dem Ende des Krieges ereignete, war nicht nur darin begründet, dass er Jude war. Sie sollte den Attentätern erlauben, ihr eigenes Heldentum zu inszenieren und so den Ehrverlust, den sie bei ihrer demütigenden Kriegsniederlage empfunden hatten, wieder ausgleichen.
Mehr zu dem Thema auf dem resonanzboden
Der Aufstieg des rechten und linken Populismus in Europa – Können wir aus der Geschichte lernen?
„Religion ist beim Islamischen Staat eine Protestideologie”
Das Buch
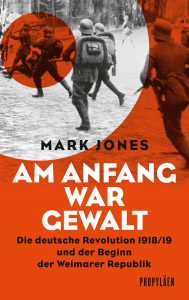 Der Historiker Mark Jones schildert die dramatische Gründungsphase der Weimarer Republik erstmals als eine Geschichte der Gewalt. Er zeigt, wie eine anfangs friedliche Revolution in einer Reihe von Tabubrüchen und Gräueltaten endet, einschließlich des Mordes an Frauen und Kindern durch Soldaten der sozialdemokratisch geführten Regierung. Diese Erfahrung wurde für das weitere Schicksal Deutschlands prägend – bis hin zur entfesselten Gewalt des NS-Regimes.
Der Historiker Mark Jones schildert die dramatische Gründungsphase der Weimarer Republik erstmals als eine Geschichte der Gewalt. Er zeigt, wie eine anfangs friedliche Revolution in einer Reihe von Tabubrüchen und Gräueltaten endet, einschließlich des Mordes an Frauen und Kindern durch Soldaten der sozialdemokratisch geführten Regierung. Diese Erfahrung wurde für das weitere Schicksal Deutschlands prägend – bis hin zur entfesselten Gewalt des NS-Regimes.
Links
„Am Anfang war Gewalt“ auf den Seiten der Ullstein Buchverlage
Mark Jones auf Twitter und bei Facebook

