Seit der Hashtag #NotJustSad letzte Woche bei Twitter auftauchte, bricht über das soziale Netzwerk eine Welle von Erfahrungsberichten von an Depression erkrankten Menschen herein. Viele nutzen ihre Beiträge als Ventil, andere, um Nichtbetroffene zu informieren. Auch Unterstützung und Trost sind zu lesen. Gemeinsam ist ihnen eins: Sie rücken die Krankheit Depression fünf Jahre nach Robert Enkes Freitod wieder in die mediale Öffentlichkeit.
Warum dies wichtig ist und warum #NotJustSad nur der Anfang sein darf, das erläutert der Psychiater Peter Teuschel in seinem Kommentar.
von Peter Teuschel

(Foto: © Volkan Olmez via Unsplash.com)
Wir sind Millionen, wann hören uns die Nicht-Depressiven endlich richtig & dauerhaft zu?#NotJustSad
— Poetant (@Poetant) 11. November 2014
Der Hashtag #NotJustSad hat eine Tür geöffnet, nein, er hat sie eingedrückt, aus den Angeln krachen lassen. Es begann mit einigen Tweets, die @isaidshotgun, die Berliner Bloggerin Jana Selig, zum Thema Depression losgeschickt hat, hinein in diese Blackbox namens Twitter, in der Themen ebenso schnell untergehen wie viral werden können. Und plötzlich entstand Bewegung. Wie ein Erdrutsch, ausgelöst durch kleine seismische Beben, nahm die gewaltige Masse bisher still und leise an Depression Leidender Fahrt auf. Seither rauscht Tweet um Tweet in den virtuellen Raum. Die meisten bringen Nicht-Betroffenen näher, was Depression ist und was nicht.
Inspiriert von @isayshotgun’s heutigen Tweets gibts jetzt den Hashtag #NotJustSad für Tweets zum Thema Depressionen. Vorallem für Betroffene — Malaika (@Mali_2) 10. November 2014
Abends ins Bett gehen und denken… schon wieder nichts auf die Reihe gebracht. Also warum wieder aufstehen? #NotJustSad — Holger Dankelmann (@depressionart) 12. November 2014
Sich eine körperliche Krankheit wünschen, um nicht mehr mit der Psychischen leben zu müssen. #NotJustSad — PaParzival (@PaParzival) 12. November 2014
Andere twittern zornig über die Verständnislosigkeit, das Desinteresse und die Ignoranz von Gesellschaft, Familie, Freunden, Bekannten, Ärzten und Therapeuten. Die meisten aber scheinen sich lange Aufgestautes, zu lange Zurückgehaltenes von der Seele zu schreiben. „Wir sind Millionen …“
Cut. Twitter-App aus. Kaffeemaschine an.
Ich denke an Frau B., die ich heute in der Praxis gesehen habe. Sie stammt aus dem ehemaligen Jugoslawien, ist Ende 60 und seit sechs Jahren Patientin bei mir. Wie viele andere kam sie in den 1970er Jahren nach München. Als Gastarbeiterin. Hier sind ihre Kinder geboren, hier haben ihr Mann und sie gearbeitet. Harte Arbeit, aufzehrend, krankmachend. Jede Mark, dann jeder Euro ging nach Bosnien, wurde ins Haus gesteckt, in dem sie später mal wohnen wollten. Dann der Krieg. Das Haus zerstört, die Menschen in der Heimat traumatisiert oder tot. Die Erkenntnis: Hier bin ich eine Fremde, mein Zuhause gibt es nicht mehr. Der Mann starb vor zehn Jahren. Die Kinder? Der Sohn lebt in Berlin, er meldet sich gelegentlich. Die Tochter „hat eigene Sorgen“, Frau B. will sie nicht belasten.
Wir reden über Einsamkeit. Wie ist das, wenn der Mann schon zehn Jahre tot ist und man vermisst ihn immer noch? Jeden Tag. Und jede Nacht, in der sie um drei Uhr aufwacht mit klopfendem Herzen und wie in einem Reflex auf die andere Seite des Bettes greift, um ihn zu spüren und fühlt doch nur seine Decke. Die liegt immer dort, genau wie sein Kissen und sein Schlafanzug, frisch gewaschen und gefaltet. Die Therapeutin hatte ihr geraten, sich von diesen Dingen zu trennen, den Mann „gehen zu lassen“. Frau B. kann es nicht, will es nicht. Wir reden über ein Leben, das aus Arbeit bestand und einer Vision, wie die Zukunft sein sollte, eine Lebensplanung, die in Schutt und Asche liegt. Wir reden über die Schwierigkeiten, die sie hatte, ihre Rente zu bekommen, als sie erwerbsunfähig wurde durch ihre orthopädischen Probleme und die Depression. Sie will nichts Schlechtes sagen über das Land, dem sie ihre Arbeitskraft gegeben hat und dessen Gutachter ihr Simulation unterstellten. Sie hat hier Geld verdient, sagt sie. Sie hatte ihre Chance, Deutschland ist ein gutes Land, friedlich. Der Krieg zu Hause ist Schuld an allem. Nein, sagt sie dann, das ist es auch nicht. Das Leben ist einfach nicht so gelaufen wie geplant. Frau B. bekommt ihr Rezept von mir, ohne Antidepressivum wäre es nicht auszuhalten. Ob sie noch einmal eine Psychotherapie machen will, die dritte in all den Jahren, frage ich sie. Nein, sagt sie, nein, lieber kommt sie zu mir alle paar Wochen. Das Reden tue ihr gut. Dass ich zuhöre und „einfach da bin“. Über ihre Depression will sie mit anderen nicht sprechen. „Das kann keiner verstehen.“
Cut. Twitter-App an.
Stakkatoartig ploppen die Tweets auf. #NotJustSad ist die ideale Umschreibung für Depression. Kaum ein Depressiver ist traurig. Traurig sind wir Nicht-Depressiven. Depression ist wie versteinert sein, ohne Gefühle, ohne Emotionen. Oder ängstlich, verzweifelt, hoffnungslos, resigniert. Ohne Schwung, man sieht die Arbeit liegen und ist wie gelähmt, wie ausgeschaltet. Obwohl die innere Unruhe ständig Signale sendet: Tu was! Aber es gibt nichts, was man tun kann. Die Überzeugung: Es wird so bleiben, den Rest des Lebens. Nicht mal die Nacht verspricht Linderung. Dann fahren die Gedanken Karussell: Schuld, Versagen, Angst, Sorgen. Und morgen wieder ein Tag, so dunkel, quälend und sinnlos wie der heutige.
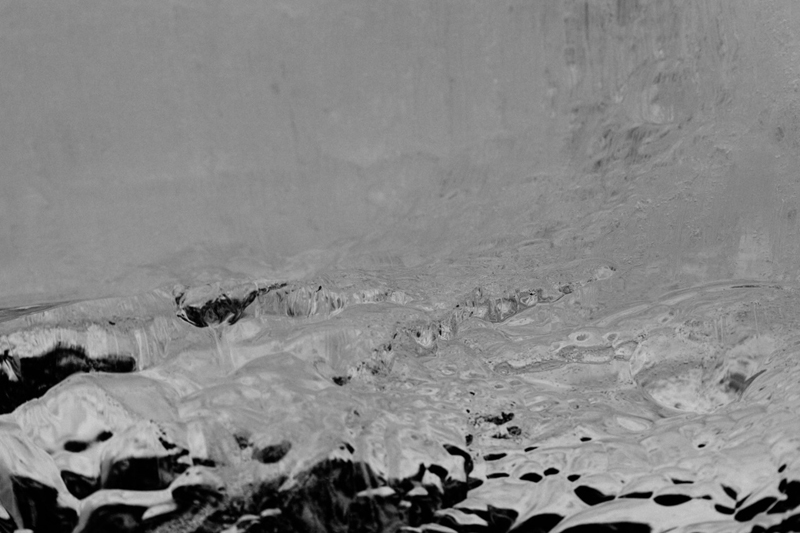
(Foto: © LittleVisuals)
Depressionen gehören zu den gut behandelbaren Erkrankungen. Den allermeisten Patienten können wir helfen, mit Psychotherapie, mit Medikamenten, mit Unterstützung in sozialen Belangen. Finden die Patienten den Weg zum Psychiater, so wird daraus in der Regel eine Erfolgsgeschichte. Nicht immer, wie die zornigen Tweets verraten, aber doch in den meisten Fällen. So gesehen verliert die Depression an Bedrohlichkeit, zumindest in Bezug auf den therapeutischen Zugriff auf die Störung. Wir können etwas tun.
Was wir schwerer beeinflussen können – und dagegen wendet sich #NotJustSad – ist die Ablehnung, die Ächtung, das Unverständnis und die Stigmatisierung, die Depressive in der öffentlichen Wahrnehmung erfahren. Der Drang sich mitzuteilen, sich Gehör zu verschaffen, ist daher mehr als verständlich.
Ist es für Depressive sinnvoll, unter #NotJustSad zu twittern? Manche schieben einen um den anderen Tweet nach, wie im Rausch. Endlich gibt es mal ein Forum, endlich kann ich sagen, was ich empfinde. Und es wird gelesen. Vielleicht nicht jeder Tweet, aber alle Online-Medien berichten. Kommt nach dem Rausch die Ernüchterung? Der Twitter-Kater? Wenn ich merke, es bleibt alles so, wie es vorher war? Ist #NotJustSad nur die aktuelle Sau, die durchs virtuelle Dorf getrieben wird? Oder entsteht etwas daraus, das weiter reicht als ein paar Tage medialer Aufmerksamkeit?
Ich überlege: Frau B. und #NotJustSad – wie geht das zusammen? Profitiert sie von dieser Bewegung? Sie und die mehreren hundert depressiver Patienten, die wir allein in unserer Praxis jedes Quartal behandeln? Was wäre dafür erforderlich? Sicherlich mehr als eine Handvoll Ärzte und Therapeuten, die zuhören, ernst nehmen, unterstützen, helfen.
Ich lese noch ein paar Tweets und schalte die App wieder aus. Feierabend.
Wo ist das, dieser virtuelle Raum? Wie bekomme ich diese Dynamik ins Leben, hierher, in meine Sprechstunde, an die Arbeitsplätze, in die Familien, an die Stammtische, in die öffentliche Meinung?
Auf der Straße eilen die Menschen busy, busy an mir vorbei. Ich stelle mir vor: Der Himmel öffnet sich und die Tweets werden vom Herbstwind herbeigeweht. Jeder ein Dreiklang, die meisten in Moll, einige in Dur, viele dissonant, aber keine Kakophonie, nein, eine Klangwolke, die die Menschen erreicht wie eine Symphonie von Tschaikowski und jede Frau und jeden Mann zu einem Resonanzboden für die Botschaft macht, dass uns nicht Ausgrenzung, sondern Miteinander die Zukunft sichert.
Go on, #NotJustSad. Es ist noch ein weiter Weg.

(Foto: © Tirza van Dijk via Unsplash.com)


[…] #notjustsad – Eine zornige Klangwolke […]
[…] mal, was Peter Teuschel hier unter resonanzboden […]
[…] meinem Beitrag für resonanzboden.com zum hashtag #NotJustSad habe ich über eine Patientin berichtet, die noch zehn Jahre nach dem Tod ihres Mannes dessen […]
[…] • Do’s und Don’ts im Umgang mit Depressiven/suizidalen Menschen • Kommentar zum Hashtag von einem Psychiater […]
[…] Erst vor einigen Wochen haben sich unter dem Hashtag #notjustsad an Depression erkrankte Frauen und … Letztlich ist das nur die Spitze des Eisbergs. […]
[…] Kennt Ihr den Hashtag #NotJustSad? Auf Twitter findet man unter ihm viele Mini-Geschichten zum Thema Depression. Auf dem Blog des Ullstein Buchverlags hat ein Psychologe einen wunderbaren Text dazu veröffentlicht: Eine zornige Klangwolke […]