Harry Mulisch: "Schwarzes Licht"
Typisch Mulisch!
Der Roman "Schwarzes Licht" wurde im Original erstmals im Jahr 1956
veröffentlicht, es handelt sich somit um ein Frühwerk
Mulischs, für die im Jahr 2016 erschienene Neuauflage vom
preisgekrönten Übersetzer Gregor Seferens (Jahrgang 1964)
knusprig frisch ins Deutsche übertragen. Gregor Seferens
behandelte übrigens in seiner Magisterarbeit das Thema "Die
Rezeption Karl Mays in den Niederlanden"
und erhielt im Jahr 2000 für seine Übersetzung von Harry Mulischs Roman "Die
Prozedur" den "Else-Otten-Übersetzerpreis".
Fünf Jahre nach Harry Mulischs Tod erschien anno 2015 in den Niederlanden sein
unvollendet gebliebener Roman "De ontdekking van Moskou", von Literaturkritikern als
"unmögliches
Buch" und "Fehler" bezeichnet. Denn es handelt sich um vom
Kulturwissenschafter Arnold Heumakers und der Literaturwissenschafterin Marita Mathijsen sachte bearbeitete und
nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellte Fragmente
aus dem Nachlass, doch gerade Mulischs spezieller Stil und seine Technik, Romane
lustvoll zu komponieren, sind im Grunde unnachahmlich. Der Leser wird also
ausdrücklich eingeladen, seine eigene Fantasie spielen zu lassen und den Roman
selbst zu vollenden, wie Harry Mulisch einst selbst meinte: "Niet de schrijver, de
lezer moet fantasie hebben. De lezer is niet de toeschwouwer van een toneelstuk,
maar de acteur die alle rollen uitbeeldt. De lectuur is zijn hoogsteigen creatie.
De schrijver levert tekst - maar een artistiek werkstuk wordt het pas door het
talent van de lezer." (Aus "Voer voor psychologen")
Dem Vernehmen nach stimmte Harry Mulisch vor seinem Tod der
Veröffentlichung der Fragmente bzw. verschiedenen Versionen zu. Zu
bedenken ist jedenfalls, ob nicht der Reiz sämtlicher Bücher
von Harry Mulisch bis zu einem gewissen Grad darin besteht, niveauvoll,
aber doch "unmöglich" zu sein?
Wer sich nicht in
erster Linie für lineare Entwicklungen, chronologische Abfolgen und vorhersehbar
agierende biedere Figuren interessiert, ist im
Erzählkosmos des Harry Mulisch gut und richtig aufgehoben.
Jedoch gehört "De ontdekking van Moskou" als Werk über das Schreiben an sich
sowie über eine missglückte Expedition im 15. Jahrhundert zweifellos nicht zu
seinen Meisterwerken. Der unvollendete Roman diente Mulisch über die Jahrzehnte
immer wieder als Fundus für Motive und Geschichten, die er anderweitig verwendet
hat, weswegen man nicht umhin kann, das nach seinem Tod erschienene Buch als
ausgeweideten Torso zu betrachten.
Über "De ontdekking van Moskou", damals noch unveröffentlicht, schrieb Cees Nooteboom in seinem
in "Die Zeit" auf Deutsch am 3. November 2010 erschienenen von Helga von Beuningen
übersetzten Nachruf unter dem
Titel "Er wog die Welt. Harry Mulisch, mein 'Freund vom Montagabend' ist tot": "Der Krieg war und blieb das Maß
aller Dinge, er war auch Gegenstand des Buches, das er hatte schreiben wollen
und zu dem es nie kam, weil die Wirklichkeit sich in diesem Punkt nicht besiegen
ließ - das Buch, in dem erzählt werden sollte, wie es gewesen wäre, wenn Hitler
den Krieg gewonnen hätte: De ontdekking van Moskou ('Die Entdeckung von
Moskau')".
Bizarre Namen, kuriose Todesarten (z.B. von einem Brocken aus dem
Weltall erschlagen, oder als Taucher zunächst von einem
Löschflugzeug mit Wasser aus dem Meer geschöpft und dann
über brennenden Olivenbäumen ausgeleert zu werden, oder
plötzlicher Tod im Wiener Nobelhotel), grenzgängerische,
hochbegabte Außenseiter, schräge Verhaltensweisen und
überraschende Kehrtwendungen in Handlungsverläufen - derlei
prägt Harry Mulischs Werke. Man ahnt, dass der Autor beim
Schreiben nicht selten selbst viel Vergnügen empfunden hat, dabei,
seiner üppig wuchernden Fantasie die Zügel schießen zu
lassen.
Die Kehrseite der Medaille sind Schwächen wie
allmachtsfantsiengleiche egomanische Züge, extreme
Männerdominanz, ausufernde Abschweifungen, erzählerische
selbstverliebte Untiefen und langatmige literaturtheoretische
Ausführungen; ja, mitunter ist auch Durchhaltevermögen
gefragt! Bewusst hat Mulisch sein berüchtigtes Schwadronieren z.B.
im Roman "Die Prozedur" eingesetzt, denn erst nach einem
erschöpfenden Kapitel über Buchstaben- und Zahlenmystik
begrüßt der Autor jene Leser, die sich wacker
durchgekämpft (oder einfach vorgeblättert!) haben: "So, das wäre geschafft.
Wir sind unter uns. Die unreinen Mitleser sind vor all diesen gespenstischen
Buchstaben Hals über Kopf geflohen." (S. 15).
Harry Mulisch war eine Ausnahmeerscheinung in der niederländischen
Literaturszene. Der vielseitige Schreiber verfasste nicht nur Romane und
Erzählungen, sondern auch Gedichte, Bühnenstücke, Opernlibretti, Essays und im
weiteren Sinn philosophische Werke. Er interessierte sich für
Naturwissenschaften (was mitunter in seinen Romanen für gedehnte Passagen
sorgt), Musik, Esoterik, Alchemie und
nicht zuletzt für Wein (nach der Diagnose "Magenkrebs" musste er seinen
Weinkonsum allerdings drastisch einschränken) und Weib - und er liebte Rätsel ("Het
beste ist, het raadsel te vergroten").
In seinen Romanen kommt es nicht selten vor, dass sich Geheimnisse sozusagen
selbst schützen und ihre Entdeckung zu verhindern wissen ... Insofern ist die
fast unendliche Geschichte des Romans "De ontdekking van Moskou" und ihre
Verknüpfung mit dem Leben des Autors durchaus bemerkenswert.
Von
gewissen Themen war er als Schriftsteller
allem Anschein nach geradezu besessen. Schon als Knabe experimentierte
Harry Mulisch, dessen Lieblingsjugendbuch nicht von ungefähr "De
ongelofelijke avonturen van Bram Vingerling" (erschienen 1927) von
Leonard Roggeveen war, im Labor und stellte gern aberwitzige Theorien
auf; eine Herangehensweise, die auch in seinen Romanen sichtbar wird.
Ebenso faszinierten Zahlenmystik, Archäologie und
Männerfreundschaften den stets neugierigen, aufgeschlossenen
Autor, der im (männlichen) Orgasmus die menschliche Schaffenskraft
gebündelt sah. Somit ist es immer wieder verlockend zu
überlegen, wieviel Harry Mulisch jeweils konkret in seinen Figuren
stecken könnte.
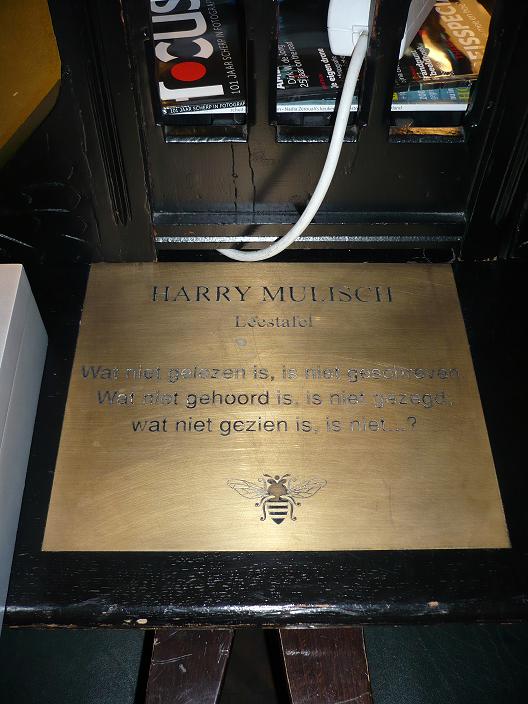
Gedenktafel im "Café Americain"
(Foto: D. Krestan) |
Wer Harry Mulischs
seit dem 29. Oktober 2011 mit einer Gedenktafel geschmückten einstigen Stammplatz am
Lesetisch im "Café Americain" aufsuchen möchte:
Das Lokal befindet sich in
Amsterdam, Leidsekade 97.
Die Inschrift lautet:
"Wat niet gelezen is, is
niet geschreven. Wat niet gehoord is, is niet gezegd.
Wat niet gezien is, is
niet ...?"
Der Legende nach ließ sich Harry Mulisch, als er noch nicht prominent war,
regelmäßig von Kellnern im Café ausrufen:
"Telefoon voor de heer Mulisch!"
Auf diese Weise gelang es ihm, nachhaltig die Aufmerksamkeit der anderen Gäste zu
erregen.
|
|
|
 |
| |
Harry Mulischs ehemaliges
Wohnhaus
(Foto: D. Krestan)
Seit einiger Zeit findet
alljährlich in Amsterdam ein "Harry Mulisch-Festival" mit
Lesungen, Diskussionen und Musikdarbietungen statt, auch kann das
Arbeitszimmer des Autors in seiner ehemaligen Wohnung an der
Leidsegracht besichtigt werden.
|
|
"Ik heb de oorlog niet zo
zeer 'meegemaakt', ik bén de Tweede Wereldoorlog." (Harry Mulisch)
Harry Kurt Victor Mulisch, am 29. Juli 1927 in Haarlem geboren, war das einzige
Kind
eines österreichisch-ungarischen Vaters (Karl Victor Kurt aus Gablonz im
Sudentenland, geboren 1892, gestorben 1957; nach dem Ersten Weltkrieg in die
Niederlande emigriert), der später als Arisierer jüdischer
Vermögen bei einer Amsterdamer Bank mit den Nationalsozialisten kollaborierte
und deswegen nach dem Krieg drei Jahre lang in einem Lager interniert war, und einer
belgisch-deutsch-jüdischen Mutter (Alice Schwarz, geboren 1908, gestorben 1996).
Zuhause wurde Deutsch gesprochen. Frieda Falk, Haushälterin und Kindermädchen in
Personalunion,
war für Harry Mulisch eine wichtige Bezugsperson.
Aufgrund seiner Stellung konnte der Vater
seine bereits seit dem Jahr 1936 von ihm geschiedene Ex-Frau und seinen Sohn vor der Deportation
bewahren. Harry Mulischs Großmutter und Urgroßmutter wurden in Sobibor ermordet.
Harry Mulischs Mutter emigrierte
später in die Vereinigten Staaten von Amerika, Harry blieb bei seinem Vater in den
Niederlanden.
1952 erschien Mulischs Debütroman "Archibald Strohalm" (über einen
langsam aber sicher den Verstand verlierenden Aussteiger und Möchtegernpuppenspieler, der die
Mitmenschen zu einer von ihm entwickelten allumfassenden Moralphilosophie bekehren will).
"Neben ihm, in einem sorgfältig ausgesägten Regal, hingen die Puppen mit
seelenlosen Körpern und umgeknickten Köpfen. Er nahm den Tod, steckte Daumen und
Mittelfinger seiner rechten Hand in die Arme, den Zeigefinger in den Kopf und
zog das weiße Leibchen faltenlos bis hinauf zu seiner Achsel. Die linke Hand
schob er in den Hanswurst.
'Bonjour', sagte der Tod. Archibald nickte im Namen von Hanswurst, der sich
verbeugte. 'Hier prinzipiell Mensch Mensch so wahr wie Narkose auf Kopf.'
'Früher war normaler Hut', sagte Hanswurst. 'Nun ist auch ihr weg', sagte der
Tod. Archibald nickte. Hanswurst lag bereits auf seinen Knien, der Tod hatte
sich an ihn selbst gewandt. 'Hab Schmerz', sagte er und verzog den Mund. 'Wird
großer prinzipieller Lärm sich erheben.'" (Aus "Archibald Strohalm")
Harry Mulisch berichtete aus Jerusalem über den Eichmann-Prozess
("Strafsache 40/61: Eine Reportage über den Eichmann-Prozess",
erschienen 1962). Unter seinen zahlreichen Werken, viele davon liegen
leider nicht auf Deutsch vor, finden sich neben dem im Jahr 2007 zum
"besten niederländischen Roman aller Zeiten" (!) gewählten
Meisterwerk "Die Entdeckung des Himmels", veröffentlicht in
jenem Jahr, als der Autor seinen 65. Geburtstag feierte, auch "Das steinerne
Brautbett" (über die Bombardierung Dresdens und die Rückkehr des einst beim
Angriff innerlich wie äußerlich entstellten us-amerikanischen Zahnarztes an den Ort des Grauens Jahre später,
erschienen 1959) sowie "Das Attentat" (1982 erschienen). "Die Prozedur", 1998
veröffentlicht, wurde anno
1999 mit dem "Libris Literaturpreis" ausgezeichnet. Auch "Siegfried. Eine
schwarze Idylle" (2001) wartete mit einer überraschenden Gedankenspielerei auf:
Adolf Hitler und
Eva Braun hätten einen Sohn gehabt; und jener niederländische
Schriftsteller, dem ein altes Ehepaar in Wien diese Geschichte anvertraut,
stirbt im "Hotel Sacher", ohne die Sensation zu Papier gebracht zu haben -
manche Geheimnisse bewahren sich eben selbst.
1971 heiratete Harry Mulisch die 21 Jahre jüngere Künstlerin Sjoerdje Woudenberg,
mit der er zwei Töchter, Anna und Frieda, hatte. Seit 1989 war er mit seiner
Freundin Kitty Saal zusammen, das Paar bekam im Jahr 1992 einen Sohn, Menzo.
Der passionierte Pfeifenraucher
Harry Mulisch bildete mit Willem Frederik Hermans (1921-1995) und Gerard
(Kornelis van het) Reve (1923-2006) das tonangebende Trio, "De Grote Drie", der niederländischen Nachkriegsliteraturszene.
Mangel an
Selbstbewusstsein war Harry Mulisch offenbar zutiefst wesensfremd, wie auch
Cees Nooteboom in
seinem vorstehend bereits erwähnten Artikel ausführte: "Man musste sich sehr
an ihn gewöhnen, und wenn ihm dieser Prozess zu lange dauerte, erklärte er ein
weiteres Mal, wen man vor sich hatte: 'Ich bin ein großer Schriftsteller, daran
gibt es nichts zu rütteln.'"
Grenzenlos selbstgewiss, großspurig, bereitwillig provokant, nie um eine schlagfertige Antwort
verlegen - so wurde Harry Mulisch von Zeitgenossen beschrieben. Auch galt
Mulisch als Salonsozialist mit Sympathien für Fidel Castro (seine Reisen nach
Kuba fanden Niederschlag im Roman "Die Entdeckung des Himmels"), als schwierig und
arrogant, als Frauenheld und
eitler Geck mit Hang zu teuren Anzügen und Sportwagen. Seine Freunde schätzten
vor allem seinen brillanten Intellekt und seine Ironie. Und seine Leserschaft
erfreut sich nach wie vor an außergewöhnlich eigenwilligen Büchern.
Ein Tag im Leben des Maurits Akelei: Menschliche Abgründe und "Schwarzes
Licht"
In diesem Roman begleitet man den sozusagen erst in seinem "zweiten Leben" wohl aus innerer Not zum
Glockenspieler mutierten einsamen Junggesellen Maurits Akelei durch seinen 46.
Geburtstag, der beinahe den Weltuntergang, einige höchst sonderbare Begegnungen
und Vorkommnisse, Momente des Wahnsinns, Scherben, Verletzungen und die simple
Rückkehr in die annähernd gewissenlose Normalität beschert: Ein Einzelgänger mit
belastender Vergangenheit und kaum Selbstdisziplin verwüstet sich und seine
Umgebung nach Kräften - eine häufige Ausgangssituation bei Harry Mulisch.
Unheilvoll braut sich an diesem schwülen Tag etwas zusammen, bald blitzt und
donnert es im übertragenen Sinn gewaltig - und dann ist alles vorbei, wie ein
Sommergewitter ...
Am 20. August 1953, einem Donnerstag, bringt Akeleis bombastisches Kirchturmglockenspiel die Stadt
buchstäblich zum Stillstand und sorgt für anhaltende Verstörung unter den
Mitbürgern. Die Gründe für sein furioses Spiel, seine Angstzustände und seine Verschrobenheit
erhellen sich erst nach und nach, indem sich aus Rückblicken und Gesprächen
bruchstückhaft die 23 Jahre zurückliegende Geschichte seiner damals umgekommenen
hünenhaften Freundin Marjolein zusammensetzt, als ein verhängnisvolles Studentenfest ebenso
wie Maurits' Welt gewaltig aus den Fugen geriet und zerstört wurde.
Und
auch jene nächtliche Feier, die Maurits Akelei eher widerwillig und lieblos
anlässlich seines 46. Geburtstags veranstaltet, sprengt (aus Sicht des Lesers
freilich erwartungsgemäß) bald die Grenzen des Anstands: Verstrickungen und
Verhältnisse werden enthüllt, während die unglücklich in Maurits verliebte Zimmerwirtin eine
beiseite geschobene Randfigur bleibt, ebenso wie der Küster Doornspijk, den
Akelei einzuladen vergessen hat.
Weiters treten auf: Der Arzt Doktor Manuel Pollaards, Frau Marianne Pollaards
(seine Gattin), Pastor Meindert Splijtstra, 54 Jahre alt, mit einer gelähmten
Frau verheiratet, eine Krankenschwester (die Langzeitgeliebte des Pastors), die
etwa sechzehnjährige Tochter Diana Splijtstra und Lex Ketelaar, Akeleis Freund
seit der Jugend.
Meindert Splijtstra, der ein Verhältnis mit Frau Pollaards unterhalten hat, und Lex Ketelaar,
inzwischen testosterongesteuerter erfolgreicher Industrieller und seit jenem
denkwürdigen Abend vor 23 Jahren von einer riesigen Narbe im Gesicht
verunstaltet, die Arztgattin Frau Pollaards, ein mannstolles Weibsbild (und
natürlich ebenfalls verliebt in Maurits), Diana und Unmengen von Pernod
verwandeln Akeleis Zimmer, das er mit Blumen und Girlanden geschmückt
hat, in einen Tummel- und Schauplatz elender, entlarvender zwischenmenschlicher Geschehnisse, man
wähnt sich als Zuschauer eines Theaterstücks.
Der übersensible, unter chronischem Husten leidende Maurits Akelei
wird von (einprägsam beschriebenen) Wahnvorstellungen
eingesponnen, Schuldgefühle haben sich seiner Seele
bemächtigt, denn die über weite Strecken beschworene Idylle
mit Marjolein fand einst ein schreckliches Ende, für das eine
offizielle Sprachregelung im Freundeskreis existiert. Im direkten
Umgang mit stets derselben Handvoll Menschen zeigt sich Akelei meistens
zurückhaltend und scheu, in Ausnahmesituationen allerdings
unerwartet derb und brutal, geradezu primitiv triebhaft. Die Einen
tragen eben ihre Narben sichtbar äußerlich, die Anderen sind
innerlich entstellt, und Wenige sind sowohl an der Oberfläche als
auch darunter mit Narben übersät (man denke z.B. an Norman
Corinth, die Hauptfigur des Romans "Das steinerne Brautbett").
Mit "Schwarzes Licht" bewies Harry Mulisch bereits anno 1956
eindrucksvoll, was in ihm steckte. Er riss jene Themen an, die ihn
anhaltend beschäftigen sollten: Schicksal und Zufall, Träume,
abstoßende Sexszenen, Lebensentwürfe, Geniekult, Moral,
Begierde, Mythologie, Spiele mit verschiedenen
Bewusstseinszuständen ... nicht zu vergessen: offene Enden, denn
für Geheimnisse und Rätsel hatte er wie bereits erwähnt
ein Faible.
Der (von ihm selbst so genannte) "kleine", berückend dichte Roman "Schwarzes Licht" wartet mit
zeitlos schrägen Sonderlingen, mulisch-üblichen wahnwitzigen Wendungen und
filmreifen Bildern auf; eben maximal Mulisch!
Obwohl Harry Mulisch einst kokett meinte: "Een minuut slecht
schrijven is beter dan een dag goed denken", gilt dies wohl primär für
Schriftsteller. Gut zu denken ist für talentierte Leser, wie Mulischs Bücher sie
voraussetzen, nämlich unabdingbar.
(kre; 04/2016)
Harry Mulisch: "Schwarzes Licht"
(Originaltitel "Het zwarte licht")
Aus dem Niederländischen von Gregor Seferens.
Verlag Klaus Wagenbach, 2016. 144 Seiten.
Buch
bei amazon.de bestellen
Lien:
Sandammeer-Interview mit Gregor Seferens