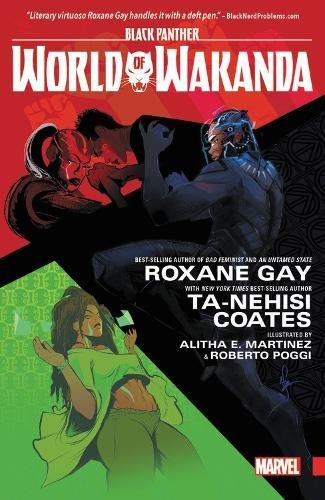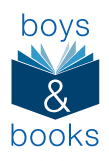Zwei größere Bücherprojekte konnte ich heute Morgen abschließen und am Wochenende zu einem älteren zurückkehren.
1.
In meiner genussvollen Beschreitung des kompletten offiziellen Kanons von Sherlock Homes Geschichten (inklusive Durchhören aller greifbaren dt. und engl. Hörspiele) habe ich heute Morgen das Ende des zweiten großen Kurzgeschichtenbandes „The Memoirs of Sherlock Holmes“ erreicht. Wie schon mal erzählt, lese ich die Geschichten diesmal nicht selbst, sondern lasse sie mir von Stephen Fry auf Audible im Original vorlesen, der das ganz wunderbar macht. Die letzte Geschichte in diesem Band ist „The Final Problem“, eine der berühmtesten Holmes-Geschichten, nämlich jene, in welcher er am Ende gegen Professor Moriarty an den Reichenbach Wasserfällen in der Schweiz kämpft und beide (vorgeblich?!) in ihren Tod stürzen. Wer auch nur entfernt mit Homes mal zu tun hatte, weiß, dass Arthur Conan Doyle in der Tat geplant hatte, seinen Helden hier sterben zu lassen. Kurze Zeit später aber brache er ihn in „Der Hund der Baskervilles“ zurück um ihn schließlich sogar in „The Empty House“ wiederzubeleben, so dass „The Final Problem“ eher wenig final war und noch viele offizielle Holmes-Geschichten folgen sollten. Alles altbekannt, ich erzähle das hier aber noch einmal um die wunderbare Vorlesekunst von Stephen Fry zu preisen: Ich habe das „Final Problem“ in meinem Leben schon einige Male gelesen, gesehen, gehört, oder sonst was, und obwohl ich natürlich sehr, sehr präsent habe, dass dies eben nicht Holmes‘ Abschiedsvorstellung ist, liest Stephen Fry die Abschiedsworte von Dr. Watson an seinen Freund Sherlock Holmes am Ende der Geschichte so herzzerreißend, dass ich trotzdem wieder einen Kloß im Hals hatte.
Ach ja, wenn man die Geschichte mal wieder hört/liest, ahnt man, warum Professor Moriarty so viele Menschen faszinierte und er deshalb in so vielen Pastiche-Geschichten auftritt: Gerade weil man über seine genialen Verbrecherfähigkeiten und sein Syndikat hier so wenig erfährt, Doyle beschreibt das nur kurz, kursorisch im Vorbeigehen und zweifach gebrochen (Holmes erzählt es Watson, Watson uns), regt das die Fantasy über dieses bedrohliche Criminal Mastermind sehr an. Ich müsste mal nachlesen, ob Norbert Jacques diese Geschichte kannte und schätzte. Jacques ist der Schöpfer von Dr. Mabuse.
Nachdem ich mich den Hörspiel-Bearbeitungen von „The Final Problem“ in den nächsten Tagen gewidmet habe, ist dann chronologisch der „Hund der Baskervilles“ dran, mit welchem ich sicher locker einen Monat zubringen werde, da hier nicht wenige Hörspiele-Bearbeitungen existieren, die weit mehr als die übliche Stunde dauern, hier sind 2-4 Stunden pro Hörspiel keine Seltenheit, die ich mir in der Regel aufteilen muss und nicht am Stück hören kann. Ich freue mich aber schon darauf.
Wie ich dem Holmes Kanon begegne (Audiobuch, dann diverse Hörspiele zu jeder Geschichte), ist sicherlich nicht für jedermann geeignet. Nicht jede/r hat Lust, häufig hintereinander mehr als ein halbes Dutzend Hörspielbearbeitungen derselben Geschichte dann immer zu hören, da muss man schon so ein Vergleichsfanatiker wie ich sein. Pädagogen nennen solche Wiederholungen „sichern“. Diese Art der Hardcore-Sicherung 2.0 ist für mich aber nur ein angenehmer Nebeneffekt, ich liebe es einfach, verschiedene akustische Darbietungen einer Szene mit denen, die ich noch im Ohr habe, zu vergleichen. Wobei ich persönlich auch zu den vielen Fans von Christian Rode gehöre, seine Rolleninterpretation für Maritim ist für mich die Blaupause eines idealen Holmes‘.
2.
Recht lange gebraucht habe ich für den ziemlich kurzen Roman „Silence“ (1966 als Chinmoku in Japan veröffentlicht, dt. Schweigen) von Shusaku Endo, den Martin Scorsese 2016 verfilmt hat. Der Roman ist eigentlich recht packend, aber auch unsagbar düster und grimmig, weswegen ich ihn auch drei Monate hatte mal liegen lassen. Erzählt wird die Geschichte eines portugiesischen Missionars, der 1638 nach Japan kommt. Waren Christen im 16. Jahrhundert noch sehr willkommen in Japan, und der Glaube konnte sich dort durch auch erheblich ausbreiten, wendete sich das Blatt dann im 17. Jahrhundert und als die Hauptfigur des Romans in Japan ankommt, sind Christen einer extremen Verfolgung ausgesetzt: wer erwischt wird, muss abschwören oder wird grausam hingerichtet – oder beides. Auch dieser Portugiese gerät in das Mahlwerk der Oppression der brutalen japanischen Landesfürsten und zerbricht daran, dass Gott zu all der Ungerechtigkeit schweigt. Vor allem muss der Priester aber feststellen, als er schließlich dann doch öffentlich auf ein Gottesbild drauftritt und damit abschwört (dies ist eine zu tiefst katholische Geschichte die in ihrer Bilder-Verehrung für protestantische Leser oder auch Ungläubige nicht immer ganz leicht nachvollziehbar ist), muss er feststellen, dass er nicht den Leidensweg Jesu, wie er als Trost hofft, sondern eher den des Judas nachvollzieht. Der schwermütige Roman enthält viele Folter- und Hinrichtungsszenen und ist von großer Trost- und Hoffnungslosigkeit geprägt, gleichwohl aber trotzdem eine intensive und bereichernde Leseerfahrung zum Thema Theodizee – und er ist kurz, der Roman umfasst gerade einmal 266 Seiten in der britischen TB-Ausgabe, die ich gelesen habe.
Nun bin ich gespannt auf die Verfilmungen, neben Scorseses fast 3-Stunden-Epos wurde der Roman auch bereits einmal in Japan im Jahr 1971 verfilmt – und dort adaptierte der Autor seinen Roman im Script selbst. Beide Verfilmungen werde ich demnächst mal ansehen und miteinander vergleichen, es dürfte spannend sein, diese Geschichte über ‚Fremde‘ in Japan einmal von japanischen Filmemachern und dann von nichtjapanischen Filmemachern nacherzählt zu bekommen.
3.
Vorletztes Jahr hatte ich mich ja intensiv mit dem „Graf von Monte Cristo“ von Alexandre Dumas d.Ä. beschäftigt und kehrte dieses Wochenende zu der Geschichte zurück, weil in der Reihe der Holysoft-Klassiker der Stoff erneut als Hörspiel adaptiert wurde. Im Gegensatz zu einer Radio-Bearbeitung auf 3 CDs (mit Mathieu Carrière als Edmond Dantès!), die Ende der Neunziger Jahre in zeitlicher Nähe zu der großen Gerard Depardieu-Miniserie heraus kam, adaptiert diese Holysoft-Vertonung den 1000-seitigen Stoff in nur, schluck, gerade mal 78 Minuten.
Wie bei vielen Adaptionen des Grafen wird ein Schwerpunkt auf den Anfang mit der Festungshaft gelegt, die auch in diesem Hörspiel gut die erste Hälfte der Spielzeit ausmacht (auch wenn das im Roman nicht mal 1/5 der Seiten einnimmt), während die verästelten und komplexen Rachepläne des Grafen in der Pariser Gesellschaft dann in der zweiten Hälfte verhandelt werden. Da diese gut 4/5 des Romans ausmachen, sind sie natürlich nur auf das Allerwesentlichste reduziert; insofern erstaunt es, dass dies zumindest für Leser des Romans einigermaßen gut funktioniert. Gratulation dafür an die Holysoft-Macher. Wer den Roman und den Stoff nicht kennt, dürfte sich trotz einer radikalen Reduzierung des Figurenensembles vermutlich doch etwas im Stoff verheddern oder zumindest wenig dabei empfinden, wenn diese Rachepläne nur als kurze Vignetten geschildert werden.
Gerade bei Holysoft, die häufig Adaptionen auch mal mehr Raum und Zeit gönnen, verwundert es, dass hier die Chance vertan wurde, den Roman ausführlicher zu adaptieren. Noch deutlich kürzer fielen allerdings die diversen Hörspiel-Adaptionen des Stoffes in den 1970ern für eher kindliche oder jugendliche Hörer aus, hier begnügte man sich in der Regel nur mit einer Dreiviertelstunde(!, so lange wie ne LP halt war) für den ganzen Roman. Die entsprechende Europa-Produktion ist bis heute in Wiederauflagen erhältlich. Ich habe mir jetzt einmal Konkurrenz-Versionen von PEG und Auditon nachbesorgt, mindestens drei weitere existieren auch noch. Für einen Vergleichsfetischisten wie mich sind gerade diese verschiedenen Versionen aus den Siebzigern häufig ein richtiges Fest, da es damals nicht so selten vorkam, dass ein Regisseur einen Stoff bei einem anderen Label noch einmal vertonte und dafür exakt dasselbe(!) Skript verwendete, nur häufig andere Sprecher oder die gleichen Sprecher in verschiedenen Rollen besetzte.
Die meisten dieser Versionen wurden bis heute nicht mehr neu aufgelegt, hier werde ich einmal mehr auf eBay zusammengekaufte gebrauchte Audio-Kassetten digitalisieren müssen, was für sich schon ein großes Vergnügen darstellt. Das ist ernst gemeint, hier fühlt man sich manchmal tatsächlich wie, als würde man Schätze der Vergangenheit entreißen.
Da mich der Stoff sehr fasziniert, werde ich vielleicht auch mal mit der Filmreihe weiter machen und habe mir gestern einmal die große französische Verfilmung von 1943 angesehen, die zu den berühmtesten Bearbeitungen des Romans gehört. Die Verfilmung ist auch gekonnt, die drei Stunden in zwei Teilen gehen schnell rum, allzu inspiriert ist die Regie aber nicht ausgefallen, die sich auf schlicht gekonntes Handwerk zurück zog. Auch hier kann ich wieder schön vergleichen, derselbe Regisseur Robert Vernay verfilmte den Roman gut zehn Jahre später 1954 noch einmal, dann in Farbe.
So. Nun weiter, auf zu neuen oder alten Abenteuern.
 Allenthalben raschelt es in der virtuellen Bücherwelt vor LBM18-Einträgen, -Hinweisen, -Reminiszenzen. Kommt mir das dies ja nur so vor, oder ist die Vorfreude und Euphorie zu Beginn der Messe gerade in der Phantastikszene dies Jahr besonders stark ausgeprägt? Ja, es kommt mir so vor. Das ist gut! Die LBM hat ihren Platz im Herzen der Phantasten gefunden, und sicher nicht nur dort.
Allenthalben raschelt es in der virtuellen Bücherwelt vor LBM18-Einträgen, -Hinweisen, -Reminiszenzen. Kommt mir das dies ja nur so vor, oder ist die Vorfreude und Euphorie zu Beginn der Messe gerade in der Phantastikszene dies Jahr besonders stark ausgeprägt? Ja, es kommt mir so vor. Das ist gut! Die LBM hat ihren Platz im Herzen der Phantasten gefunden, und sicher nicht nur dort.