|
rezensiert von Thomas Harbach
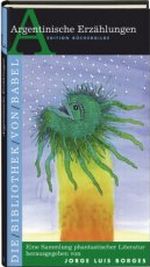 Als zweiter Band veröffentlicht Jorge Luis Borges in seiner 30 Bücher umfassenden Bibliothek von Babel eine Hommage an seine Heimat Argentinien. Insgesamt acht Stories von acht verschiedenen Autoren sind in dem kleinen Bändchen zusammengefasst. Wie Borges in seinem ausführlichen Vorwort – das allerdings mehr auf einen anderen argentinischen Autoren eingeht, dem ein eigenständiger Band in dieser Reihe gewidmet worden ist – beschreibt, gibt es im Grunde keine eigenständige Phantastik. Für viele der hier versammelten Autoren stellt die veröffentlichte Geschichte ihren einzigen Ausflug in das Übernatürliche dar. Argentinien ist und bleibt ein Land der Kontraste. Für Außenstehende auf Klischee wie Fußball, Gauchos, Evita, ein Land von herber Schönheit und grenzenloser Armut reduziert hat sich in den Jahrhunderten eine eigenständige Kultur entwickelt, deren Basis aber fest insbesondere die spanische Geschichte darstellt. Diese Mischung aus Exotik und charmanter Selbstironie macht die folgenden Geschichten zu einer interessanten Reise in eine oft fälschlich zum Klischee reduzierte Welt.
Als zweiter Band veröffentlicht Jorge Luis Borges in seiner 30 Bücher umfassenden Bibliothek von Babel eine Hommage an seine Heimat Argentinien. Insgesamt acht Stories von acht verschiedenen Autoren sind in dem kleinen Bändchen zusammengefasst. Wie Borges in seinem ausführlichen Vorwort – das allerdings mehr auf einen anderen argentinischen Autoren eingeht, dem ein eigenständiger Band in dieser Reihe gewidmet worden ist – beschreibt, gibt es im Grunde keine eigenständige Phantastik. Für viele der hier versammelten Autoren stellt die veröffentlichte Geschichte ihren einzigen Ausflug in das Übernatürliche dar. Argentinien ist und bleibt ein Land der Kontraste. Für Außenstehende auf Klischee wie Fußball, Gauchos, Evita, ein Land von herber Schönheit und grenzenloser Armut reduziert hat sich in den Jahrhunderten eine eigenständige Kultur entwickelt, deren Basis aber fest insbesondere die spanische Geschichte darstellt. Diese Mischung aus Exotik und charmanter Selbstironie macht die folgenden Geschichten zu einer interessanten Reise in eine oft fälschlich zum Klischee reduzierte Welt.
Der Auftakt „Der Tintentisch bleibt bei seiner Tinte“ aus der Feder Adolf Bioy Casares ist eine warmherzige Groteske über das Leben in einem kleinen Dorf und einen möglichen Besucher, der das ruhige Leben für einen kleinen Augenblick durcheinander bringt. Casares lässt seine Leser über die gesamte Geschichte ohne schlüssigen Beweis zurück, ob es erstens wirklich den Besucher gegeben hat, dessen Mission nicht der Phantasie entsprungen ist und sich jemand in der kleinen Gemeinschaft wichtig machen wollte. Gleichzeitig zeigt er sehr pointiert auf, wie der Mensch sich in seinen Gewohnheiten erst gegen den eigenen Willen stören lässt und dann nach kurzer Zeit diese Störungen fast sehnlich herbeiwünscht. Mit wenigen prägnanten Zügen charakterisiert er liebevoll die verschiedenen Extreme – vom Dorfschullehrer bis zum arroganten Politiker – einer kleinen Gemeinschaft. Eine unterhaltsame Geschichte, die am Ende alles der Phantasie der Leser überlässt und trotzdem funktioniert die Story. „Das Schicksal des Stümpers“ von Arturo Cancela und Pilar de Lusarreta enthält nur oberflächliche phantastische Elemente, zieht den Leser ab in seinen Bann. Ein Straßenbahnschaffner – als diese noch von Pferden gezogen worden - kollidiert mit einem der letzten Ochsenwagen und zerstört diesen. Im Krankenhaus flickt ihn der Arzt nur oberflächlich zusammen. Sein linkes Bein ist einige Zentimeter kürzer geworden. Deswegen kann der arme Mann nicht die modernen, sich immer mehr durchsetzenden elektrischen Straßenbahnen bedienen und wird zu den Pferdekutschen abgeschoben. Hier erlaubt ihm das Schicksal noch eine wichtige Fahrt, die schließlich wieder in einem Unfall endet. Wie der Erzähler am Ende eher lakonisch feststellt, hat das Schicksal seinen ersten Fehler korrigiert. Liebevoll mit vielen kleinen, fast subtilen Details ausgestattete Geschichte. Es dauert einige Seiten, bis man sich an den stoischen, sehr einfachen Charakter des Protagonisten gewöhnt hat. Da die Geschichte zwischen den Jahren 1888 und 1918 spielt, ist sie wie eine kleine Zeitreise. Mit einem Hauch von Ironie begleitet der Erzähler nicht nur den technologischen Fortschritt auf den Straßen, sondern zeigt deutlich, welche Bemühungen einige Teile der besseren Bevölkerung auf sich nehmen, den Deckmäntelchen von Anstand und Würde jeden Morgen überzuziehen. Diese Mischung aus Satire und Groteske macht die kurzweilig zu lesende, sehr warmherzige Geschichte zu einem der Höhepunkte dieser kleinen Sammlung.
Julia Cortazars „Das besetzte Haus“ könnte eine Geistergeschichte in der Tradition von „The Others“ sein. Es könnte aber auch eine Parabel über das Leben zweier exzentrischer, reicher Geschwister sein. Wie in Roman Polankis „Ekel“ verschließen sich zwei Menschen vor ihrer Umfeld, ordnen ihr Leben mit beamtenartiger Gründlichkeit und werden plötzlich von Geräuschen aus anderen Teilen des großen Hauses immer mehr in die Ecke und schließlich aus dem Haus gedrängt. Der Autor liefert keine weitergehenden Erklärungen. Alleine die Stimmung beherrscht diesen sehr kurzen Text. Es gelingt ihm, ein interessantes Stillleben zweier Menschen zu zeichnen, die mit der Welt abgeschlossen haben. Als sie ihre gewohnte Umgebung verlassen und sich vielleicht dem Leben wieder stellen müssen, endet leider die Geschichte auf einem zu offenen Ausgang oder Übergang. Manuel Mujica Lainez „Die Postkutsche“ ist nicht zuletzt aufgrund der Illusion von Tempo eine gelungene Erzählung. Eine reiche Frau eilt mit der Postkutsche nach Buenos Aires. In ihrer Heimat hat sie Verbrechen begangen, um an das Erbe der Familie zu kommen. Sie will in der Großstadt ein neues Leben mit ihrem gestohlenen Reichtum beginnen. Sie kann den Augenblick nicht erwarten, die Stadt zu betreten. Aber es reist noch jemand in der Postkutsche, der mit ihrer näheren Vergangenheit in einem engen Zusammenhang steht. Stilistisch ansprechend, sehr gedrängt, fast intensiv geschrieben konzentriert sich der Autor zuerst darauf, einen Endruck vom beschwerlichen Reisen mit der Postkutsche durch Argentinien zu beschreiben. Dann folgt eine kurze Charakterisierung der einzelnen Protagonisten und schließlich das überraschend phantastische Element, das in seiner Ausrichtung vorhersehbar, aber trotzdem stimmig ist.
„Dinge“ von Silvina Ocampo ist eine sehr kurze Geschichte. Das gibt die Erzählerin auch mitten im Text zu. Die Idee ist verblüffend einfach. Einge junge Frau beginnt plötzlich die Dinge wiederzufinden, die sie vor langer Zeit verloren hat. Chronologisch rückwärts in der Zeit findet sie bis zu ihrem Spielzeug im Grunde alles, was sie jemals aus den Augen verloren hat. Die Pointe ist kurz, aber nicht unbedingt stimmig. Hier wäre es sinnvoller gewesen, die Grundidee weiter zu extrapolieren als ein derartig plötzliches Ende zu finden. Eine in erster Linie durch die so einfache Idee lesenswerte Geschichte. Frederico Peltzers „Der Schachlehrer“ ist eine ebenso kurze, pointierte und doch unbefriedigende Parabel. Ein Mann beginnt einem Jungen das Schachspiel beizubringen. Dieser lernt sehr schnell und bleibt doch Schüler, weil sein Lehrer allmächtig ist. Die knappen drei Seiten reichen nicht aus, um die vielleicht effektive Prämisse wirklich gut dem Leser zu vermitteln und die Botschaft, nicht arrogant zu sein und demütig zu leben, geht ins Leere. Dazu ist der Lehrer zu allmächtig und der Zusammenhang zwischen seinen Geboten und der Geschichte zu dürftig.
Die letzten beiden Geschichten der Sammlung nutzen klassische Science Fiction Themen – Zeitreise und Unsterblichkeit – auf überraschend ansprechende Weise, um den labilen Alltag auf der einen Seite und große Emotionen auf der anderen Seiten in Mittelpunkt des Interesses zu rücken. Manuel Peyrou „Beinahe wäre es geschehen“ beginnt wie die Fugenromane eines Zoran Zivkovics mit einer alltäglichen, banalen Entdeckung. Ein Mann beobachtet durch einen Zufall, wie ein anderer Mann sich scheinbar selbst überholt. Entschlossen dieses Phänomen zu enträtseln beginnt er mit einem minutiösen Zeitablauf das Phänomen immer wieder zu beobachten. Als er daraus auf die Möglichkeit einer Zeitreise schließt und das Geheimnis dem unbewusst Reisenden entreißen will, zerbricht er unabsichtlich den labilen Kreislauf. Die Faszination dieser Geschichte liegt in ihrer profanen Alltäglichkeit. Der Leser kann bis zum Ende des Textes nicht entscheiden, ob die Zeitreise eine reale Alternative oder eine krankhafte Einbildung ist. Mit „Der Auserwählte“ aus der Feder Maria Ester Vazquez schließt die Sammlung argentinischer Geschichten. Ein Unsterblicher resümiert in seinen Aufzeichnungen über die Triumphe und Niederlagen seines Lebens. Beide lassen sich in erster Linie an den Frauen festmachen, die er geliebt und verloren hat. Erst gegen Ende des kurzen und kurzweilig zu lesenden Textes wird der Bogen zur Religion geschlagen. Die Stimmung ist melancholisch. Die Unsterblichkeit ist mehr und mehr zu einem Fluch geworden und hält für den Protagonisten keine Überraschungen mehr bereit. Das Ende ist es wenig zu theatralisch, aber eine interessante Variation eines im Grunde ausgereizten Themas.
Die hier versammelten Geschichten – leider fügt Borges in seinem Vorwort keine Angaben zur Entstehung der meisten Stories bei, sie scheinen aber alle aus dem 20. Jahrhundert zu stammen. Der Argentinier geht in seinem Vorwort ausführlich auf einen anderen Band der Bibliothek von Babel sehr ausführlich ein und beschränkt sich ansonsten auf eher oberflächliche biographische und bibliographische Angaben. Die Geschichten selbst beinhalten eher oberflächliche Spuren der Phantastik. Oft werden übernatürliche Phänomene nur angedeutet, aber selten expliziert ausgeführt. Der kulturelle Hintergrund ist reichhaltig, Argentinien wird als melancholische Diktatur beschrieben, in welche Siesta und Phlegma den Tagesablauf bestimmen. Eine gewisse Selbstironie zieht sich insbesondere durch die ersten Geschichten. Diese Randbemerkungen machen auch den Charme der hier versammelten Texte aus. Nicht alle Stories können in Hinblick auf ihren Plot und ihre Struktur überzeugen, sie sind aber alle stilistisch ansprechend – soweit man es in der Übersetzung überhaupt beurteilen kann – geschrieben worden. Nicht zuletzt aufgrund der Seltenheit argentinischer Phantastik über den Meister Jorge Luis Borges hinaus lohnt sich der Blick in diesen Band der Bibliothek von Babel.
Jorge Luis Borges (Hrgs.): "Argentinische Erzählungen"
Anthologie, Hardcover, 108 Seiten
edition Büchergilde 2007
ISBN 3-9401-1102-3

Leserrezensionen
:: Im Moment sind noch keine Leserrezensionen zu diesem Buch vorhanden ::
:: Vielleicht möchtest Du ja der Erste sein, der hierzu eine Leserezension verfasst? ::
|